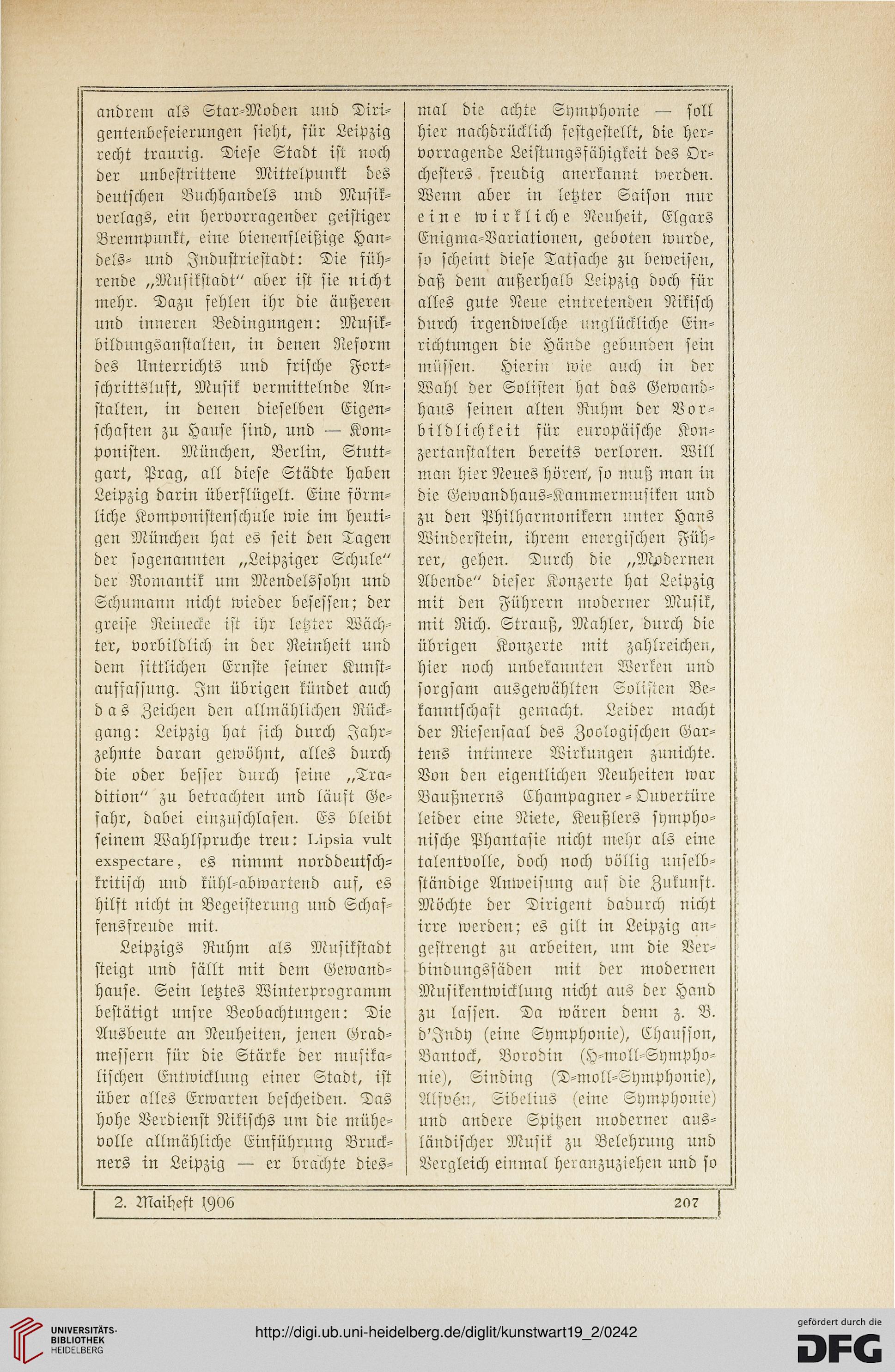andrem als Star-Moden und Diri-
gentenbefeierungen sieht, für Leipzig
recht traurig. Diese Stadt ist noch
der unbestrittene Mittelpunkt des
deutschen Buchhandels und Musik-
verlags, ein hervorragender geistiger
Brennpunkt, eine bienenfleißige Han-
dels- und Jndustriestadt: Die snh-
rende „Musikstadt" aber ist sie nicht
mehr. Dazu sehlen ihr die äußeren
und inneren Bedingungen: Musik-
bildungsanstalten, in denen Neform
des Unterrichts und frische Fort-
schrittsluft, Musik vermittelnde An-
stalten, in denen dieselben Eigen-
schaften zu Hause sind, und — Kom-
ponisten. München, Berlin, Stutt-
gart, Prag, all diese Städte haben
Leipzig darin überflügelt. Eine sörm-
liche Komponistenschule wie im heuti-
gen München hat es seit den Tagen
der sogenannten „Leipziger Schule"
der Romantik um Mendelssohn unb
Schumann nicht wieder besessen; der
greise Reinecke ist ihr letzter Wäch-
ter, vorbildlich in der Reinheit nnd
dem sittlichen Ernste seiner Kunst-
auffassung. Jm übrigen kündet auch
das Zeichen den allmählichen Rück-
gang: Leipzig hat sich durch Jahr-
zehnte daran gewöhnt, alles dnrch
die oder besser durch seine „Tra-
dition" zu betrachten und läuft Ge-
fahr, dabei einzuschlafen. Es bleibt
seinem Wahlspruche treu: lüpsin vult
exspsctLre, es nimmt norddeutsch-
kritisch und kühl-abwartend auf, es
hilft nicht in Begeisterung und Schaf-
fensfreude mit.
Leipzigs Ruhm als Musikstadt
steigt und sällt mit dem Gewand-
hause. Sein letztes Winterprogramm
bestätigt unsre Beobachtungen: Die
Ausbeute an Neuheiten, jenen Grad-
messern für die Stärke der musika-
lischen Entwicklung einer Stadt, ist
über alles Erwarten bescheiden. Das
hohe Verdienst Nikischs um die mühe-
volle allmähliche Einsührung Bruck-
ners in Leipzig — er brachte dies-
mal die achte Symphonie — soll
hier nachdrücklich festgestellt, die her-
vorragende Leistungsfähigkeit des Or-
chesters sreudig anerkannt werden.
Wenn aber in letzter Saison nur
eine wirkliche Neuheit, Elgars
Enigma-Variationen, geboten wurde,
so scheint diese Tatsache zu beweisen,
daß dem außerhalb Leipzig doch sür
alles gute Neue eintretenden Nikisch
durch irgendwelche unglückliche Ein-
richtungen die Hände gebunden sein
müssen. Hierin wie auch in der
Wahl der Solisten hat das Gewand-
hans seinen alten Ruhm der Vor-
bildlichkeit für europäische Kon-
zertanstalten bereits verloren. Will
man hier Neues hörew, so nmß man in
die Gewandhaus-Kammermusiken und
zu den Philharmonikern nnter Hans
Winderstein, ihrem energischen Füh-
rer, gehen. Durch die „M^dernen
Abende" dieser Konzerte hat Leipzig
mit den Führern moderner Musik,
mit Rich. Strauß, Mahler, durch die
übrigen Konzerte mit zahlreichen,
hier noch unbekannten Werken und
sorgsam ausgewählten Solisten Be-
kanntschast gemacht. Leider macht
der Riesensaal des Zoologischen Gar-
tens intimere Wirkungen znnichte.
Von den eigentlichen Neuheiten war
Baußnerns Champagner - Ouvertüre
leider eine Ni-ete, Keußlers sympho-
nische Phantasie nicht mehr als eine
talentvolle, doch noch völlig unselb-
ständige Anweisung auf die Zukunft.
Möchte der Dirigent dadurch nicht
irre werden; es gilt in Leipzig an-
gestrengt zu arbeiten, um die Ver-
bindungsfäden mit der modernen
Musikentwicklung nicht aus der Hand
zu lassen. Da wären denn z. B.
d'Jndh (eine Symphonie), Chausson,
l Bantock, Borodin (H-moll-Sympho-
j nie), Sinding (D-moll-Shmphonie),
Alfvsn, Sibelius (eine Symphonie)
und andere Spitzen moderner aus-
ländischer Musik zu Belehrung und
Vergleich einmal heranzuziehen und so
2. Maiheft (906
20?
gentenbefeierungen sieht, für Leipzig
recht traurig. Diese Stadt ist noch
der unbestrittene Mittelpunkt des
deutschen Buchhandels und Musik-
verlags, ein hervorragender geistiger
Brennpunkt, eine bienenfleißige Han-
dels- und Jndustriestadt: Die snh-
rende „Musikstadt" aber ist sie nicht
mehr. Dazu sehlen ihr die äußeren
und inneren Bedingungen: Musik-
bildungsanstalten, in denen Neform
des Unterrichts und frische Fort-
schrittsluft, Musik vermittelnde An-
stalten, in denen dieselben Eigen-
schaften zu Hause sind, und — Kom-
ponisten. München, Berlin, Stutt-
gart, Prag, all diese Städte haben
Leipzig darin überflügelt. Eine sörm-
liche Komponistenschule wie im heuti-
gen München hat es seit den Tagen
der sogenannten „Leipziger Schule"
der Romantik um Mendelssohn unb
Schumann nicht wieder besessen; der
greise Reinecke ist ihr letzter Wäch-
ter, vorbildlich in der Reinheit nnd
dem sittlichen Ernste seiner Kunst-
auffassung. Jm übrigen kündet auch
das Zeichen den allmählichen Rück-
gang: Leipzig hat sich durch Jahr-
zehnte daran gewöhnt, alles dnrch
die oder besser durch seine „Tra-
dition" zu betrachten und läuft Ge-
fahr, dabei einzuschlafen. Es bleibt
seinem Wahlspruche treu: lüpsin vult
exspsctLre, es nimmt norddeutsch-
kritisch und kühl-abwartend auf, es
hilft nicht in Begeisterung und Schaf-
fensfreude mit.
Leipzigs Ruhm als Musikstadt
steigt und sällt mit dem Gewand-
hause. Sein letztes Winterprogramm
bestätigt unsre Beobachtungen: Die
Ausbeute an Neuheiten, jenen Grad-
messern für die Stärke der musika-
lischen Entwicklung einer Stadt, ist
über alles Erwarten bescheiden. Das
hohe Verdienst Nikischs um die mühe-
volle allmähliche Einsührung Bruck-
ners in Leipzig — er brachte dies-
mal die achte Symphonie — soll
hier nachdrücklich festgestellt, die her-
vorragende Leistungsfähigkeit des Or-
chesters sreudig anerkannt werden.
Wenn aber in letzter Saison nur
eine wirkliche Neuheit, Elgars
Enigma-Variationen, geboten wurde,
so scheint diese Tatsache zu beweisen,
daß dem außerhalb Leipzig doch sür
alles gute Neue eintretenden Nikisch
durch irgendwelche unglückliche Ein-
richtungen die Hände gebunden sein
müssen. Hierin wie auch in der
Wahl der Solisten hat das Gewand-
hans seinen alten Ruhm der Vor-
bildlichkeit für europäische Kon-
zertanstalten bereits verloren. Will
man hier Neues hörew, so nmß man in
die Gewandhaus-Kammermusiken und
zu den Philharmonikern nnter Hans
Winderstein, ihrem energischen Füh-
rer, gehen. Durch die „M^dernen
Abende" dieser Konzerte hat Leipzig
mit den Führern moderner Musik,
mit Rich. Strauß, Mahler, durch die
übrigen Konzerte mit zahlreichen,
hier noch unbekannten Werken und
sorgsam ausgewählten Solisten Be-
kanntschast gemacht. Leider macht
der Riesensaal des Zoologischen Gar-
tens intimere Wirkungen znnichte.
Von den eigentlichen Neuheiten war
Baußnerns Champagner - Ouvertüre
leider eine Ni-ete, Keußlers sympho-
nische Phantasie nicht mehr als eine
talentvolle, doch noch völlig unselb-
ständige Anweisung auf die Zukunft.
Möchte der Dirigent dadurch nicht
irre werden; es gilt in Leipzig an-
gestrengt zu arbeiten, um die Ver-
bindungsfäden mit der modernen
Musikentwicklung nicht aus der Hand
zu lassen. Da wären denn z. B.
d'Jndh (eine Symphonie), Chausson,
l Bantock, Borodin (H-moll-Sympho-
j nie), Sinding (D-moll-Shmphonie),
Alfvsn, Sibelius (eine Symphonie)
und andere Spitzen moderner aus-
ländischer Musik zu Belehrung und
Vergleich einmal heranzuziehen und so
2. Maiheft (906
20?