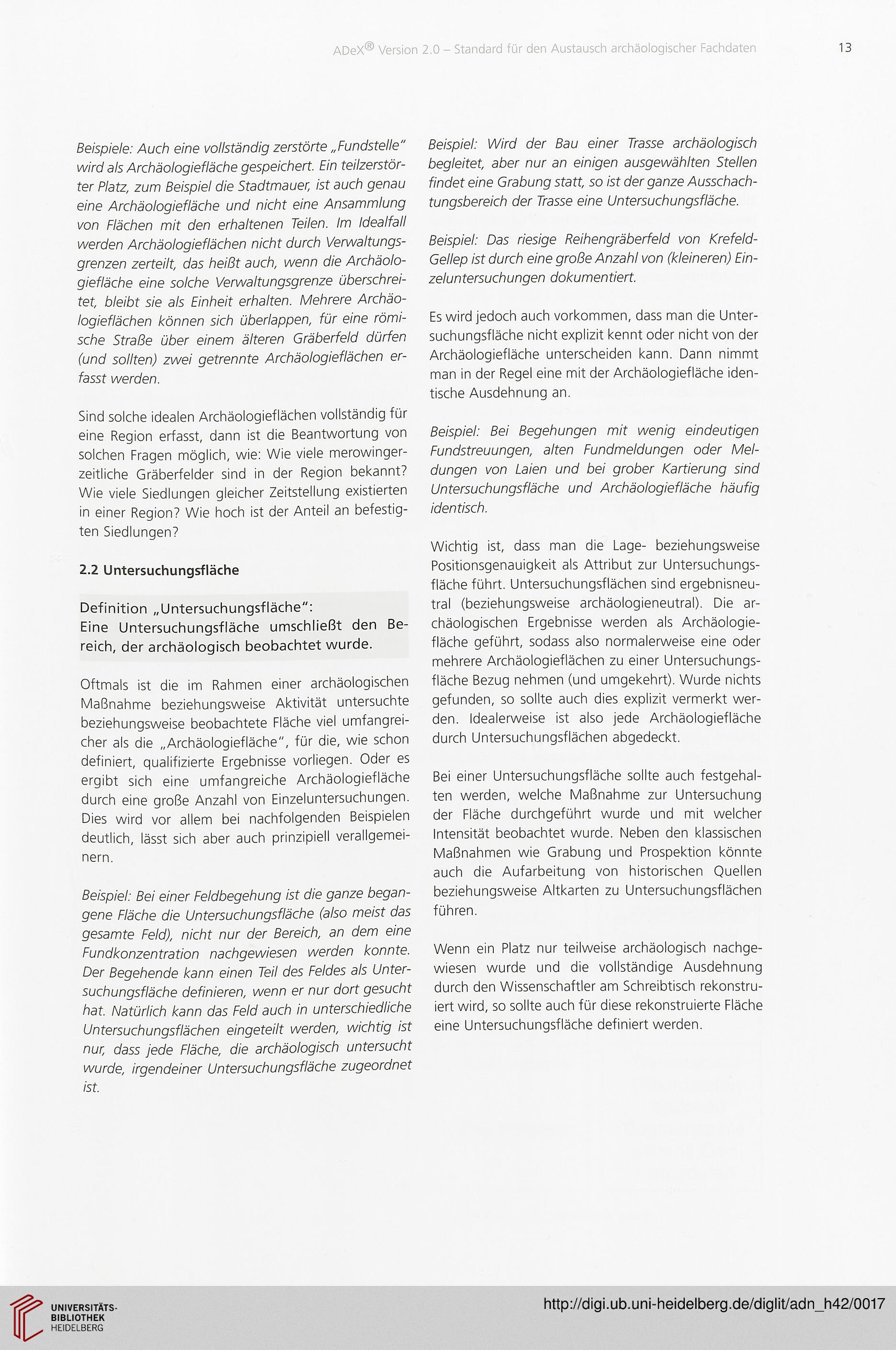ADeX® Version 2.0 - Standard für den Austausch archäologischer Fachdaten
13
Beispiele: Auch eine vollständig zerstörte „Fundstelle"
wird als Archäologiefläche gespeichert. Ein teilzerstör-
ter Platz, zum Beispiel die Stadtmauer, ist auch genau
eine Archäologiefläche und nicht eine Ansammlung
von Flächen mit den erhaltenen Teilen. Im Idealfall
werden Archäologieflächen nicht durch Verwaltungs-
grenzen zerteilt, das heißt auch, wenn die Archäolo-
giefläche eine solche Verwaltungsgrenze überschrei-
tet, bleibt sie als Einheit erhalten. Mehrere Archäo-
logieflächen können sich überlappen, für eine römi-
sche Straße über einem älteren Gräberfeld dürfen
(und sollten) zwei getrennte Archäologieflächen er-
fasst werden.
Sind solche idealen Archäologieflächen vollständig für
eine Region erfasst, dann ist die Beantwortung von
solchen Fragen möglich, wie: Wie viele merowinger-
zeitliche Gräberfelder sind in der Region bekannt?
Wie viele Siedlungen gleicher Zeitstellung existierten
in einer Region? Wie hoch ist der Anteil an befestig-
ten Siedlungen?
2.2 Untersuchungsfläche
Definition „Untersuchungsfläche":
Eine Untersuchungsfläche umschließt den Be-
reich, der archäologisch beobachtet wurde.
Oftmals ist die im Rahmen einer archäologischen
Maßnahme beziehungsweise Aktivität untersuchte
beziehungsweise beobachtete Fläche viel umfangrei-
cher als die „Archäologiefläche", für die, wie schon
definiert, qualifizierte Ergebnisse vorliegen. Oder es
ergibt sich eine umfangreiche Archäologiefläche
durch eine große Anzahl von Einzeluntersuchungen.
Dies wird vor allem bei nachfolgenden Beispielen
deutlich, lässt sich aber auch prinzipiell verallgemei-
nern.
Beispiel: Bei einer Feldbegehung ist die ganze began-
gene Fläche die Untersuchungsfläche (also meist das
gesamte Feld), nicht nur der Bereich, an dem eine
Fundkonzentration nachgewiesen werden konnte.
Der Begehende kann einen Teil des Feldes als Unter-
suchungsfläche definieren, wenn er nur dort gesucht
hat. Natürlich kann das Feld auch in unterschiedliche
Untersuchungsflächen eingeteilt werden, wichtig ist
nur, dass jede Fläche, die archäologisch untersucht
wurde, irgendeiner Untersuchungsfläche zugeordnet
ist.
Beispiel: Wird der Bau einer Trasse archäologisch
begleitet, aber nur an einigen ausgewählten Stellen
findet eine Grabung statt, so ist der ganze Ausschach-
tungsbereich der Trasse eine Untersuchungsfläche.
Beispiel: Das riesige Reihengräberfeld von Krefeld-
Gellep ist durch eine große Anzahl von (kleineren) Ein-
zeluntersuchungen dokumentiert.
Es wird jedoch auch vorkommen, dass man die Unter-
suchungsfläche nicht explizit kennt oder nicht von der
Archäologiefläche unterscheiden kann. Dann nimmt
man in der Regel eine mit der Archäologiefläche iden-
tische Ausdehnung an.
Beispiel: Bei Begehungen mit wenig eindeutigen
Fundstreuungen, alten Fundmeldungen oder Mel-
dungen von Laien und bei grober Kartierung sind
Untersuchungsfläche und Archäologiefläche häufig
identisch.
Wichtig ist, dass man die Lage- beziehungsweise
Positionsgenauigkeit als Attribut zur Untersuchungs-
fläche führt. Untersuchungsflächen sind ergebnisneu-
tral (beziehungsweise archäologieneutral). Die ar-
chäologischen Ergebnisse werden als Archäologie-
fläche geführt, sodass also normalerweise eine oder
mehrere Archäologieflächen zu einer Untersuchungs-
fläche Bezug nehmen (und umgekehrt). Wurde nichts
gefunden, so sollte auch dies explizit vermerkt wer-
den. Idealerweise ist also jede Archäologiefläche
durch Untersuchungsflächen abgedeckt.
Bei einer Untersuchungsfläche sollte auch festgehal-
ten werden, welche Maßnahme zur Untersuchung
der Fläche durchgeführt wurde und mit welcher
Intensität beobachtet wurde. Neben den klassischen
Maßnahmen wie Grabung und Prospektion könnte
auch die Aufarbeitung von historischen Quellen
beziehungsweise Altkarten zu Untersuchungsflächen
führen.
Wenn ein Platz nur teilweise archäologisch nachge-
wiesen wurde und die vollständige Ausdehnung
durch den Wissenschaftler am Schreibtisch rekonstru-
iert wird, so sollte auch für diese rekonstruierte Fläche
eine Untersuchungsfläche definiert werden.
13
Beispiele: Auch eine vollständig zerstörte „Fundstelle"
wird als Archäologiefläche gespeichert. Ein teilzerstör-
ter Platz, zum Beispiel die Stadtmauer, ist auch genau
eine Archäologiefläche und nicht eine Ansammlung
von Flächen mit den erhaltenen Teilen. Im Idealfall
werden Archäologieflächen nicht durch Verwaltungs-
grenzen zerteilt, das heißt auch, wenn die Archäolo-
giefläche eine solche Verwaltungsgrenze überschrei-
tet, bleibt sie als Einheit erhalten. Mehrere Archäo-
logieflächen können sich überlappen, für eine römi-
sche Straße über einem älteren Gräberfeld dürfen
(und sollten) zwei getrennte Archäologieflächen er-
fasst werden.
Sind solche idealen Archäologieflächen vollständig für
eine Region erfasst, dann ist die Beantwortung von
solchen Fragen möglich, wie: Wie viele merowinger-
zeitliche Gräberfelder sind in der Region bekannt?
Wie viele Siedlungen gleicher Zeitstellung existierten
in einer Region? Wie hoch ist der Anteil an befestig-
ten Siedlungen?
2.2 Untersuchungsfläche
Definition „Untersuchungsfläche":
Eine Untersuchungsfläche umschließt den Be-
reich, der archäologisch beobachtet wurde.
Oftmals ist die im Rahmen einer archäologischen
Maßnahme beziehungsweise Aktivität untersuchte
beziehungsweise beobachtete Fläche viel umfangrei-
cher als die „Archäologiefläche", für die, wie schon
definiert, qualifizierte Ergebnisse vorliegen. Oder es
ergibt sich eine umfangreiche Archäologiefläche
durch eine große Anzahl von Einzeluntersuchungen.
Dies wird vor allem bei nachfolgenden Beispielen
deutlich, lässt sich aber auch prinzipiell verallgemei-
nern.
Beispiel: Bei einer Feldbegehung ist die ganze began-
gene Fläche die Untersuchungsfläche (also meist das
gesamte Feld), nicht nur der Bereich, an dem eine
Fundkonzentration nachgewiesen werden konnte.
Der Begehende kann einen Teil des Feldes als Unter-
suchungsfläche definieren, wenn er nur dort gesucht
hat. Natürlich kann das Feld auch in unterschiedliche
Untersuchungsflächen eingeteilt werden, wichtig ist
nur, dass jede Fläche, die archäologisch untersucht
wurde, irgendeiner Untersuchungsfläche zugeordnet
ist.
Beispiel: Wird der Bau einer Trasse archäologisch
begleitet, aber nur an einigen ausgewählten Stellen
findet eine Grabung statt, so ist der ganze Ausschach-
tungsbereich der Trasse eine Untersuchungsfläche.
Beispiel: Das riesige Reihengräberfeld von Krefeld-
Gellep ist durch eine große Anzahl von (kleineren) Ein-
zeluntersuchungen dokumentiert.
Es wird jedoch auch vorkommen, dass man die Unter-
suchungsfläche nicht explizit kennt oder nicht von der
Archäologiefläche unterscheiden kann. Dann nimmt
man in der Regel eine mit der Archäologiefläche iden-
tische Ausdehnung an.
Beispiel: Bei Begehungen mit wenig eindeutigen
Fundstreuungen, alten Fundmeldungen oder Mel-
dungen von Laien und bei grober Kartierung sind
Untersuchungsfläche und Archäologiefläche häufig
identisch.
Wichtig ist, dass man die Lage- beziehungsweise
Positionsgenauigkeit als Attribut zur Untersuchungs-
fläche führt. Untersuchungsflächen sind ergebnisneu-
tral (beziehungsweise archäologieneutral). Die ar-
chäologischen Ergebnisse werden als Archäologie-
fläche geführt, sodass also normalerweise eine oder
mehrere Archäologieflächen zu einer Untersuchungs-
fläche Bezug nehmen (und umgekehrt). Wurde nichts
gefunden, so sollte auch dies explizit vermerkt wer-
den. Idealerweise ist also jede Archäologiefläche
durch Untersuchungsflächen abgedeckt.
Bei einer Untersuchungsfläche sollte auch festgehal-
ten werden, welche Maßnahme zur Untersuchung
der Fläche durchgeführt wurde und mit welcher
Intensität beobachtet wurde. Neben den klassischen
Maßnahmen wie Grabung und Prospektion könnte
auch die Aufarbeitung von historischen Quellen
beziehungsweise Altkarten zu Untersuchungsflächen
führen.
Wenn ein Platz nur teilweise archäologisch nachge-
wiesen wurde und die vollständige Ausdehnung
durch den Wissenschaftler am Schreibtisch rekonstru-
iert wird, so sollte auch für diese rekonstruierte Fläche
eine Untersuchungsfläche definiert werden.