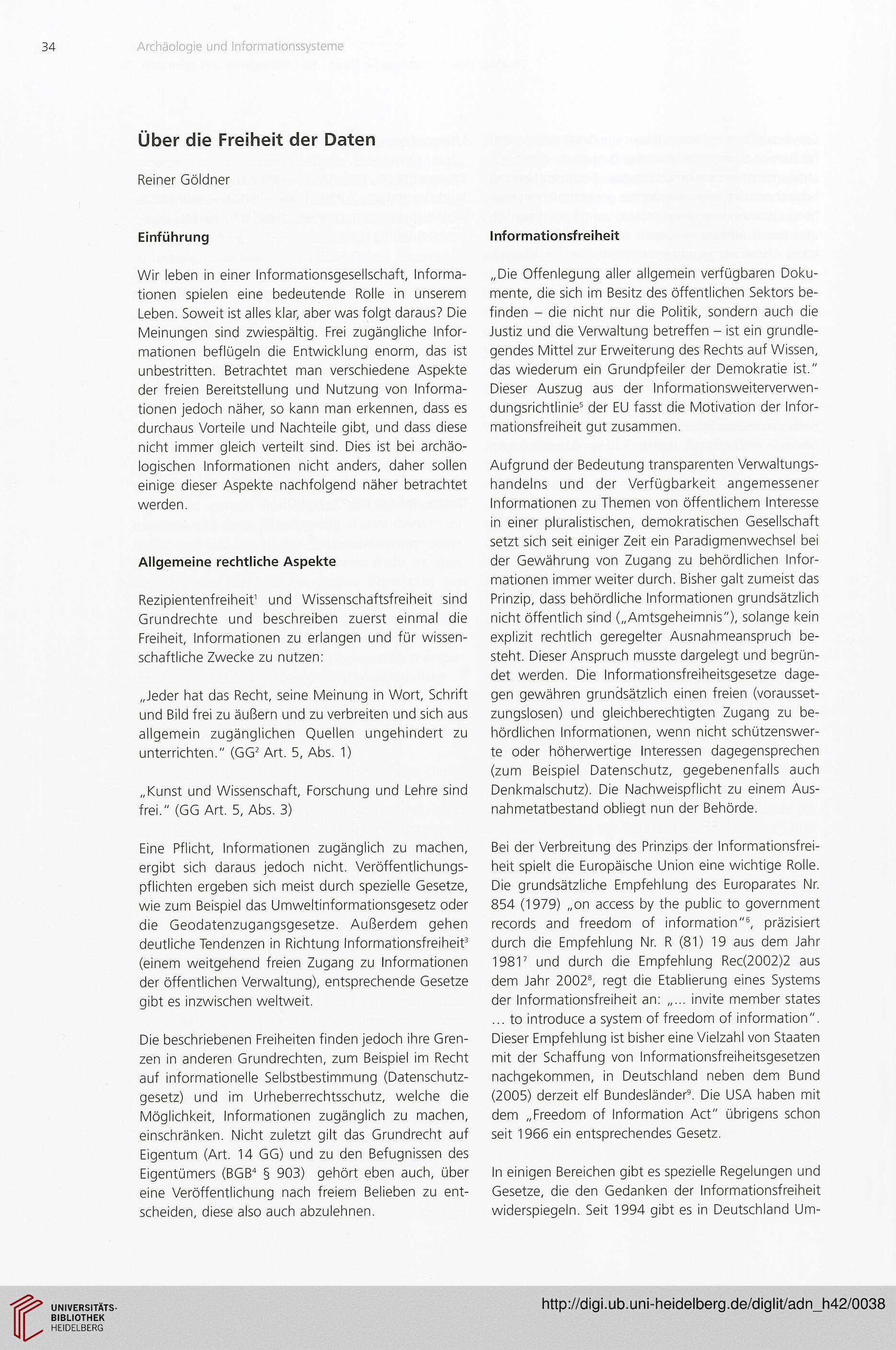34
Archäologie und Informationssysteme
Über die Freiheit der Daten
Reiner Göldner
Einführung
Wir leben in einer Informationsgesellschaft, Informa-
tionen spielen eine bedeutende Rolle in unserem
Leben. Soweit ist alles klar, aber was folgt daraus? Die
Meinungen sind zwiespältig. Frei zugängliche Infor-
mationen beflügeln die Entwicklung enorm, das ist
unbestritten. Betrachtet man verschiedene Aspekte
der freien Bereitstellung und Nutzung von Informa-
tionen jedoch näher, so kann man erkennen, dass es
durchaus Vorteile und Nachteile gibt, und dass diese
nicht immer gleich verteilt sind. Dies ist bei archäo-
logischen Informationen nicht anders, daher sollen
einige dieser Aspekte nachfolgend näher betrachtet
werden.
Allgemeine rechtliche Aspekte
Rezipientenfreiheit' und Wissenschaftsfreiheit sind
Grundrechte und beschreiben zuerst einmal die
Freiheit, Informationen zu erlangen und für wissen-
schaftliche Zwecke zu nutzen:
„Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift
und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus
allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu
unterrichten." (GG2 Art. 5, Abs. 1)
„Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind
frei." (GG Art. 5, Abs. 3)
Eine Pflicht, Informationen zugänglich zu machen,
ergibt sich daraus jedoch nicht. Veröffentlichungs-
pflichten ergeben sich meist durch spezielle Gesetze,
wie zum Beispiel das Umweltinformationsgesetz oder
die Geodatenzugangsgesetze. Außerdem gehen
deutliche Tendenzen in Richtung Informationsfreiheit3
(einem weitgehend freien Zugang zu Informationen
der öffentlichen Verwaltung), entsprechende Gesetze
gibt es inzwischen weltweit.
Die beschriebenen Freiheiten finden jedoch ihre Gren-
zen in anderen Grundrechten, zum Beispiel im Recht
auf informationelle Selbstbestimmung (Datenschutz-
gesetz) und im Urheberrechtsschutz, welche die
Möglichkeit, Informationen zugänglich zu machen,
einschränken. Nicht zuletzt gilt das Grundrecht auf
Eigentum (Art. 14 GG) und zu den Befugnissen des
Eigentümers (BGB4 § 903) gehört eben auch, über
eine Veröffentlichung nach freiem Belieben zu ent-
scheiden, diese also auch abzulehnen.
Informationsfreiheit
„Die Offenlegung aller allgemein verfügbaren Doku-
mente, die sich im Besitz des öffentlichen Sektors be-
finden - die nicht nur die Politik, sondern auch die
Justiz und die Verwaltung betreffen - ist ein grundle-
gendes Mittel zur Erweiterung des Rechts auf Wissen,
das wiederum ein Grundpfeiler der Demokratie ist."
Dieser Auszug aus der Informationsweiterverwen-
dungsrichtlinie5 der EU fasst die Motivation der Infor-
mationsfreiheit gut zusammen.
Aufgrund der Bedeutung transparenten Verwaltungs-
handelns und der Verfügbarkeit angemessener
Informationen zu Themen von öffentlichem Interesse
in einer pluralistischen, demokratischen Gesellschaft
setzt sich seit einiger Zeit ein Paradigmenwechsel bei
der Gewährung von Zugang zu behördlichen Infor-
mationen immer weiter durch. Bisher galt zumeist das
Prinzip, dass behördliche Informationen grundsätzlich
nicht öffentlich sind („Amtsgeheimnis"), solange kein
explizit rechtlich geregelter Ausnahmeanspruch be-
steht. Dieser Anspruch musste dargelegt und begrün-
det werden. Die Informationsfreiheitsgesetze dage-
gen gewähren grundsätzlich einen freien (vorausset-
zungslosen) und gleichberechtigten Zugang zu be-
hördlichen Informationen, wenn nicht schützenswer-
te oder höherwertige Interessen dagegensprechen
(zum Beispiel Datenschutz, gegebenenfalls auch
Denkmalschutz). Die Nachweispflicht zu einem Aus-
nahmetatbestand obliegt nun der Behörde.
Bei der Verbreitung des Prinzips der Informationsfrei-
heit spielt die Europäische Union eine wichtige Rolle.
Die grundsätzliche Empfehlung des Europarates Nr.
854 (1979) „on access by the public to government
records and freedom of Information"6, präzisiert
durch die Empfehlung Nr. R (81) 19 aus dem Jahr
19817 und durch die Empfehlung Rec(2002)2 aus
dem Jahr 20028, regt die Etablierung eines Systems
der Informationsfreiheit an: „... invite member States
... to introduce a System of freedom of information".
Dieser Empfehlung ist bisher eine Vielzahl von Staaten
mit der Schaffung von Informationsfreiheitsgesetzen
nachgekommen, in Deutschland neben dem Bund
(2005) derzeit elf Bundesländer9. Die USA haben mit
dem „Freedom of Information Act" übrigens schon
seit 1966 ein entsprechendes Gesetz.
In einigen Bereichen gibt es spezielle Regelungen und
Gesetze, die den Gedanken der Informationsfreiheit
widerspiegeln. Seit 1994 gibt es in Deutschland Um-
Archäologie und Informationssysteme
Über die Freiheit der Daten
Reiner Göldner
Einführung
Wir leben in einer Informationsgesellschaft, Informa-
tionen spielen eine bedeutende Rolle in unserem
Leben. Soweit ist alles klar, aber was folgt daraus? Die
Meinungen sind zwiespältig. Frei zugängliche Infor-
mationen beflügeln die Entwicklung enorm, das ist
unbestritten. Betrachtet man verschiedene Aspekte
der freien Bereitstellung und Nutzung von Informa-
tionen jedoch näher, so kann man erkennen, dass es
durchaus Vorteile und Nachteile gibt, und dass diese
nicht immer gleich verteilt sind. Dies ist bei archäo-
logischen Informationen nicht anders, daher sollen
einige dieser Aspekte nachfolgend näher betrachtet
werden.
Allgemeine rechtliche Aspekte
Rezipientenfreiheit' und Wissenschaftsfreiheit sind
Grundrechte und beschreiben zuerst einmal die
Freiheit, Informationen zu erlangen und für wissen-
schaftliche Zwecke zu nutzen:
„Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift
und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus
allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu
unterrichten." (GG2 Art. 5, Abs. 1)
„Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind
frei." (GG Art. 5, Abs. 3)
Eine Pflicht, Informationen zugänglich zu machen,
ergibt sich daraus jedoch nicht. Veröffentlichungs-
pflichten ergeben sich meist durch spezielle Gesetze,
wie zum Beispiel das Umweltinformationsgesetz oder
die Geodatenzugangsgesetze. Außerdem gehen
deutliche Tendenzen in Richtung Informationsfreiheit3
(einem weitgehend freien Zugang zu Informationen
der öffentlichen Verwaltung), entsprechende Gesetze
gibt es inzwischen weltweit.
Die beschriebenen Freiheiten finden jedoch ihre Gren-
zen in anderen Grundrechten, zum Beispiel im Recht
auf informationelle Selbstbestimmung (Datenschutz-
gesetz) und im Urheberrechtsschutz, welche die
Möglichkeit, Informationen zugänglich zu machen,
einschränken. Nicht zuletzt gilt das Grundrecht auf
Eigentum (Art. 14 GG) und zu den Befugnissen des
Eigentümers (BGB4 § 903) gehört eben auch, über
eine Veröffentlichung nach freiem Belieben zu ent-
scheiden, diese also auch abzulehnen.
Informationsfreiheit
„Die Offenlegung aller allgemein verfügbaren Doku-
mente, die sich im Besitz des öffentlichen Sektors be-
finden - die nicht nur die Politik, sondern auch die
Justiz und die Verwaltung betreffen - ist ein grundle-
gendes Mittel zur Erweiterung des Rechts auf Wissen,
das wiederum ein Grundpfeiler der Demokratie ist."
Dieser Auszug aus der Informationsweiterverwen-
dungsrichtlinie5 der EU fasst die Motivation der Infor-
mationsfreiheit gut zusammen.
Aufgrund der Bedeutung transparenten Verwaltungs-
handelns und der Verfügbarkeit angemessener
Informationen zu Themen von öffentlichem Interesse
in einer pluralistischen, demokratischen Gesellschaft
setzt sich seit einiger Zeit ein Paradigmenwechsel bei
der Gewährung von Zugang zu behördlichen Infor-
mationen immer weiter durch. Bisher galt zumeist das
Prinzip, dass behördliche Informationen grundsätzlich
nicht öffentlich sind („Amtsgeheimnis"), solange kein
explizit rechtlich geregelter Ausnahmeanspruch be-
steht. Dieser Anspruch musste dargelegt und begrün-
det werden. Die Informationsfreiheitsgesetze dage-
gen gewähren grundsätzlich einen freien (vorausset-
zungslosen) und gleichberechtigten Zugang zu be-
hördlichen Informationen, wenn nicht schützenswer-
te oder höherwertige Interessen dagegensprechen
(zum Beispiel Datenschutz, gegebenenfalls auch
Denkmalschutz). Die Nachweispflicht zu einem Aus-
nahmetatbestand obliegt nun der Behörde.
Bei der Verbreitung des Prinzips der Informationsfrei-
heit spielt die Europäische Union eine wichtige Rolle.
Die grundsätzliche Empfehlung des Europarates Nr.
854 (1979) „on access by the public to government
records and freedom of Information"6, präzisiert
durch die Empfehlung Nr. R (81) 19 aus dem Jahr
19817 und durch die Empfehlung Rec(2002)2 aus
dem Jahr 20028, regt die Etablierung eines Systems
der Informationsfreiheit an: „... invite member States
... to introduce a System of freedom of information".
Dieser Empfehlung ist bisher eine Vielzahl von Staaten
mit der Schaffung von Informationsfreiheitsgesetzen
nachgekommen, in Deutschland neben dem Bund
(2005) derzeit elf Bundesländer9. Die USA haben mit
dem „Freedom of Information Act" übrigens schon
seit 1966 ein entsprechendes Gesetz.
In einigen Bereichen gibt es spezielle Regelungen und
Gesetze, die den Gedanken der Informationsfreiheit
widerspiegeln. Seit 1994 gibt es in Deutschland Um-