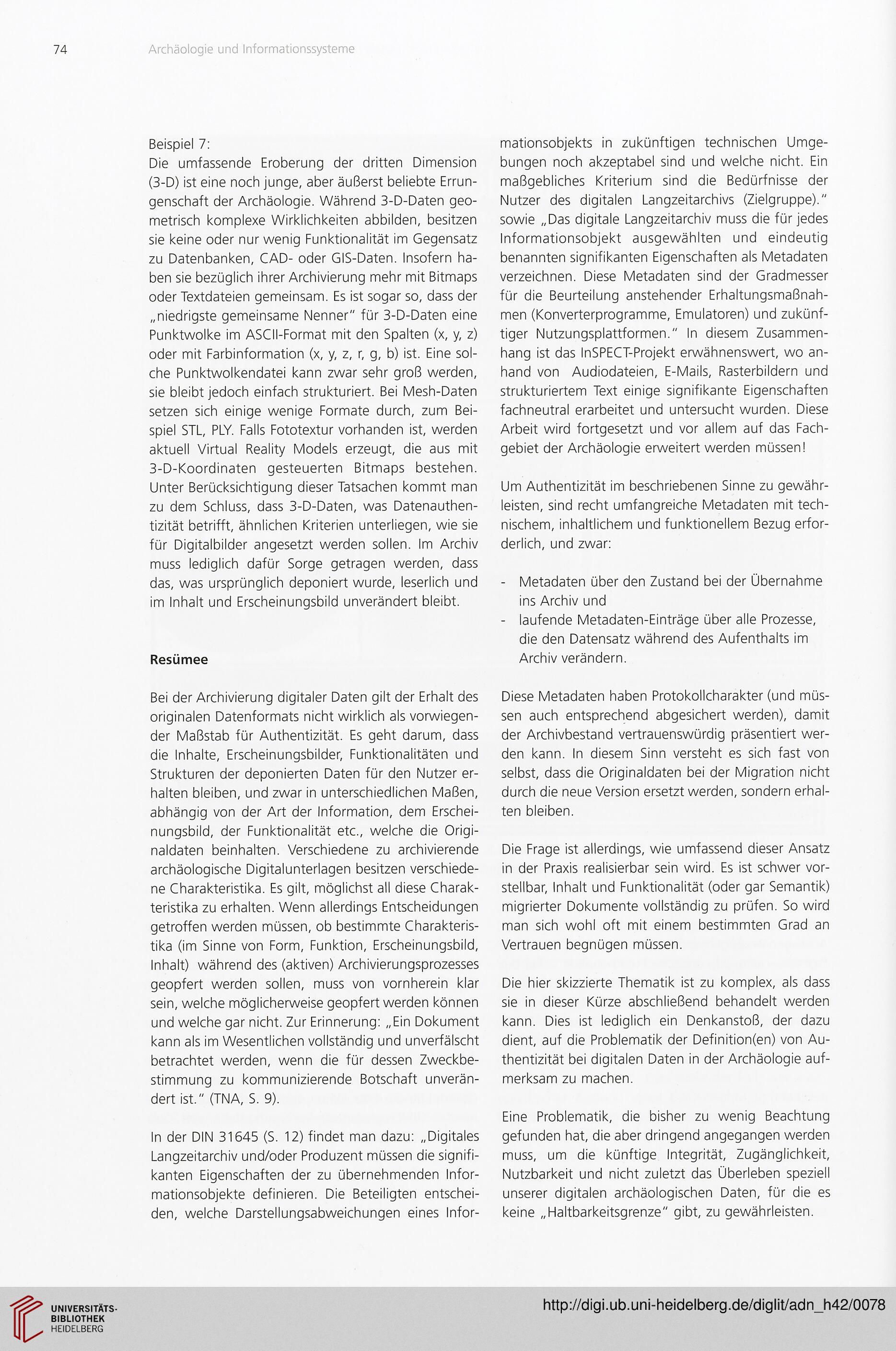74
Archäologie und Informationssysteme
Beispiel 7:
Die umfassende Eroberung der dritten Dimension
(3-D) ist eine noch junge, aber äußerst beliebte Errun-
genschaft der Archäologie. Während 3-D-Daten geo-
metrisch komplexe Wirklichkeiten abbilden, besitzen
sie keine oder nur wenig Funktionalität im Gegensatz
zu Datenbanken, CAD- oder GIS-Daten. Insofern ha-
ben sie bezüglich ihrer Archivierung mehr mit Bitmaps
oder Textdateien gemeinsam. Es ist sogar so, dass der
„niedrigste gemeinsame Nenner" für 3-D-Daten eine
Punktwolke im ASCII-Format mit den Spalten (x, y, z)
oder mit Farbinformation (x, y, z, r, g, b) ist. Eine sol-
che Punktwolkendatei kann zwar sehr groß werden,
sie bleibt jedoch einfach strukturiert. Bei Mesh-Daten
setzen sich einige wenige Formate durch, zum Bei-
spiel STL, PLY. Falls Fototextur vorhanden ist, werden
aktuell Virtual Reality Models erzeugt, die aus mit
3-D-Koordinaten gesteuerten Bitmaps bestehen.
Unter Berücksichtigung dieser Tatsachen kommt man
zu dem Schluss, dass 3-D-Daten, was Datenauthen-
tizität betrifft, ähnlichen Kriterien unterliegen, wie sie
für Digitalbilder angesetzt werden sollen. Im Archiv
muss lediglich dafür Sorge getragen werden, dass
das, was ursprünglich deponiert wurde, leserlich und
im Inhalt und Erscheinungsbild unverändert bleibt.
Resümee
Bei der Archivierung digitaler Daten gilt der Erhalt des
originalen Datenformats nicht wirklich als vorwiegen-
der Maßstab für Authentizität. Es geht darum, dass
die Inhalte, Erscheinungsbilder, Funktionalitäten und
Strukturen der deponierten Daten für den Nutzer er-
halten bleiben, und zwar in unterschiedlichen Maßen,
abhängig von der Art der Information, dem Erschei-
nungsbild, der Funktionalität etc., welche die Origi-
naldaten beinhalten. Verschiedene zu archivierende
archäologische Digitalunterlagen besitzen verschiede-
ne Charakteristika. Es gilt, möglichst all diese Charak-
teristika zu erhalten. Wenn allerdings Entscheidungen
getroffen werden müssen, ob bestimmte Charakteris-
tika (im Sinne von Form, Funktion, Erscheinungsbild,
Inhalt) während des (aktiven) Archivierungsprozesses
geopfert werden sollen, muss von vornherein klar
sein, welche möglicherweise geopfert werden können
und welche gar nicht. Zur Erinnerung: „Ein Dokument
kann als im Wesentlichen vollständig und unverfälscht
betrachtet werden, wenn die für dessen Zweckbe-
stimmung zu kommunizierende Botschaft unverän-
dert ist." (TNA, S. 9).
In der DIN 31645 (S. 12) findet man dazu: „Digitales
Langzeitarchiv und/oder Produzent müssen die signifi-
kanten Eigenschaften der zu übernehmenden Infor-
mationsobjekte definieren. Die Beteiligten entschei-
den, welche Darstellungsabweichungen eines Infor-
mationsobjekts in zukünftigen technischen Umge-
bungen noch akzeptabel sind und welche nicht. Ein
maßgebliches Kriterium sind die Bedürfnisse der
Nutzer des digitalen Langzeitarchivs (Zielgruppe)."
sowie „Das digitale Langzeitarchiv muss die für jedes
Informationsobjekt ausgewählten und eindeutig
benannten signifikanten Eigenschaften als Metadaten
verzeichnen. Diese Metadaten sind der Gradmesser
für die Beurteilung anstehender Erhaltungsmaßnah-
men (Konverterprogramme, Emulatoren) und zukünf-
tiger Nutzungsplattformen." In diesem Zusammen-
hang ist das InSPECT-Projekt erwähnenswert, wo an-
hand von Audiodateien, E-Mails, Rasterbildern und
strukturiertem Text einige signifikante Eigenschaften
fachneutral erarbeitet und untersucht wurden. Diese
Arbeit wird fortgesetzt und vor allem auf das Fach-
gebiet der Archäologie erweitert werden müssen!
Um Authentizität im beschriebenen Sinne zu gewähr-
leisten, sind recht umfangreiche Metadaten mit tech-
nischem, inhaltlichem und funktionellem Bezug erfor-
derlich, und zwar:
- Metadaten über den Zustand bei der Übernahme
ins Archiv und
- laufende Metadaten-Einträge über alle Prozesse,
die den Datensatz während des Aufenthalts im
Archiv verändern.
Diese Metadaten haben Protokollcharakter (und müs-
sen auch entsprechend abgesichert werden), damit
der Archivbestand vertrauenswürdig präsentiert wer-
den kann. In diesem Sinn versteht es sich fast von
selbst, dass die Originaldaten bei der Migration nicht
durch die neue Version ersetzt werden, sondern erhal-
ten bleiben.
Die Frage ist allerdings, wie umfassend dieser Ansatz
in der Praxis realisierbar sein wird. Es ist schwer vor-
stellbar, Inhalt und Funktionalität (oder gar Semantik)
migrierter Dokumente vollständig zu prüfen. So wird
man sich wohl oft mit einem bestimmten Grad an
Vertrauen begnügen müssen.
Die hier skizzierte Thematik ist zu komplex, als dass
sie in dieser Kürze abschließend behandelt werden
kann. Dies ist lediglich ein Denkanstoß, der dazu
dient, auf die Problematik der Definition(en) von Au-
thentizität bei digitalen Daten in der Archäologie auf-
merksam zu machen.
Eine Problematik, die bisher zu wenig Beachtung
gefunden hat, die aber dringend angegangen werden
muss, um die künftige Integrität, Zugänglichkeit,
Nutzbarkeit und nicht zuletzt das Überleben speziell
unserer digitalen archäologischen Daten, für die es
keine „Haltbarkeitsgrenze" gibt, zu gewährleisten.
Archäologie und Informationssysteme
Beispiel 7:
Die umfassende Eroberung der dritten Dimension
(3-D) ist eine noch junge, aber äußerst beliebte Errun-
genschaft der Archäologie. Während 3-D-Daten geo-
metrisch komplexe Wirklichkeiten abbilden, besitzen
sie keine oder nur wenig Funktionalität im Gegensatz
zu Datenbanken, CAD- oder GIS-Daten. Insofern ha-
ben sie bezüglich ihrer Archivierung mehr mit Bitmaps
oder Textdateien gemeinsam. Es ist sogar so, dass der
„niedrigste gemeinsame Nenner" für 3-D-Daten eine
Punktwolke im ASCII-Format mit den Spalten (x, y, z)
oder mit Farbinformation (x, y, z, r, g, b) ist. Eine sol-
che Punktwolkendatei kann zwar sehr groß werden,
sie bleibt jedoch einfach strukturiert. Bei Mesh-Daten
setzen sich einige wenige Formate durch, zum Bei-
spiel STL, PLY. Falls Fototextur vorhanden ist, werden
aktuell Virtual Reality Models erzeugt, die aus mit
3-D-Koordinaten gesteuerten Bitmaps bestehen.
Unter Berücksichtigung dieser Tatsachen kommt man
zu dem Schluss, dass 3-D-Daten, was Datenauthen-
tizität betrifft, ähnlichen Kriterien unterliegen, wie sie
für Digitalbilder angesetzt werden sollen. Im Archiv
muss lediglich dafür Sorge getragen werden, dass
das, was ursprünglich deponiert wurde, leserlich und
im Inhalt und Erscheinungsbild unverändert bleibt.
Resümee
Bei der Archivierung digitaler Daten gilt der Erhalt des
originalen Datenformats nicht wirklich als vorwiegen-
der Maßstab für Authentizität. Es geht darum, dass
die Inhalte, Erscheinungsbilder, Funktionalitäten und
Strukturen der deponierten Daten für den Nutzer er-
halten bleiben, und zwar in unterschiedlichen Maßen,
abhängig von der Art der Information, dem Erschei-
nungsbild, der Funktionalität etc., welche die Origi-
naldaten beinhalten. Verschiedene zu archivierende
archäologische Digitalunterlagen besitzen verschiede-
ne Charakteristika. Es gilt, möglichst all diese Charak-
teristika zu erhalten. Wenn allerdings Entscheidungen
getroffen werden müssen, ob bestimmte Charakteris-
tika (im Sinne von Form, Funktion, Erscheinungsbild,
Inhalt) während des (aktiven) Archivierungsprozesses
geopfert werden sollen, muss von vornherein klar
sein, welche möglicherweise geopfert werden können
und welche gar nicht. Zur Erinnerung: „Ein Dokument
kann als im Wesentlichen vollständig und unverfälscht
betrachtet werden, wenn die für dessen Zweckbe-
stimmung zu kommunizierende Botschaft unverän-
dert ist." (TNA, S. 9).
In der DIN 31645 (S. 12) findet man dazu: „Digitales
Langzeitarchiv und/oder Produzent müssen die signifi-
kanten Eigenschaften der zu übernehmenden Infor-
mationsobjekte definieren. Die Beteiligten entschei-
den, welche Darstellungsabweichungen eines Infor-
mationsobjekts in zukünftigen technischen Umge-
bungen noch akzeptabel sind und welche nicht. Ein
maßgebliches Kriterium sind die Bedürfnisse der
Nutzer des digitalen Langzeitarchivs (Zielgruppe)."
sowie „Das digitale Langzeitarchiv muss die für jedes
Informationsobjekt ausgewählten und eindeutig
benannten signifikanten Eigenschaften als Metadaten
verzeichnen. Diese Metadaten sind der Gradmesser
für die Beurteilung anstehender Erhaltungsmaßnah-
men (Konverterprogramme, Emulatoren) und zukünf-
tiger Nutzungsplattformen." In diesem Zusammen-
hang ist das InSPECT-Projekt erwähnenswert, wo an-
hand von Audiodateien, E-Mails, Rasterbildern und
strukturiertem Text einige signifikante Eigenschaften
fachneutral erarbeitet und untersucht wurden. Diese
Arbeit wird fortgesetzt und vor allem auf das Fach-
gebiet der Archäologie erweitert werden müssen!
Um Authentizität im beschriebenen Sinne zu gewähr-
leisten, sind recht umfangreiche Metadaten mit tech-
nischem, inhaltlichem und funktionellem Bezug erfor-
derlich, und zwar:
- Metadaten über den Zustand bei der Übernahme
ins Archiv und
- laufende Metadaten-Einträge über alle Prozesse,
die den Datensatz während des Aufenthalts im
Archiv verändern.
Diese Metadaten haben Protokollcharakter (und müs-
sen auch entsprechend abgesichert werden), damit
der Archivbestand vertrauenswürdig präsentiert wer-
den kann. In diesem Sinn versteht es sich fast von
selbst, dass die Originaldaten bei der Migration nicht
durch die neue Version ersetzt werden, sondern erhal-
ten bleiben.
Die Frage ist allerdings, wie umfassend dieser Ansatz
in der Praxis realisierbar sein wird. Es ist schwer vor-
stellbar, Inhalt und Funktionalität (oder gar Semantik)
migrierter Dokumente vollständig zu prüfen. So wird
man sich wohl oft mit einem bestimmten Grad an
Vertrauen begnügen müssen.
Die hier skizzierte Thematik ist zu komplex, als dass
sie in dieser Kürze abschließend behandelt werden
kann. Dies ist lediglich ein Denkanstoß, der dazu
dient, auf die Problematik der Definition(en) von Au-
thentizität bei digitalen Daten in der Archäologie auf-
merksam zu machen.
Eine Problematik, die bisher zu wenig Beachtung
gefunden hat, die aber dringend angegangen werden
muss, um die künftige Integrität, Zugänglichkeit,
Nutzbarkeit und nicht zuletzt das Überleben speziell
unserer digitalen archäologischen Daten, für die es
keine „Haltbarkeitsgrenze" gibt, zu gewährleisten.