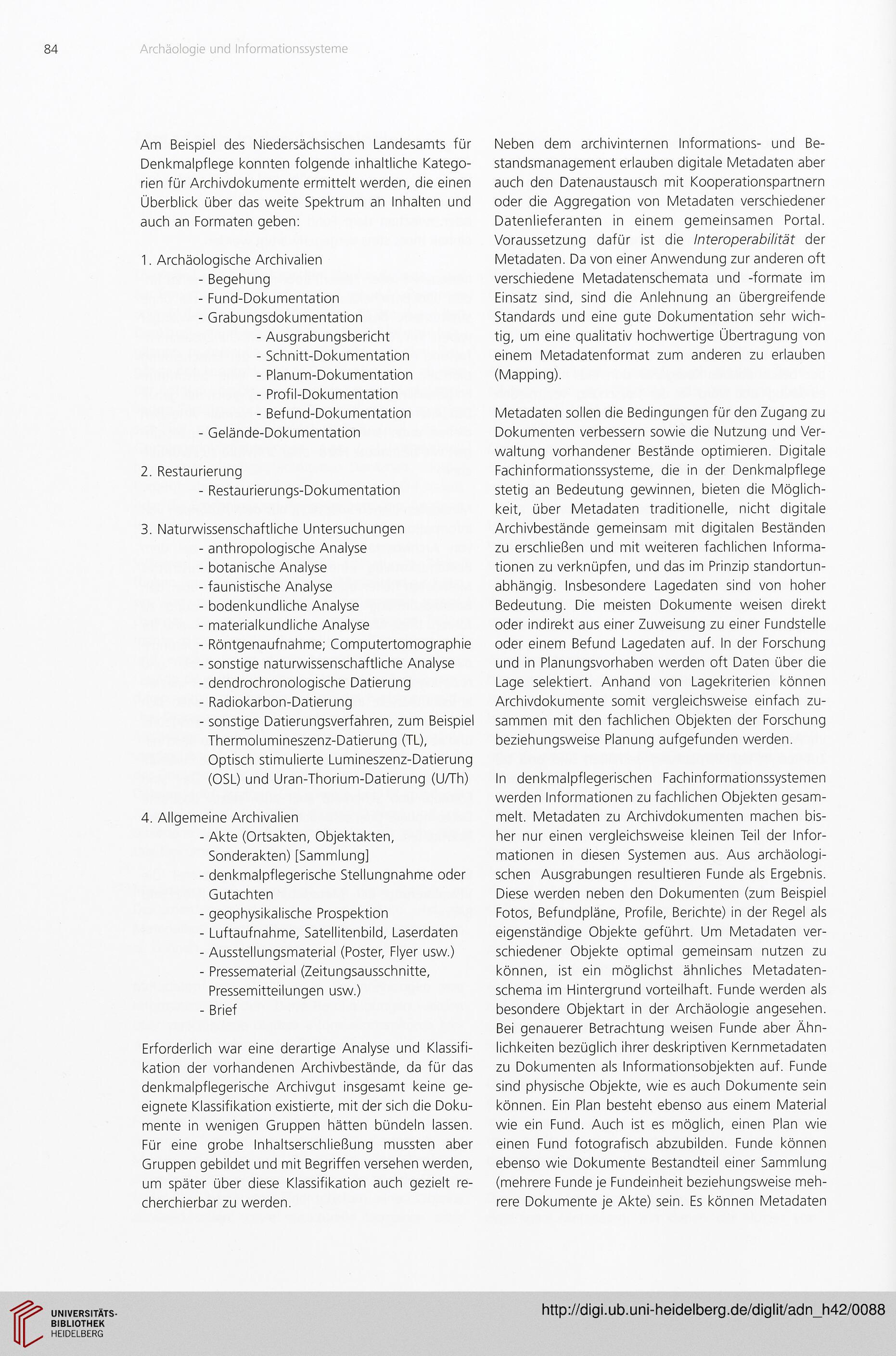84
Archäologie und Informationssysteme
Am Beispiel des Niedersächsischen Landesamts für
Denkmalpflege konnten folgende inhaltliche Katego-
rien für Archivdokumente ermittelt werden, die einen
Überblick über das weite Spektrum an Inhalten und
auch an Formaten geben:
1. Archäologische Archivalien
- Begehung
- Fund-Dokumentation
- Grabungsdokumentation
- Ausgrabungsbericht
- Schnitt-Dokumentation
- Planum-Dokumentation
- Profil-Dokumentation
- Befund-Dokumentation
- Gelände-Dokumentation
2. Restaurierung
- Restaurierungs-Dokumentation
3. Naturwissenschaftliche Untersuchungen
- anthropologische Analyse
- botanische Analyse
- faunistische Analyse
- bodenkundliche Analyse
- materialkundliche Analyse
- Röntgenaufnahme; Computertomographie
- sonstige naturwissenschaftliche Analyse
- dendrochronologische Datierung
- Radiokarbon-Datierung
- sonstige Datierungsverfahren, zum Beispiel
Thermolumineszenz-Datierung (TL),
Optisch stimulierte Lumineszenz-Datierung
(OSL) und Uran-Thorium-Datierung (U/Th)
4. Allgemeine Archivalien
- Akte (Ortsakten, Objektakten,
Sonderakten) [Sammlung]
- denkmalpflegerische Stellungnahme oder
Gutachten
- geophysikalische Prospektion
- Luftaufnahme, Satellitenbild, Laserdaten
- Ausstellungsmaterial (Poster, Flyer usw.)
- Pressematerial (Zeitungsausschnitte,
Pressemitteilungen usw.)
- Brief
Erforderlich war eine derartige Analyse und Klassifi-
kation der vorhandenen Archivbestände, da für das
denkmalpflegerische Archivgut insgesamt keine ge-
eignete Klassifikation existierte, mit der sich die Doku-
mente in wenigen Gruppen hätten bündeln lassen.
Für eine grobe Inhaltserschließung mussten aber
Gruppen gebildet und mit Begriffen versehen werden,
um später über diese Klassifikation auch gezielt re-
cherchierbar zu werden.
Neben dem archivinternen Informations- und Be-
standsmanagement erlauben digitale Metadaten aber
auch den Datenaustausch mit Kooperationspartnern
oder die Aggregation von Metadaten verschiedener
Datenlieferanten in einem gemeinsamen Portal.
Voraussetzung dafür ist die Interoperabilität der
Metadaten. Da von einer Anwendung zur anderen oft
verschiedene Metadatenschemata und -formate im
Einsatz sind, sind die Anlehnung an übergreifende
Standards und eine gute Dokumentation sehr wich-
tig, um eine qualitativ hochwertige Übertragung von
einem Metadatenformat zum anderen zu erlauben
(Mapping).
Metadaten sollen die Bedingungen für den Zugang zu
Dokumenten verbessern sowie die Nutzung und Ver-
waltung vorhandener Bestände optimieren. Digitale
Fachinformationssysteme, die in der Denkmalpflege
stetig an Bedeutung gewinnen, bieten die Möglich-
keit, über Metadaten traditionelle, nicht digitale
Archivbestände gemeinsam mit digitalen Beständen
zu erschließen und mit weiteren fachlichen Informa-
tionen zu verknüpfen, und das im Prinzip standortun-
abhängig. Insbesondere Lagedaten sind von hoher
Bedeutung. Die meisten Dokumente weisen direkt
oder indirekt aus einer Zuweisung zu einer Fundstelle
oder einem Befund Lagedaten auf. In der Forschung
und in Planungsvorhaben werden oft Daten über die
Lage selektiert. Anhand von Lagekriterien können
Archivdokumente somit vergleichsweise einfach zu-
sammen mit den fachlichen Objekten der Forschung
beziehungsweise Planung aufgefunden werden.
In denkmalpflegerischen Fachinformationssystemen
werden Informationen zu fachlichen Objekten gesam-
melt. Metadaten zu Archivdokumenten machen bis-
her nur einen vergleichsweise kleinen Teil der Infor-
mationen in diesen Systemen aus. Aus archäologi-
schen Ausgrabungen resultieren Funde als Ergebnis.
Diese werden neben den Dokumenten (zum Beispiel
Fotos, Befundpläne, Profile, Berichte) in der Regel als
eigenständige Objekte geführt. Um Metadaten ver-
schiedener Objekte optimal gemeinsam nutzen zu
können, ist ein möglichst ähnliches Metadaten-
schema im Hintergrund vorteilhaft. Funde werden als
besondere Objektart in der Archäologie angesehen.
Bei genauerer Betrachtung weisen Funde aber Ähn-
lichkeiten bezüglich ihrer deskriptiven Kernmetadaten
zu Dokumenten als Informationsobjekten auf. Funde
sind physische Objekte, wie es auch Dokumente sein
können. Ein Plan besteht ebenso aus einem Material
wie ein Fund. Auch ist es möglich, einen Plan wie
einen Fund fotografisch abzubilden. Funde können
ebenso wie Dokumente Bestandteil einer Sammlung
(mehrere Funde je Fundeinheit beziehungsweise meh-
rere Dokumente je Akte) sein. Es können Metadaten
Archäologie und Informationssysteme
Am Beispiel des Niedersächsischen Landesamts für
Denkmalpflege konnten folgende inhaltliche Katego-
rien für Archivdokumente ermittelt werden, die einen
Überblick über das weite Spektrum an Inhalten und
auch an Formaten geben:
1. Archäologische Archivalien
- Begehung
- Fund-Dokumentation
- Grabungsdokumentation
- Ausgrabungsbericht
- Schnitt-Dokumentation
- Planum-Dokumentation
- Profil-Dokumentation
- Befund-Dokumentation
- Gelände-Dokumentation
2. Restaurierung
- Restaurierungs-Dokumentation
3. Naturwissenschaftliche Untersuchungen
- anthropologische Analyse
- botanische Analyse
- faunistische Analyse
- bodenkundliche Analyse
- materialkundliche Analyse
- Röntgenaufnahme; Computertomographie
- sonstige naturwissenschaftliche Analyse
- dendrochronologische Datierung
- Radiokarbon-Datierung
- sonstige Datierungsverfahren, zum Beispiel
Thermolumineszenz-Datierung (TL),
Optisch stimulierte Lumineszenz-Datierung
(OSL) und Uran-Thorium-Datierung (U/Th)
4. Allgemeine Archivalien
- Akte (Ortsakten, Objektakten,
Sonderakten) [Sammlung]
- denkmalpflegerische Stellungnahme oder
Gutachten
- geophysikalische Prospektion
- Luftaufnahme, Satellitenbild, Laserdaten
- Ausstellungsmaterial (Poster, Flyer usw.)
- Pressematerial (Zeitungsausschnitte,
Pressemitteilungen usw.)
- Brief
Erforderlich war eine derartige Analyse und Klassifi-
kation der vorhandenen Archivbestände, da für das
denkmalpflegerische Archivgut insgesamt keine ge-
eignete Klassifikation existierte, mit der sich die Doku-
mente in wenigen Gruppen hätten bündeln lassen.
Für eine grobe Inhaltserschließung mussten aber
Gruppen gebildet und mit Begriffen versehen werden,
um später über diese Klassifikation auch gezielt re-
cherchierbar zu werden.
Neben dem archivinternen Informations- und Be-
standsmanagement erlauben digitale Metadaten aber
auch den Datenaustausch mit Kooperationspartnern
oder die Aggregation von Metadaten verschiedener
Datenlieferanten in einem gemeinsamen Portal.
Voraussetzung dafür ist die Interoperabilität der
Metadaten. Da von einer Anwendung zur anderen oft
verschiedene Metadatenschemata und -formate im
Einsatz sind, sind die Anlehnung an übergreifende
Standards und eine gute Dokumentation sehr wich-
tig, um eine qualitativ hochwertige Übertragung von
einem Metadatenformat zum anderen zu erlauben
(Mapping).
Metadaten sollen die Bedingungen für den Zugang zu
Dokumenten verbessern sowie die Nutzung und Ver-
waltung vorhandener Bestände optimieren. Digitale
Fachinformationssysteme, die in der Denkmalpflege
stetig an Bedeutung gewinnen, bieten die Möglich-
keit, über Metadaten traditionelle, nicht digitale
Archivbestände gemeinsam mit digitalen Beständen
zu erschließen und mit weiteren fachlichen Informa-
tionen zu verknüpfen, und das im Prinzip standortun-
abhängig. Insbesondere Lagedaten sind von hoher
Bedeutung. Die meisten Dokumente weisen direkt
oder indirekt aus einer Zuweisung zu einer Fundstelle
oder einem Befund Lagedaten auf. In der Forschung
und in Planungsvorhaben werden oft Daten über die
Lage selektiert. Anhand von Lagekriterien können
Archivdokumente somit vergleichsweise einfach zu-
sammen mit den fachlichen Objekten der Forschung
beziehungsweise Planung aufgefunden werden.
In denkmalpflegerischen Fachinformationssystemen
werden Informationen zu fachlichen Objekten gesam-
melt. Metadaten zu Archivdokumenten machen bis-
her nur einen vergleichsweise kleinen Teil der Infor-
mationen in diesen Systemen aus. Aus archäologi-
schen Ausgrabungen resultieren Funde als Ergebnis.
Diese werden neben den Dokumenten (zum Beispiel
Fotos, Befundpläne, Profile, Berichte) in der Regel als
eigenständige Objekte geführt. Um Metadaten ver-
schiedener Objekte optimal gemeinsam nutzen zu
können, ist ein möglichst ähnliches Metadaten-
schema im Hintergrund vorteilhaft. Funde werden als
besondere Objektart in der Archäologie angesehen.
Bei genauerer Betrachtung weisen Funde aber Ähn-
lichkeiten bezüglich ihrer deskriptiven Kernmetadaten
zu Dokumenten als Informationsobjekten auf. Funde
sind physische Objekte, wie es auch Dokumente sein
können. Ein Plan besteht ebenso aus einem Material
wie ein Fund. Auch ist es möglich, einen Plan wie
einen Fund fotografisch abzubilden. Funde können
ebenso wie Dokumente Bestandteil einer Sammlung
(mehrere Funde je Fundeinheit beziehungsweise meh-
rere Dokumente je Akte) sein. Es können Metadaten