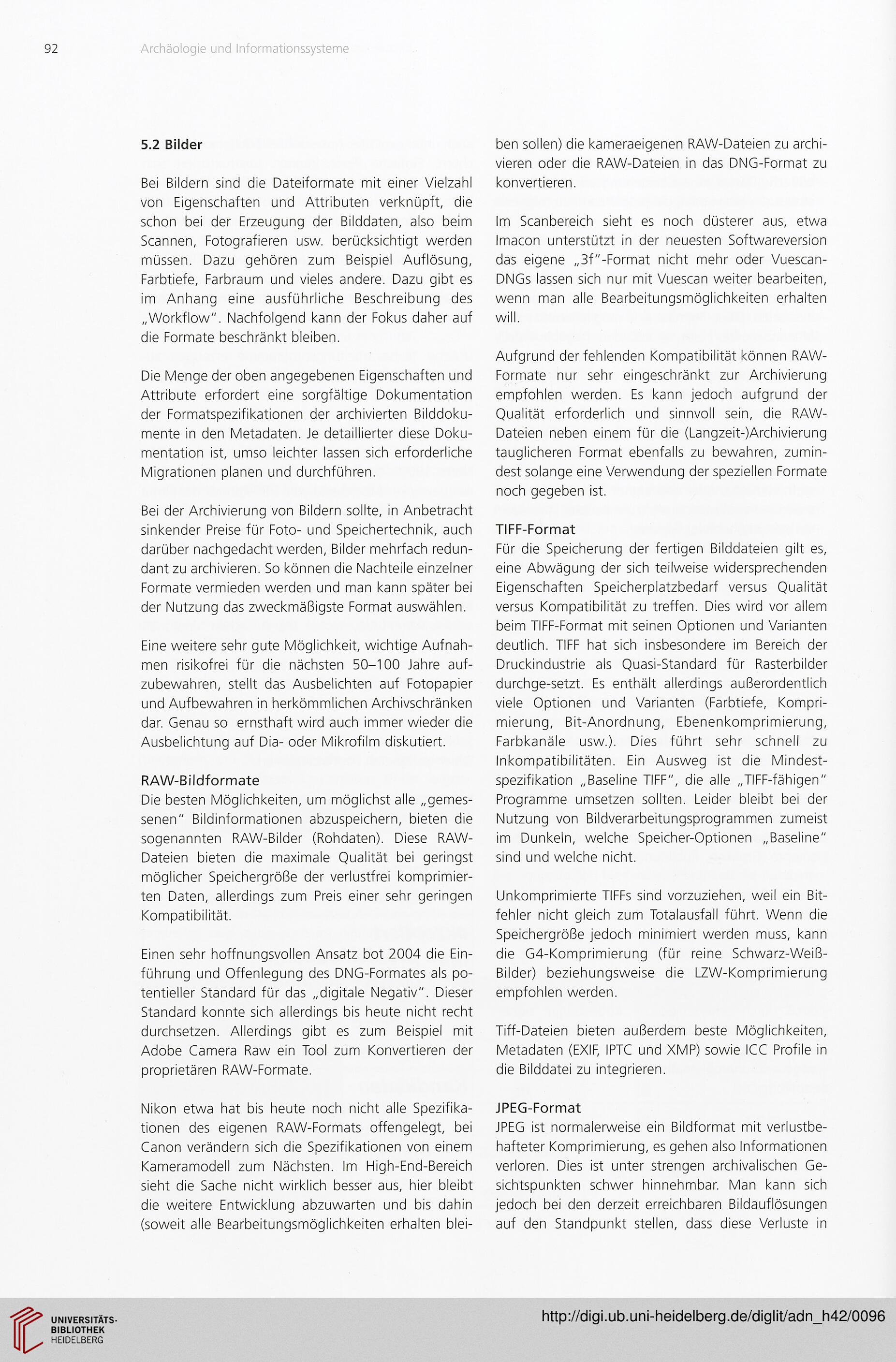92
Archäologie und Informationssysteme
5.2 Bilder
Bei Bildern sind die Dateiformate mit einer Vielzahl
von Eigenschaften und Attributen verknüpft, die
schon bei der Erzeugung der Bilddaten, also beim
Scannen, Fotografieren usw. berücksichtigt werden
müssen. Dazu gehören zum Beispiel Auflösung,
Farbtiefe, Farbraum und vieles andere. Dazu gibt es
im Anhang eine ausführliche Beschreibung des
„Workflow". Nachfolgend kann der Fokus daher auf
die Formate beschränkt bleiben.
Die Menge der oben angegebenen Eigenschaften und
Attribute erfordert eine sorgfältige Dokumentation
der Formatspezifikationen der archivierten Bilddoku-
mente in den Metadaten. Je detaillierter diese Doku-
mentation ist, umso leichter lassen sich erforderliche
Migrationen planen und durchführen.
Bei der Archivierung von Bildern sollte, in Anbetracht
sinkender Preise für Foto- und Speichertechnik, auch
darüber nachgedacht werden, Bilder mehrfach redun-
dant zu archivieren. So können die Nachteile einzelner
Formate vermieden werden und man kann später bei
der Nutzung das zweckmäßigste Format auswählen.
Eine weitere sehr gute Möglichkeit, wichtige Aufnah-
men risikofrei für die nächsten 50-100 Jahre auf-
zubewahren, stellt das Ausbelichten auf Fotopapier
und Aufbewahren in herkömmlichen Archivschränken
dar. Genau so ernsthaft wird auch immer wieder die
Ausbelichtung auf Dia- oder Mikrofilm diskutiert.
RAW-Bildformate
Die besten Möglichkeiten, um möglichst alle „gemes-
senen" Bildinformationen abzuspeichern, bieten die
sogenannten RAW-Bilder (Rohdaten). Diese RAW-
Dateien bieten die maximale Qualität bei geringst
möglicher Speichergröße der verlustfrei komprimier-
ten Daten, allerdings zum Preis einer sehr geringen
Kompatibilität.
Einen sehr hoffnungsvollen Ansatz bot 2004 die Ein-
führung und Offenlegung des DNG-Formates als po-
tentieller Standard für das „digitale Negativ". Dieser
Standard konnte sich allerdings bis heute nicht recht
durchsetzen. Allerdings gibt es zum Beispiel mit
Adobe Camera Raw ein Tool zum Konvertieren der
proprietären RAW-Formate.
Nikon etwa hat bis heute noch nicht alle Spezifika-
tionen des eigenen RAW-Formats offengelegt, bei
Canon verändern sich die Spezifikationen von einem
Kameramodell zum Nächsten. Im High-End-Bereich
sieht die Sache nicht wirklich besser aus, hier bleibt
die weitere Entwicklung abzuwarten und bis dahin
(soweit alle Bearbeitungsmöglichkeiten erhalten blei-
ben sollen) die kameraeigenen RAW-Dateien zu archi-
vieren oder die RAW-Dateien in das DNG-Format zu
konvertieren.
Im Scanbereich sieht es noch düsterer aus, etwa
Imacon unterstützt in der neuesten Softwareversion
das eigene „3f"-Format nicht mehr oder Vuescan-
DNGs lassen sich nur mit Vuescan weiter bearbeiten,
wenn man alle Bearbeitungsmöglichkeiten erhalten
will.
Aufgrund der fehlenden Kompatibilität können RAW-
Formate nur sehr eingeschränkt zur Archivierung
empfohlen werden. Es kann jedoch aufgrund der
Qualität erforderlich und sinnvoll sein, die RAW-
Dateien neben einem für die (Langzeit-)Archivierung
tauglicheren Format ebenfalls zu bewahren, zumin-
dest solange eine Verwendung der speziellen Formate
noch gegeben ist.
TIFF-Format
Für die Speicherung der fertigen Bilddateien gilt es,
eine Abwägung der sich teilweise widersprechenden
Eigenschaften Speicherplatzbedarf versus Qualität
versus Kompatibilität zu treffen. Dies wird vor allem
beim TIFF-Format mit seinen Optionen und Varianten
deutlich. TIFF hat sich insbesondere im Bereich der
Druckindustrie als Quasi-Standard für Rasterbilder
durchge-setzt. Es enthält allerdings außerordentlich
viele Optionen und Varianten (Farbtiefe, Kompri-
mierung, Bit-Anordnung, Ebenenkomprimierung,
Farbkanäle usw.). Dies führt sehr schnell zu
Inkompatibilitäten. Ein Ausweg ist die Mindest-
spezifikation „Baseline TIFF", die alle „TIFF-fähigen"
Programme umsetzen sollten. Leider bleibt bei der
Nutzung von Bildverarbeitungsprogrammen zumeist
im Dunkeln, welche Speicher-Optionen „Baseline"
sind und welche nicht.
Unkomprimierte TIFFs sind vorzuziehen, weil ein Bit-
fehler nicht gleich zum Totalausfall führt. Wenn die
Speichergröße jedoch minimiert werden muss, kann
die G4-Komprimierung (für reine Schwarz-Weiß-
Bilder) beziehungsweise die LZW-Komprimierung
empfohlen werden.
Tiff-Dateien bieten außerdem beste Möglichkeiten,
Metadaten (EXIF, IPTC und XMP) sowie ICC Profile in
die Bilddatei zu integrieren.
JPEG-Format
JPEG ist normalerweise ein Bildformat mit verlustbe-
hafteter Komprimierung, es gehen also Informationen
verloren. Dies ist unter strengen archivalischen Ge-
sichtspunkten schwer hinnehmbar. Man kann sich
jedoch bei den derzeit erreichbaren Bildauflösungen
auf den Standpunkt stellen, dass diese Verluste in
Archäologie und Informationssysteme
5.2 Bilder
Bei Bildern sind die Dateiformate mit einer Vielzahl
von Eigenschaften und Attributen verknüpft, die
schon bei der Erzeugung der Bilddaten, also beim
Scannen, Fotografieren usw. berücksichtigt werden
müssen. Dazu gehören zum Beispiel Auflösung,
Farbtiefe, Farbraum und vieles andere. Dazu gibt es
im Anhang eine ausführliche Beschreibung des
„Workflow". Nachfolgend kann der Fokus daher auf
die Formate beschränkt bleiben.
Die Menge der oben angegebenen Eigenschaften und
Attribute erfordert eine sorgfältige Dokumentation
der Formatspezifikationen der archivierten Bilddoku-
mente in den Metadaten. Je detaillierter diese Doku-
mentation ist, umso leichter lassen sich erforderliche
Migrationen planen und durchführen.
Bei der Archivierung von Bildern sollte, in Anbetracht
sinkender Preise für Foto- und Speichertechnik, auch
darüber nachgedacht werden, Bilder mehrfach redun-
dant zu archivieren. So können die Nachteile einzelner
Formate vermieden werden und man kann später bei
der Nutzung das zweckmäßigste Format auswählen.
Eine weitere sehr gute Möglichkeit, wichtige Aufnah-
men risikofrei für die nächsten 50-100 Jahre auf-
zubewahren, stellt das Ausbelichten auf Fotopapier
und Aufbewahren in herkömmlichen Archivschränken
dar. Genau so ernsthaft wird auch immer wieder die
Ausbelichtung auf Dia- oder Mikrofilm diskutiert.
RAW-Bildformate
Die besten Möglichkeiten, um möglichst alle „gemes-
senen" Bildinformationen abzuspeichern, bieten die
sogenannten RAW-Bilder (Rohdaten). Diese RAW-
Dateien bieten die maximale Qualität bei geringst
möglicher Speichergröße der verlustfrei komprimier-
ten Daten, allerdings zum Preis einer sehr geringen
Kompatibilität.
Einen sehr hoffnungsvollen Ansatz bot 2004 die Ein-
führung und Offenlegung des DNG-Formates als po-
tentieller Standard für das „digitale Negativ". Dieser
Standard konnte sich allerdings bis heute nicht recht
durchsetzen. Allerdings gibt es zum Beispiel mit
Adobe Camera Raw ein Tool zum Konvertieren der
proprietären RAW-Formate.
Nikon etwa hat bis heute noch nicht alle Spezifika-
tionen des eigenen RAW-Formats offengelegt, bei
Canon verändern sich die Spezifikationen von einem
Kameramodell zum Nächsten. Im High-End-Bereich
sieht die Sache nicht wirklich besser aus, hier bleibt
die weitere Entwicklung abzuwarten und bis dahin
(soweit alle Bearbeitungsmöglichkeiten erhalten blei-
ben sollen) die kameraeigenen RAW-Dateien zu archi-
vieren oder die RAW-Dateien in das DNG-Format zu
konvertieren.
Im Scanbereich sieht es noch düsterer aus, etwa
Imacon unterstützt in der neuesten Softwareversion
das eigene „3f"-Format nicht mehr oder Vuescan-
DNGs lassen sich nur mit Vuescan weiter bearbeiten,
wenn man alle Bearbeitungsmöglichkeiten erhalten
will.
Aufgrund der fehlenden Kompatibilität können RAW-
Formate nur sehr eingeschränkt zur Archivierung
empfohlen werden. Es kann jedoch aufgrund der
Qualität erforderlich und sinnvoll sein, die RAW-
Dateien neben einem für die (Langzeit-)Archivierung
tauglicheren Format ebenfalls zu bewahren, zumin-
dest solange eine Verwendung der speziellen Formate
noch gegeben ist.
TIFF-Format
Für die Speicherung der fertigen Bilddateien gilt es,
eine Abwägung der sich teilweise widersprechenden
Eigenschaften Speicherplatzbedarf versus Qualität
versus Kompatibilität zu treffen. Dies wird vor allem
beim TIFF-Format mit seinen Optionen und Varianten
deutlich. TIFF hat sich insbesondere im Bereich der
Druckindustrie als Quasi-Standard für Rasterbilder
durchge-setzt. Es enthält allerdings außerordentlich
viele Optionen und Varianten (Farbtiefe, Kompri-
mierung, Bit-Anordnung, Ebenenkomprimierung,
Farbkanäle usw.). Dies führt sehr schnell zu
Inkompatibilitäten. Ein Ausweg ist die Mindest-
spezifikation „Baseline TIFF", die alle „TIFF-fähigen"
Programme umsetzen sollten. Leider bleibt bei der
Nutzung von Bildverarbeitungsprogrammen zumeist
im Dunkeln, welche Speicher-Optionen „Baseline"
sind und welche nicht.
Unkomprimierte TIFFs sind vorzuziehen, weil ein Bit-
fehler nicht gleich zum Totalausfall führt. Wenn die
Speichergröße jedoch minimiert werden muss, kann
die G4-Komprimierung (für reine Schwarz-Weiß-
Bilder) beziehungsweise die LZW-Komprimierung
empfohlen werden.
Tiff-Dateien bieten außerdem beste Möglichkeiten,
Metadaten (EXIF, IPTC und XMP) sowie ICC Profile in
die Bilddatei zu integrieren.
JPEG-Format
JPEG ist normalerweise ein Bildformat mit verlustbe-
hafteter Komprimierung, es gehen also Informationen
verloren. Dies ist unter strengen archivalischen Ge-
sichtspunkten schwer hinnehmbar. Man kann sich
jedoch bei den derzeit erreichbaren Bildauflösungen
auf den Standpunkt stellen, dass diese Verluste in