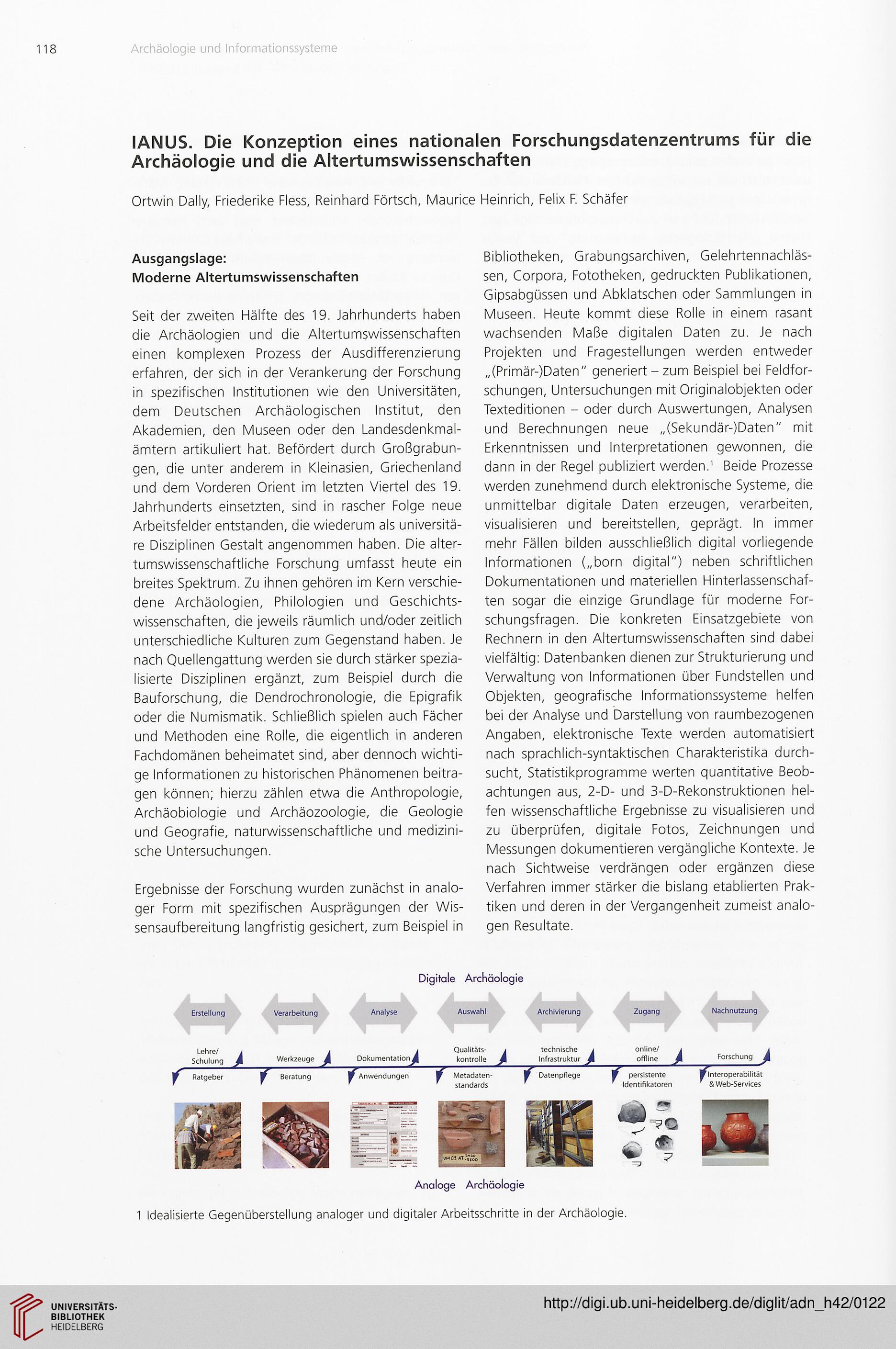118
Archäologie und Informationssysteme
IANUS. Die Konzeption eines nationalen Forschungsdatenzentrums für die
Archäologie und die Altertumswissenschaften
Ortwin Daily, Friederike Fless, Reinhard Förtsch, Maurice Heinrich, Felix F. Schäfer
Ausgangslage:
Moderne Altertumswissenschaften
Seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts haben
die Archäologien und die Altertumswissenschaften
einen komplexen Prozess der Ausdifferenzierung
erfahren, der sich in der Verankerung der Forschung
in spezifischen Institutionen wie den Universitäten,
dem Deutschen Archäologischen Institut, den
Akademien, den Museen oder den Landesdenkmal-
ämtern artikuliert hat. Befördert durch Großgrabun-
gen, die unter anderem in Kleinasien, Griechenland
und dem Vorderen Orient im letzten Viertel des 19.
Jahrhunderts einsetzten, sind in rascher Folge neue
Arbeitsfelder entstanden, die wiederum als universitä-
re Disziplinen Gestalt angenommen haben. Die alter-
tumswissenschaftliche Forschung umfasst heute ein
breites Spektrum. Zu ihnen gehören im Kern verschie-
dene Archäologien, Philologien und Geschichts-
wissenschaften, die jeweils räumlich und/oder zeitlich
unterschiedliche Kulturen zum Gegenstand haben. Je
nach Quellengattung werden sie durch stärker spezia-
lisierte Disziplinen ergänzt, zum Beispiel durch die
Bauforschung, die Dendrochronologie, die Epigrafik
oder die Numismatik. Schließlich spielen auch Fächer
und Methoden eine Rolle, die eigentlich in anderen
Fachdomänen beheimatet sind, aber dennoch wichti-
ge Informationen zu historischen Phänomenen beitra-
gen können; hierzu zählen etwa die Anthropologie,
Archäobiologie und Archäozoologie, die Geologie
und Geografie, naturwissenschaftliche und medizini-
sche Untersuchungen.
Ergebnisse der Forschung wurden zunächst in analo-
ger Form mit spezifischen Ausprägungen der Wis-
sensaufbereitung langfristig gesichert, zum Beispiel in
Bibliotheken, Grabungsarchiven, Gelehrtennachläs-
sen, Corpora, Fototheken, gedruckten Publikationen,
Gipsabgüssen und Abklatschen oder Sammlungen in
Museen. Heute kommt diese Rolle in einem rasant
wachsenden Maße digitalen Daten zu. Je nach
Projekten und Fragestellungen werden entweder
„(Primär-)Daten" generiert - zum Beispiel bei Feldfor-
schungen, Untersuchungen mit Originalobjekten oder
Texteditionen - oder durch Auswertungen, Analysen
und Berechnungen neue „(Sekundär-)Daten" mit
Erkenntnissen und Interpretationen gewonnen, die
dann in der Regel publiziert werden.1 Beide Prozesse
werden zunehmend durch elektronische Systeme, die
unmittelbar digitale Daten erzeugen, verarbeiten,
visualisieren und bereitstellen, geprägt. In immer
mehr Fällen bilden ausschließlich digital vorliegende
Informationen („born digital") neben schriftlichen
Dokumentationen und materiellen Hinterlassenschaf-
ten sogar die einzige Grundlage für moderne For-
schungsfragen. Die konkreten Einsatzgebiete von
Rechnern in den Altertumswissenschaften sind dabei
vielfältig: Datenbanken dienen zur Strukturierung und
Verwaltung von Informationen über Fundstellen und
Objekten, geografische Informationssysteme helfen
bei der Analyse und Darstellung von raumbezogenen
Angaben, elektronische Texte werden automatisiert
nach sprachlich-syntaktischen Charakteristika durch-
sucht, Statistikprogramme werten quantitative Beob-
achtungen aus, 2-D- und 3-D-Rekonstruktionen hel-
fen wissenschaftliche Ergebnisse zu visualisieren und
zu überprüfen, digitale Fotos, Zeichnungen und
Messungen dokumentieren vergängliche Kontexte. Je
nach Sichtweise verdrängen oder ergänzen diese
Verfahren immer stärker die bislang etablierten Prak-
tiken und deren in der Vergangenheit zumeist analo-
gen Resultate.
Digitale Archäologie
Erstellung Verarbeitung Analyse
Auswahl Archivierung Zugang Nachnutzung
Lehre/
Schulung
Ratgeber
Beratung
Dokumentation^!
Qualitäts- i
Kontrolle A
technische i
Infrastruktur
online/ i
offline A
Forschung t
Anwendungen
W Metadaten-
' Standards
Datenpflege
Jr persistente
' Identifikatoren
r Interoperabilität
& Web-Services
Analoge Archäologie
1 Idealisierte Gegenüberstellung analoger und digitaler Arbeitsschritte in der Archäologie.
Archäologie und Informationssysteme
IANUS. Die Konzeption eines nationalen Forschungsdatenzentrums für die
Archäologie und die Altertumswissenschaften
Ortwin Daily, Friederike Fless, Reinhard Förtsch, Maurice Heinrich, Felix F. Schäfer
Ausgangslage:
Moderne Altertumswissenschaften
Seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts haben
die Archäologien und die Altertumswissenschaften
einen komplexen Prozess der Ausdifferenzierung
erfahren, der sich in der Verankerung der Forschung
in spezifischen Institutionen wie den Universitäten,
dem Deutschen Archäologischen Institut, den
Akademien, den Museen oder den Landesdenkmal-
ämtern artikuliert hat. Befördert durch Großgrabun-
gen, die unter anderem in Kleinasien, Griechenland
und dem Vorderen Orient im letzten Viertel des 19.
Jahrhunderts einsetzten, sind in rascher Folge neue
Arbeitsfelder entstanden, die wiederum als universitä-
re Disziplinen Gestalt angenommen haben. Die alter-
tumswissenschaftliche Forschung umfasst heute ein
breites Spektrum. Zu ihnen gehören im Kern verschie-
dene Archäologien, Philologien und Geschichts-
wissenschaften, die jeweils räumlich und/oder zeitlich
unterschiedliche Kulturen zum Gegenstand haben. Je
nach Quellengattung werden sie durch stärker spezia-
lisierte Disziplinen ergänzt, zum Beispiel durch die
Bauforschung, die Dendrochronologie, die Epigrafik
oder die Numismatik. Schließlich spielen auch Fächer
und Methoden eine Rolle, die eigentlich in anderen
Fachdomänen beheimatet sind, aber dennoch wichti-
ge Informationen zu historischen Phänomenen beitra-
gen können; hierzu zählen etwa die Anthropologie,
Archäobiologie und Archäozoologie, die Geologie
und Geografie, naturwissenschaftliche und medizini-
sche Untersuchungen.
Ergebnisse der Forschung wurden zunächst in analo-
ger Form mit spezifischen Ausprägungen der Wis-
sensaufbereitung langfristig gesichert, zum Beispiel in
Bibliotheken, Grabungsarchiven, Gelehrtennachläs-
sen, Corpora, Fototheken, gedruckten Publikationen,
Gipsabgüssen und Abklatschen oder Sammlungen in
Museen. Heute kommt diese Rolle in einem rasant
wachsenden Maße digitalen Daten zu. Je nach
Projekten und Fragestellungen werden entweder
„(Primär-)Daten" generiert - zum Beispiel bei Feldfor-
schungen, Untersuchungen mit Originalobjekten oder
Texteditionen - oder durch Auswertungen, Analysen
und Berechnungen neue „(Sekundär-)Daten" mit
Erkenntnissen und Interpretationen gewonnen, die
dann in der Regel publiziert werden.1 Beide Prozesse
werden zunehmend durch elektronische Systeme, die
unmittelbar digitale Daten erzeugen, verarbeiten,
visualisieren und bereitstellen, geprägt. In immer
mehr Fällen bilden ausschließlich digital vorliegende
Informationen („born digital") neben schriftlichen
Dokumentationen und materiellen Hinterlassenschaf-
ten sogar die einzige Grundlage für moderne For-
schungsfragen. Die konkreten Einsatzgebiete von
Rechnern in den Altertumswissenschaften sind dabei
vielfältig: Datenbanken dienen zur Strukturierung und
Verwaltung von Informationen über Fundstellen und
Objekten, geografische Informationssysteme helfen
bei der Analyse und Darstellung von raumbezogenen
Angaben, elektronische Texte werden automatisiert
nach sprachlich-syntaktischen Charakteristika durch-
sucht, Statistikprogramme werten quantitative Beob-
achtungen aus, 2-D- und 3-D-Rekonstruktionen hel-
fen wissenschaftliche Ergebnisse zu visualisieren und
zu überprüfen, digitale Fotos, Zeichnungen und
Messungen dokumentieren vergängliche Kontexte. Je
nach Sichtweise verdrängen oder ergänzen diese
Verfahren immer stärker die bislang etablierten Prak-
tiken und deren in der Vergangenheit zumeist analo-
gen Resultate.
Digitale Archäologie
Erstellung Verarbeitung Analyse
Auswahl Archivierung Zugang Nachnutzung
Lehre/
Schulung
Ratgeber
Beratung
Dokumentation^!
Qualitäts- i
Kontrolle A
technische i
Infrastruktur
online/ i
offline A
Forschung t
Anwendungen
W Metadaten-
' Standards
Datenpflege
Jr persistente
' Identifikatoren
r Interoperabilität
& Web-Services
Analoge Archäologie
1 Idealisierte Gegenüberstellung analoger und digitaler Arbeitsschritte in der Archäologie.