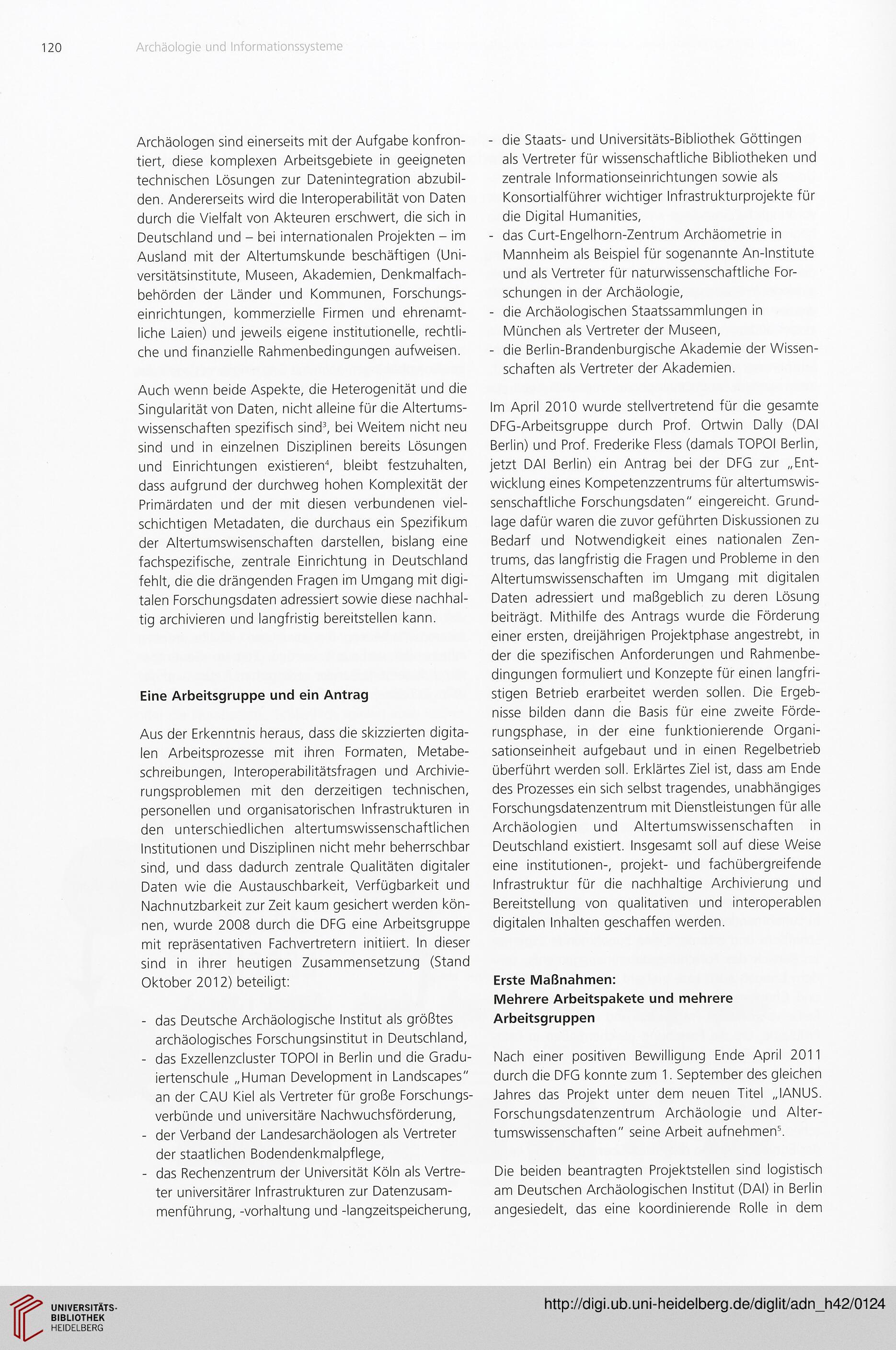120
Archäologie und Informationssysteme
Archäologen sind einerseits mit der Aufgabe konfron-
tiert, diese komplexen Arbeitsgebiete in geeigneten
technischen Lösungen zur Datenintegration abzubil-
den. Andererseits wird die Interoperabilität von Daten
durch die Vielfalt von Akteuren erschwert, die sich in
Deutschland und - bei internationalen Projekten - im
Ausland mit der Altertumskunde beschäftigen (Uni-
versitätsinstitute, Museen, Akademien, Denkmalfach-
behörden der Länder und Kommunen, Forschungs-
einrichtungen, kommerzielle Firmen und ehrenamt-
liche Laien) und jeweils eigene institutionelle, rechtli-
che und finanzielle Rahmenbedingungen aufweisen.
Auch wenn beide Aspekte, die Heterogenität und die
Singularität von Daten, nicht alleine für die Altertums-
wissenschaften spezifisch sind3, bei Weitem nicht neu
sind und in einzelnen Disziplinen bereits Lösungen
und Einrichtungen existieren4, bleibt festzuhalten,
dass aufgrund der durchweg hohen Komplexität der
Primärdaten und der mit diesen verbundenen viel-
schichtigen Metadaten, die durchaus ein Spezifikum
der Altertumswisenschaften darstellen, bislang eine
fachspezifische, zentrale Einrichtung in Deutschland
fehlt, die die drängenden Fragen im Umgang mit digi-
talen Forschungsdaten adressiert sowie diese nachhal-
tig archivieren und langfristig bereitstellen kann.
Eine Arbeitsgruppe und ein Antrag
Aus der Erkenntnis heraus, dass die skizzierten digita-
len Arbeitsprozesse mit ihren Formaten, Metabe-
schreibungen, Interoperabilitätsfragen und Archivie-
rungsproblemen mit den derzeitigen technischen,
personellen und organisatorischen Infrastrukturen in
den unterschiedlichen altertumswissenschaftlichen
Institutionen und Disziplinen nicht mehr beherrschbar
sind, und dass dadurch zentrale Qualitäten digitaler
Daten wie die Austauschbarkeit, Verfügbarkeit und
Nachnutzbarkeit zur Zeit kaum gesichert werden kön-
nen, wurde 2008 durch die DFG eine Arbeitsgruppe
mit repräsentativen Fachvertretern initiiert. In dieser
sind in ihrer heutigen Zusammensetzung (Stand
Oktober 2012) beteiligt:
- das Deutsche Archäologische Institut als größtes
archäologisches Forschungsinstitut in Deutschland,
- das Exzellenzcluster TOPOI in Berlin und die Gradu-
iertenschule „Human Development in Landscapes"
an der CAU Kiel als Vertreter für große Forschungs-
verbünde und universitäre Nachwuchsförderung,
- der Verband der Landesarchäologen als Vertreter
der staatlichen Bodendenkmalpflege,
- das Rechenzentrum der Universität Köln als Vertre-
ter universitärer Infrastrukturen zur Datenzusam-
menführung, -Vorhaltung und -langzeitspeicherung,
- die Staats- und Universitäts-Bibliothek Göttingen
als Vertreter für wissenschaftliche Bibliotheken und
zentrale Informationseinrichtungen sowie als
Konsortialführer wichtiger Infrastrukturprojekte für
die Digital Humanities,
- das Curt-Engelhorn-Zentrum Archäometrie in
Mannheim als Beispiel für sogenannte An-Institute
und als Vertreter für naturwissenschaftliche For-
schungen in der Archäologie,
- die Archäologischen Staatssammlungen in
München als Vertreter der Museen,
- die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissen-
schaften als Vertreter der Akademien.
Im April 2010 wurde stellvertretend für die gesamte
DFG-Arbeitsgruppe durch Prof. Ortwin Daily (DAI
Berlin) und Prof. Frederike Fless (damals TOPOI Berlin,
jetzt DAI Berlin) ein Antrag bei der DFG zur „Ent-
wicklung eines Kompetenzzentrums für altertumswis-
senschaftliche Forschungsdaten" eingereicht. Grund-
lage dafür waren die zuvor geführten Diskussionen zu
Bedarf und Notwendigkeit eines nationalen Zen-
trums, das langfristig die Fragen und Probleme in den
Altertumswissenschaften im Umgang mit digitalen
Daten adressiert und maßgeblich zu deren Lösung
beiträgt. Mithilfe des Antrags wurde die Förderung
einer ersten, dreijährigen Projektphase angestrebt, in
der die spezifischen Anforderungen und Rahmenbe-
dingungen formuliert und Konzepte für einen langfri-
stigen Betrieb erarbeitet werden sollen. Die Ergeb-
nisse bilden dann die Basis für eine zweite Förde-
rungsphase, in der eine funktionierende Organi-
sationseinheit aufgebaut und in einen Regelbetrieb
überführt werden soll. Erklärtes Ziel ist, dass am Ende
des Prozesses ein sich selbst tragendes, unabhängiges
Forschungsdatenzentrum mit Dienstleistungen für alle
Archäologien und Altertumswissenschaften in
Deutschland existiert. Insgesamt soll auf diese Weise
eine Institutionen-, projekt- und fachübergreifende
Infrastruktur für die nachhaltige Archivierung und
Bereitstellung von qualitativen und interoperablen
digitalen Inhalten geschaffen werden.
Erste Maßnahmen:
Mehrere Arbeitspakete und mehrere
Arbeitsgruppen
Nach einer positiven Bewilligung Ende April 2011
durch die DFG konnte zum 1. September des gleichen
Jahres das Projekt unter dem neuen Titel „IANUS.
Forschungsdatenzentrum Archäologie und Alter-
tumswissenschaften" seine Arbeit aufnehmen5.
Die beiden beantragten Projektstellen sind logistisch
am Deutschen Archäologischen Institut (DAI) in Berlin
angesiedelt, das eine koordinierende Rolle in dem
Archäologie und Informationssysteme
Archäologen sind einerseits mit der Aufgabe konfron-
tiert, diese komplexen Arbeitsgebiete in geeigneten
technischen Lösungen zur Datenintegration abzubil-
den. Andererseits wird die Interoperabilität von Daten
durch die Vielfalt von Akteuren erschwert, die sich in
Deutschland und - bei internationalen Projekten - im
Ausland mit der Altertumskunde beschäftigen (Uni-
versitätsinstitute, Museen, Akademien, Denkmalfach-
behörden der Länder und Kommunen, Forschungs-
einrichtungen, kommerzielle Firmen und ehrenamt-
liche Laien) und jeweils eigene institutionelle, rechtli-
che und finanzielle Rahmenbedingungen aufweisen.
Auch wenn beide Aspekte, die Heterogenität und die
Singularität von Daten, nicht alleine für die Altertums-
wissenschaften spezifisch sind3, bei Weitem nicht neu
sind und in einzelnen Disziplinen bereits Lösungen
und Einrichtungen existieren4, bleibt festzuhalten,
dass aufgrund der durchweg hohen Komplexität der
Primärdaten und der mit diesen verbundenen viel-
schichtigen Metadaten, die durchaus ein Spezifikum
der Altertumswisenschaften darstellen, bislang eine
fachspezifische, zentrale Einrichtung in Deutschland
fehlt, die die drängenden Fragen im Umgang mit digi-
talen Forschungsdaten adressiert sowie diese nachhal-
tig archivieren und langfristig bereitstellen kann.
Eine Arbeitsgruppe und ein Antrag
Aus der Erkenntnis heraus, dass die skizzierten digita-
len Arbeitsprozesse mit ihren Formaten, Metabe-
schreibungen, Interoperabilitätsfragen und Archivie-
rungsproblemen mit den derzeitigen technischen,
personellen und organisatorischen Infrastrukturen in
den unterschiedlichen altertumswissenschaftlichen
Institutionen und Disziplinen nicht mehr beherrschbar
sind, und dass dadurch zentrale Qualitäten digitaler
Daten wie die Austauschbarkeit, Verfügbarkeit und
Nachnutzbarkeit zur Zeit kaum gesichert werden kön-
nen, wurde 2008 durch die DFG eine Arbeitsgruppe
mit repräsentativen Fachvertretern initiiert. In dieser
sind in ihrer heutigen Zusammensetzung (Stand
Oktober 2012) beteiligt:
- das Deutsche Archäologische Institut als größtes
archäologisches Forschungsinstitut in Deutschland,
- das Exzellenzcluster TOPOI in Berlin und die Gradu-
iertenschule „Human Development in Landscapes"
an der CAU Kiel als Vertreter für große Forschungs-
verbünde und universitäre Nachwuchsförderung,
- der Verband der Landesarchäologen als Vertreter
der staatlichen Bodendenkmalpflege,
- das Rechenzentrum der Universität Köln als Vertre-
ter universitärer Infrastrukturen zur Datenzusam-
menführung, -Vorhaltung und -langzeitspeicherung,
- die Staats- und Universitäts-Bibliothek Göttingen
als Vertreter für wissenschaftliche Bibliotheken und
zentrale Informationseinrichtungen sowie als
Konsortialführer wichtiger Infrastrukturprojekte für
die Digital Humanities,
- das Curt-Engelhorn-Zentrum Archäometrie in
Mannheim als Beispiel für sogenannte An-Institute
und als Vertreter für naturwissenschaftliche For-
schungen in der Archäologie,
- die Archäologischen Staatssammlungen in
München als Vertreter der Museen,
- die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissen-
schaften als Vertreter der Akademien.
Im April 2010 wurde stellvertretend für die gesamte
DFG-Arbeitsgruppe durch Prof. Ortwin Daily (DAI
Berlin) und Prof. Frederike Fless (damals TOPOI Berlin,
jetzt DAI Berlin) ein Antrag bei der DFG zur „Ent-
wicklung eines Kompetenzzentrums für altertumswis-
senschaftliche Forschungsdaten" eingereicht. Grund-
lage dafür waren die zuvor geführten Diskussionen zu
Bedarf und Notwendigkeit eines nationalen Zen-
trums, das langfristig die Fragen und Probleme in den
Altertumswissenschaften im Umgang mit digitalen
Daten adressiert und maßgeblich zu deren Lösung
beiträgt. Mithilfe des Antrags wurde die Förderung
einer ersten, dreijährigen Projektphase angestrebt, in
der die spezifischen Anforderungen und Rahmenbe-
dingungen formuliert und Konzepte für einen langfri-
stigen Betrieb erarbeitet werden sollen. Die Ergeb-
nisse bilden dann die Basis für eine zweite Förde-
rungsphase, in der eine funktionierende Organi-
sationseinheit aufgebaut und in einen Regelbetrieb
überführt werden soll. Erklärtes Ziel ist, dass am Ende
des Prozesses ein sich selbst tragendes, unabhängiges
Forschungsdatenzentrum mit Dienstleistungen für alle
Archäologien und Altertumswissenschaften in
Deutschland existiert. Insgesamt soll auf diese Weise
eine Institutionen-, projekt- und fachübergreifende
Infrastruktur für die nachhaltige Archivierung und
Bereitstellung von qualitativen und interoperablen
digitalen Inhalten geschaffen werden.
Erste Maßnahmen:
Mehrere Arbeitspakete und mehrere
Arbeitsgruppen
Nach einer positiven Bewilligung Ende April 2011
durch die DFG konnte zum 1. September des gleichen
Jahres das Projekt unter dem neuen Titel „IANUS.
Forschungsdatenzentrum Archäologie und Alter-
tumswissenschaften" seine Arbeit aufnehmen5.
Die beiden beantragten Projektstellen sind logistisch
am Deutschen Archäologischen Institut (DAI) in Berlin
angesiedelt, das eine koordinierende Rolle in dem