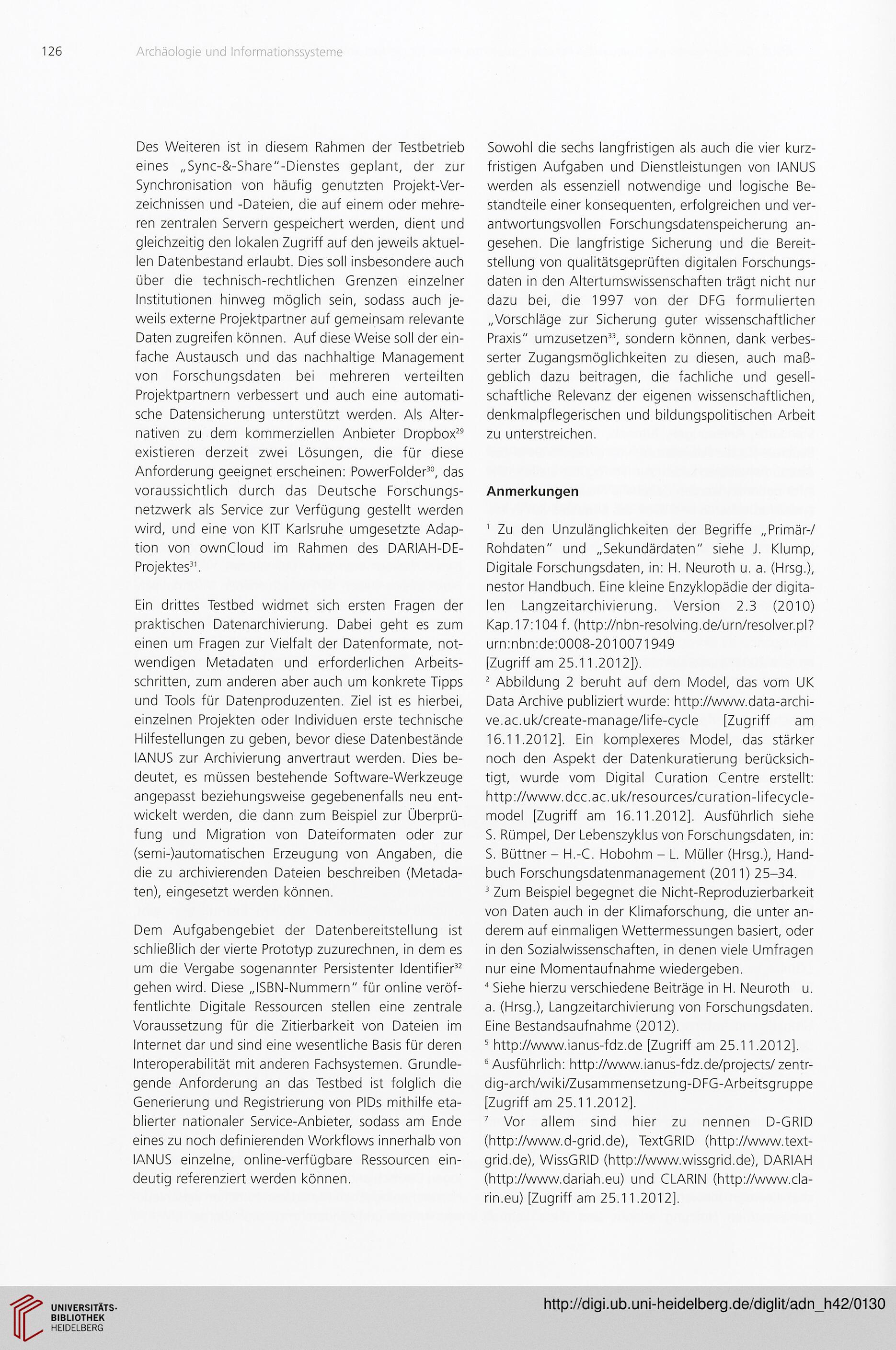126
Archäologie und Informationssysteme
Des Weiteren ist in diesem Rahmen der Testbetrieb
eines „Sync-&-Share"-Dienstes geplant, der zur
Synchronisation von häufig genutzten Projekt-Ver-
zeichnissen und -Dateien, die auf einem oder mehre-
ren zentralen Servern gespeichert werden, dient und
gleichzeitig den lokalen Zugriff auf den jeweils aktuel-
len Datenbestand erlaubt. Dies soll insbesondere auch
über die technisch-rechtlichen Grenzen einzelner
Institutionen hinweg möglich sein, sodass auch je-
weils externe Projektpartner auf gemeinsam relevante
Daten zugreifen können. Auf diese Weise soll der ein-
fache Austausch und das nachhaltige Management
von Forschungsdaten bei mehreren verteilten
Projektpartnern verbessert und auch eine automati-
sche Datensicherung unterstützt werden. Als Alter-
nativen zu dem kommerziellen Anbieter Dropbox29
existieren derzeit zwei Lösungen, die für diese
Anforderung geeignet erscheinen: PowerFolder30, das
voraussichtlich durch das Deutsche Forschungs-
netzwerk als Service zur Verfügung gestellt werden
wird, und eine von KIT Karlsruhe umgesetzte Adap-
tion von ownCloud im Rahmen des DARIAH-DE-
Projektes31.
Ein drittes Testbed widmet sich ersten Fragen der
praktischen Datenarchivierung. Dabei geht es zum
einen um Fragen zur Vielfalt der Datenformate, not-
wendigen Metadaten und erforderlichen Arbeits-
schritten, zum anderen aber auch um konkrete Tipps
und Tools für Datenproduzenten. Ziel ist es hierbei,
einzelnen Projekten oder Individuen erste technische
Hilfestellungen zu geben, bevor diese Datenbestände
IANUS zur Archivierung anvertraut werden. Dies be-
deutet, es müssen bestehende Software-Werkzeuge
angepasst beziehungsweise gegebenenfalls neu ent-
wickelt werden, die dann zum Beispiel zur Überprü-
fung und Migration von Dateiformaten oder zur
(semi-)automatischen Erzeugung von Angaben, die
die zu archivierenden Dateien beschreiben (Metada-
ten), eingesetzt werden können.
Dem Aufgabengebiet der Datenbereitstellung ist
schließlich der vierte Prototyp zuzurechnen, in dem es
um die Vergabe sogenannter Persistenter Identifier32
gehen wird. Diese „ISBN-Nummern" für online veröf-
fentlichte Digitale Ressourcen stellen eine zentrale
Voraussetzung für die Zitierbarkeit von Dateien im
Internet dar und sind eine wesentliche Basis für deren
Interoperabilität mit anderen Fachsystemen. Grundle-
gende Anforderung an das Testbed ist folglich die
Generierung und Registrierung von PIDs mithilfe eta-
blierter nationaler Service-Anbieter, sodass am Ende
eines zu noch definierenden Workflows innerhalb von
IANUS einzelne, online-verfügbare Ressourcen ein-
deutig referenziert werden können.
Sowohl die sechs langfristigen als auch die vier kurz-
fristigen Aufgaben und Dienstleistungen von IANUS
werden als essenziell notwendige und logische Be-
standteile einer konsequenten, erfolgreichen und ver-
antwortungsvollen Forschungsdatenspeicherung an-
gesehen. Die langfristige Sicherung und die Bereit-
stellung von qualitätsgeprüften digitalen Forschungs-
daten in den Altertumswissenschaften trägt nicht nur
dazu bei, die 1997 von der DFG formulierten
„Vorschläge zur Sicherung guter wissenschaftlicher
Praxis" umzusetzen33, sondern können, dank verbes-
serter Zugangsmöglichkeiten zu diesen, auch maß-
geblich dazu beitragen, die fachliche und gesell-
schaftliche Relevanz der eigenen wissenschaftlichen,
denkmalpflegerischen und bildungspolitischen Arbeit
zu unterstreichen.
Anmerkungen
’ Zu den Unzulänglichkeiten der Begriffe „Primär-/
Rohdaten" und „Sekundärdaten" siehe J. Klump,
Digitale Forschungsdaten, in: H. Neurath u. a. (Hrsg.),
nestor Handbuch. Eine kleine Enzyklopädie der digita-
len Langzeitarchivierung. Version 2.3 (2010)
Kap.17:104 f. (http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?
urn:nbn:de:0008-2010071949
[Zugriff am 25.1 1.2012]).
2 Abbildung 2 beruht auf dem Model, das vom UK
Data Archive publiziert wurde: http://www.data-archi-
ve.ac.uk/create-manage/life-cycle [Zugriff am
16.11.2012], Ein komplexeres Model, das stärker
noch den Aspekt der Datenkuratierung berücksich-
tigt, wurde vom Digital Curation Centre erstellt:
http://www.dcc.ac.uk/resources/curation-lifecycle-
model [Zugriff am 16.11.2012]. Ausführlich siehe
S. Rümpel, Der Lebenszyklus von Forschungsdaten, in:
S. Büttner - H.-C. Hobohm - L. Müller (Hrsg.), Hand-
buch Forschungsdatenmanagement (2011) 25-34.
3 Zum Beispiel begegnet die Nicht-Reproduzierbarkeit
von Daten auch in der Klimaforschung, die unter an-
derem auf einmaligen Wettermessungen basiert, oder
in den Sozialwissenschaften, in denen viele Umfragen
nur eine Momentaufnahme wiedergeben.
4 Siehe hierzu verschiedene Beiträge in H. Neurath u.
a. (Hrsg.), Langzeitarchivierung von Forschungsdaten.
Eine Bestandsaufnahme (2012).
5 http://www.ianus-fdz.de [Zugriff am 25.11.2012].
6 Ausführlich: http://www.ianus-fdz.de/projects/zentr-
dig-arch/wiki/Zusammensetzung-DFG-Arbeitsgruppe
[Zugriff am 25.1 1.2012],
7 Vor allem sind hier zu nennen D-GRID
(http://www.d-grid.de), TextGRID (http://www.text-
grid.de), WissGRID (http://www.wissgrid.de), DARIAH
(http://www.dariah.eu) und CLARIN (http://www.cla-
rin.eu) [Zugriff am 25.11.2012],
Archäologie und Informationssysteme
Des Weiteren ist in diesem Rahmen der Testbetrieb
eines „Sync-&-Share"-Dienstes geplant, der zur
Synchronisation von häufig genutzten Projekt-Ver-
zeichnissen und -Dateien, die auf einem oder mehre-
ren zentralen Servern gespeichert werden, dient und
gleichzeitig den lokalen Zugriff auf den jeweils aktuel-
len Datenbestand erlaubt. Dies soll insbesondere auch
über die technisch-rechtlichen Grenzen einzelner
Institutionen hinweg möglich sein, sodass auch je-
weils externe Projektpartner auf gemeinsam relevante
Daten zugreifen können. Auf diese Weise soll der ein-
fache Austausch und das nachhaltige Management
von Forschungsdaten bei mehreren verteilten
Projektpartnern verbessert und auch eine automati-
sche Datensicherung unterstützt werden. Als Alter-
nativen zu dem kommerziellen Anbieter Dropbox29
existieren derzeit zwei Lösungen, die für diese
Anforderung geeignet erscheinen: PowerFolder30, das
voraussichtlich durch das Deutsche Forschungs-
netzwerk als Service zur Verfügung gestellt werden
wird, und eine von KIT Karlsruhe umgesetzte Adap-
tion von ownCloud im Rahmen des DARIAH-DE-
Projektes31.
Ein drittes Testbed widmet sich ersten Fragen der
praktischen Datenarchivierung. Dabei geht es zum
einen um Fragen zur Vielfalt der Datenformate, not-
wendigen Metadaten und erforderlichen Arbeits-
schritten, zum anderen aber auch um konkrete Tipps
und Tools für Datenproduzenten. Ziel ist es hierbei,
einzelnen Projekten oder Individuen erste technische
Hilfestellungen zu geben, bevor diese Datenbestände
IANUS zur Archivierung anvertraut werden. Dies be-
deutet, es müssen bestehende Software-Werkzeuge
angepasst beziehungsweise gegebenenfalls neu ent-
wickelt werden, die dann zum Beispiel zur Überprü-
fung und Migration von Dateiformaten oder zur
(semi-)automatischen Erzeugung von Angaben, die
die zu archivierenden Dateien beschreiben (Metada-
ten), eingesetzt werden können.
Dem Aufgabengebiet der Datenbereitstellung ist
schließlich der vierte Prototyp zuzurechnen, in dem es
um die Vergabe sogenannter Persistenter Identifier32
gehen wird. Diese „ISBN-Nummern" für online veröf-
fentlichte Digitale Ressourcen stellen eine zentrale
Voraussetzung für die Zitierbarkeit von Dateien im
Internet dar und sind eine wesentliche Basis für deren
Interoperabilität mit anderen Fachsystemen. Grundle-
gende Anforderung an das Testbed ist folglich die
Generierung und Registrierung von PIDs mithilfe eta-
blierter nationaler Service-Anbieter, sodass am Ende
eines zu noch definierenden Workflows innerhalb von
IANUS einzelne, online-verfügbare Ressourcen ein-
deutig referenziert werden können.
Sowohl die sechs langfristigen als auch die vier kurz-
fristigen Aufgaben und Dienstleistungen von IANUS
werden als essenziell notwendige und logische Be-
standteile einer konsequenten, erfolgreichen und ver-
antwortungsvollen Forschungsdatenspeicherung an-
gesehen. Die langfristige Sicherung und die Bereit-
stellung von qualitätsgeprüften digitalen Forschungs-
daten in den Altertumswissenschaften trägt nicht nur
dazu bei, die 1997 von der DFG formulierten
„Vorschläge zur Sicherung guter wissenschaftlicher
Praxis" umzusetzen33, sondern können, dank verbes-
serter Zugangsmöglichkeiten zu diesen, auch maß-
geblich dazu beitragen, die fachliche und gesell-
schaftliche Relevanz der eigenen wissenschaftlichen,
denkmalpflegerischen und bildungspolitischen Arbeit
zu unterstreichen.
Anmerkungen
’ Zu den Unzulänglichkeiten der Begriffe „Primär-/
Rohdaten" und „Sekundärdaten" siehe J. Klump,
Digitale Forschungsdaten, in: H. Neurath u. a. (Hrsg.),
nestor Handbuch. Eine kleine Enzyklopädie der digita-
len Langzeitarchivierung. Version 2.3 (2010)
Kap.17:104 f. (http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?
urn:nbn:de:0008-2010071949
[Zugriff am 25.1 1.2012]).
2 Abbildung 2 beruht auf dem Model, das vom UK
Data Archive publiziert wurde: http://www.data-archi-
ve.ac.uk/create-manage/life-cycle [Zugriff am
16.11.2012], Ein komplexeres Model, das stärker
noch den Aspekt der Datenkuratierung berücksich-
tigt, wurde vom Digital Curation Centre erstellt:
http://www.dcc.ac.uk/resources/curation-lifecycle-
model [Zugriff am 16.11.2012]. Ausführlich siehe
S. Rümpel, Der Lebenszyklus von Forschungsdaten, in:
S. Büttner - H.-C. Hobohm - L. Müller (Hrsg.), Hand-
buch Forschungsdatenmanagement (2011) 25-34.
3 Zum Beispiel begegnet die Nicht-Reproduzierbarkeit
von Daten auch in der Klimaforschung, die unter an-
derem auf einmaligen Wettermessungen basiert, oder
in den Sozialwissenschaften, in denen viele Umfragen
nur eine Momentaufnahme wiedergeben.
4 Siehe hierzu verschiedene Beiträge in H. Neurath u.
a. (Hrsg.), Langzeitarchivierung von Forschungsdaten.
Eine Bestandsaufnahme (2012).
5 http://www.ianus-fdz.de [Zugriff am 25.11.2012].
6 Ausführlich: http://www.ianus-fdz.de/projects/zentr-
dig-arch/wiki/Zusammensetzung-DFG-Arbeitsgruppe
[Zugriff am 25.1 1.2012],
7 Vor allem sind hier zu nennen D-GRID
(http://www.d-grid.de), TextGRID (http://www.text-
grid.de), WissGRID (http://www.wissgrid.de), DARIAH
(http://www.dariah.eu) und CLARIN (http://www.cla-
rin.eu) [Zugriff am 25.11.2012],