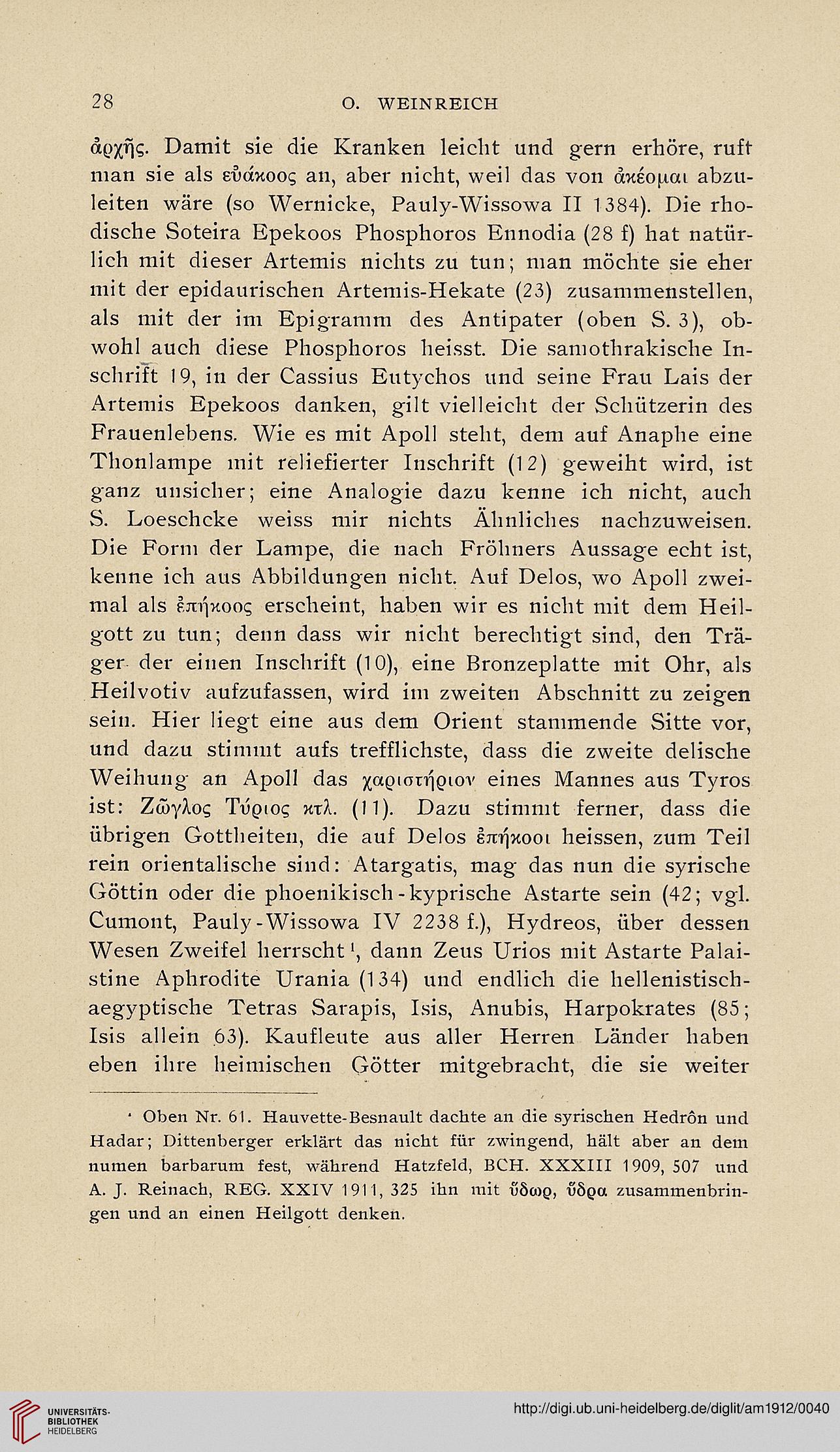28
O. WEINREICH
αρχής. Damit sie die Kranken leicht und gern erhöre, ruft
man sie als εύάκοος an, aber nicht, weil das von άκέομαι abzu-
leiten wäre (so Wernicke, Pauly-Wissowa II 1384). Die rho-
dische Soteira Epekoos Phosphoros Ennodia (28 f) hat natür-
lich mit dieser Artemis nichts zu tun; man möchte sie eher
mit der epidaurischen Artemis-Hekate (23) zusammenstellen,
als mit der im Epigramm des Antipater (oben S. 3), ob-
wohl auch diese Phosphoros heisst. Die saniothrakisclie In-
schrift 19, in der Cassius Eutychos und seine Frau Lais der
Artemis Epekoos danken, gilt vielleicht der Schützerin des
Frauenlebens. Wie es mit Apoll steht, dem auf Anaphe eine
Thonlampe mit reliefierter Inschrift (12) geweiht wird, ist
ganz unsicher; eine Analogie dazu kenne ich nicht, auch
S. Loeschcke weiss mir nichts Ähnliches nachzuweisen.
Die Form der Lampe, die nach Fröhners Aussage echt ist,
kenne ich aus Abbildungen nicht. Auf Delos, wo Apoll zwei-
mal als επήκοος erscheint, haben wir es nicht mit dem Heil-
gott zu tun; denn dass wir nicht berechtigt sind, den Trä-
ger der einen Inschrift (10), eine Bronzeplatte mit Ohr, als
Heilvotiv aufzufassen, wird im zweiten Abschnitt zu zeigen
sein. Hier liegt eine aus dem Orient stammende Sitte vor,
und dazu stimmt aufs trefflichste, dass die zweite delische
Weihung an Apoll das χαριστήριοί' eines Mannes aus Tyros
ist: Ζώγλος ΐυριος κτλ. (II). Dazu stimmt ferner, dass die
übrigen Gottheiten, die auf Delos επήκοοι heissen, zum Teil
rein orientalische sind: Atargatis, mag das nun die syrische
Göttin oder die phoenikisch-kyprische Astarte sein (42; vgl.
Cumont, Pauly-Wissowa IV 2238 f.), Hydreos, über dessen
Wesen Zweifel herrscht1, dann Zeus Urios mit Astarte Palai-
stine Aphrodite Urania (134) und endlich die hellenistiseh-
aegyptisehe Tetras Sarapis, Isis, Anubis, Harpokrates (85;
Isis allein 63). Kaufleute aus aller Herren Länder haben
eben ihre heimischen Götter mitgebraeht, die sie weiter
‘ Oben Nr. 61. Hauvette-Besnault dachte an die syrischen Hedron und
Hadar; Dittenberger erklärt das nicht für zwingend, hält aber an dem
numen barbaruni fest, während Hatzfeld, BCH. ΧΧΧΙΙΙ 1909,507 und
A. J. Reinach, REG. XXIV 1911, 325 ihn mit ΰδωρ, ΰδρα zusammenbrin-
gen und an einen Heilgott denken.
O. WEINREICH
αρχής. Damit sie die Kranken leicht und gern erhöre, ruft
man sie als εύάκοος an, aber nicht, weil das von άκέομαι abzu-
leiten wäre (so Wernicke, Pauly-Wissowa II 1384). Die rho-
dische Soteira Epekoos Phosphoros Ennodia (28 f) hat natür-
lich mit dieser Artemis nichts zu tun; man möchte sie eher
mit der epidaurischen Artemis-Hekate (23) zusammenstellen,
als mit der im Epigramm des Antipater (oben S. 3), ob-
wohl auch diese Phosphoros heisst. Die saniothrakisclie In-
schrift 19, in der Cassius Eutychos und seine Frau Lais der
Artemis Epekoos danken, gilt vielleicht der Schützerin des
Frauenlebens. Wie es mit Apoll steht, dem auf Anaphe eine
Thonlampe mit reliefierter Inschrift (12) geweiht wird, ist
ganz unsicher; eine Analogie dazu kenne ich nicht, auch
S. Loeschcke weiss mir nichts Ähnliches nachzuweisen.
Die Form der Lampe, die nach Fröhners Aussage echt ist,
kenne ich aus Abbildungen nicht. Auf Delos, wo Apoll zwei-
mal als επήκοος erscheint, haben wir es nicht mit dem Heil-
gott zu tun; denn dass wir nicht berechtigt sind, den Trä-
ger der einen Inschrift (10), eine Bronzeplatte mit Ohr, als
Heilvotiv aufzufassen, wird im zweiten Abschnitt zu zeigen
sein. Hier liegt eine aus dem Orient stammende Sitte vor,
und dazu stimmt aufs trefflichste, dass die zweite delische
Weihung an Apoll das χαριστήριοί' eines Mannes aus Tyros
ist: Ζώγλος ΐυριος κτλ. (II). Dazu stimmt ferner, dass die
übrigen Gottheiten, die auf Delos επήκοοι heissen, zum Teil
rein orientalische sind: Atargatis, mag das nun die syrische
Göttin oder die phoenikisch-kyprische Astarte sein (42; vgl.
Cumont, Pauly-Wissowa IV 2238 f.), Hydreos, über dessen
Wesen Zweifel herrscht1, dann Zeus Urios mit Astarte Palai-
stine Aphrodite Urania (134) und endlich die hellenistiseh-
aegyptisehe Tetras Sarapis, Isis, Anubis, Harpokrates (85;
Isis allein 63). Kaufleute aus aller Herren Länder haben
eben ihre heimischen Götter mitgebraeht, die sie weiter
‘ Oben Nr. 61. Hauvette-Besnault dachte an die syrischen Hedron und
Hadar; Dittenberger erklärt das nicht für zwingend, hält aber an dem
numen barbaruni fest, während Hatzfeld, BCH. ΧΧΧΙΙΙ 1909,507 und
A. J. Reinach, REG. XXIV 1911, 325 ihn mit ΰδωρ, ΰδρα zusammenbrin-
gen und an einen Heilgott denken.