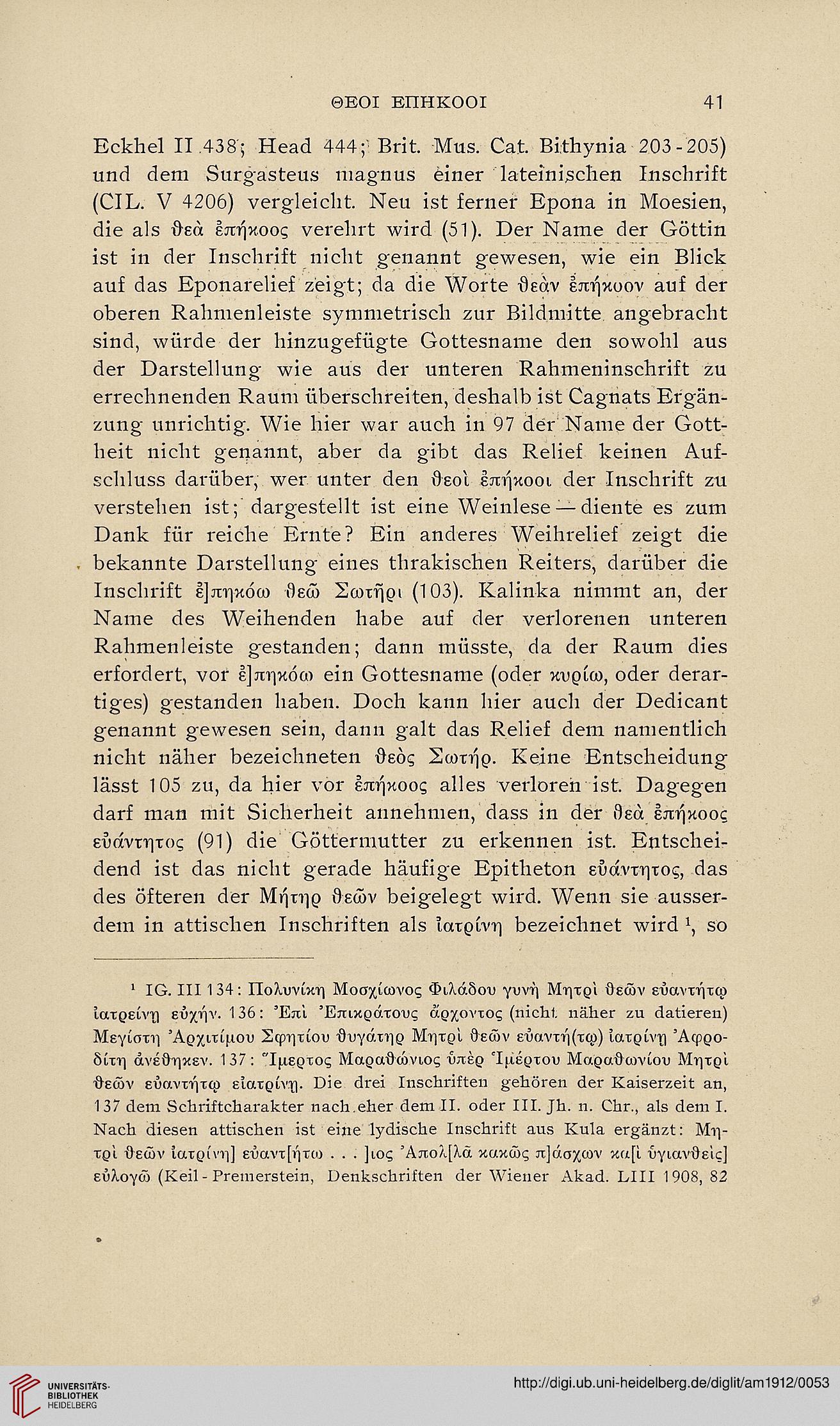ΘΕΟΙ ΕΠΗΚΟΟΙ
41
Eckhel 11.438; Head 444;' Brit. Mus. Cat. Bi.thynia 203-205)
und dem Surgasteus magnus einer lateinischen Inschrift
(CIL. V 4206) vergleicht. Neu ist ferner Epona in Moesien,
die als θεά επήκοος verehrt wird (51). Der Name der Göttin
ist in der Inschrift nicht genannt gewesen, wie ein Blick
auf das Eponarelief zeigt; da die Worte θεάν επήκοον auf der
oberen Rahmenleiste symmetrisch zur Bildmitte angebracht
sind, würde der hinzugefügte Gottesname den sowohl aus
der Darstellung wie aus der unteren Rahmeninschrift zu
errechnenden Raum überschreiten, deshalb ist Cagnats Ergän-
zung unrichtig. Wie hier war auch in 97 der Name der Gott-
heit nicht genannt, aber da gibt das Relief keinen Auf-
schluss darüber, wer unter den θεοί έπήκοοι der Inschrift zu
verstehen ist; dargestellt ist eine Weinlese — diente es zum
Dank für reiche Ernte? Ein anderes Weihrelief zeigt die
bekannte Darstellung eines thrakischen Reiters, darüber die
Inschrift έ]πηκόω ί)εώ Σωτήρι (103). Kalinka nimmt an, der
Name des Weihenden habe auf der verlorenen unteren
Rahmenleiste gestanden; dann müsste, da der Raum dies
erfordert, vor έ]πηκόω ein Gottesname (oder κτιρίω, oder derar-
tiges) gestanden haben. Doch kann hier auch der Dedicant
genannt gewesen sein, dann galt das Relief dem namentlich
nicht näher bezeichneten θεός Σωτήρ. Keine Entscheidung
lässt 105 zu, da hier vor έπήκοος alles verloren ist. Dagegen
darf man mit Sicherheit annehmen, dass in der θεά επήκοος
ευάντητος (91) die Göttermutter zu erkennen ist. Entschei-
dend ist das nicht gerade häufige Epitheton ευάντητος, das
des öfteren der Μήτηρ θεών beigelegt wird. Wenn sie ausser-
dem in attischen Inschriften als ιατρίνη bezeichnet wird ', so
1 IG. III 134: Πολυνίκη Μοσχίωνος Φιλάδου γυνή Μητρί θεών εύαντήτω
ίατρείνη ευχήν. 136: Έπί Επικρατούς άρχονχος (nicht näher zu datieren)
Μεγίστη Άρχιτίμου Σφητίου Θυγάτηρ Μητρί Θεών εΰαντή(τω) ιατρίνη Αφρο-
δίτη άνέθηκεν. 137: "Ιμερχος Μαραθώνιος υπέρ Ίμέρτου Μαραθωνίου Μητρί
θεών εύαντήχφ είατρίνη. Die drei Inschriften gehören der Kaiserzeit an,
137 dem Schriftcharakter nach eher dem II. oder III. Jh. n. Chr., als dem I.
Nach diesen attischen ist eine lydische Inschrift aus Kula ergänzt: Μη-
τρί θεών Ιατρίνη] εύαντ[ήτω . . . ]ιος Άπολ[λα κακώς π]άσχων κα[ί ύγιανθεις]
ευλογώ (Keil - Premerstein, Denkschriften der Wiener Akad. LI II 1908, 82
41
Eckhel 11.438; Head 444;' Brit. Mus. Cat. Bi.thynia 203-205)
und dem Surgasteus magnus einer lateinischen Inschrift
(CIL. V 4206) vergleicht. Neu ist ferner Epona in Moesien,
die als θεά επήκοος verehrt wird (51). Der Name der Göttin
ist in der Inschrift nicht genannt gewesen, wie ein Blick
auf das Eponarelief zeigt; da die Worte θεάν επήκοον auf der
oberen Rahmenleiste symmetrisch zur Bildmitte angebracht
sind, würde der hinzugefügte Gottesname den sowohl aus
der Darstellung wie aus der unteren Rahmeninschrift zu
errechnenden Raum überschreiten, deshalb ist Cagnats Ergän-
zung unrichtig. Wie hier war auch in 97 der Name der Gott-
heit nicht genannt, aber da gibt das Relief keinen Auf-
schluss darüber, wer unter den θεοί έπήκοοι der Inschrift zu
verstehen ist; dargestellt ist eine Weinlese — diente es zum
Dank für reiche Ernte? Ein anderes Weihrelief zeigt die
bekannte Darstellung eines thrakischen Reiters, darüber die
Inschrift έ]πηκόω ί)εώ Σωτήρι (103). Kalinka nimmt an, der
Name des Weihenden habe auf der verlorenen unteren
Rahmenleiste gestanden; dann müsste, da der Raum dies
erfordert, vor έ]πηκόω ein Gottesname (oder κτιρίω, oder derar-
tiges) gestanden haben. Doch kann hier auch der Dedicant
genannt gewesen sein, dann galt das Relief dem namentlich
nicht näher bezeichneten θεός Σωτήρ. Keine Entscheidung
lässt 105 zu, da hier vor έπήκοος alles verloren ist. Dagegen
darf man mit Sicherheit annehmen, dass in der θεά επήκοος
ευάντητος (91) die Göttermutter zu erkennen ist. Entschei-
dend ist das nicht gerade häufige Epitheton ευάντητος, das
des öfteren der Μήτηρ θεών beigelegt wird. Wenn sie ausser-
dem in attischen Inschriften als ιατρίνη bezeichnet wird ', so
1 IG. III 134: Πολυνίκη Μοσχίωνος Φιλάδου γυνή Μητρί θεών εύαντήτω
ίατρείνη ευχήν. 136: Έπί Επικρατούς άρχονχος (nicht näher zu datieren)
Μεγίστη Άρχιτίμου Σφητίου Θυγάτηρ Μητρί Θεών εΰαντή(τω) ιατρίνη Αφρο-
δίτη άνέθηκεν. 137: "Ιμερχος Μαραθώνιος υπέρ Ίμέρτου Μαραθωνίου Μητρί
θεών εύαντήχφ είατρίνη. Die drei Inschriften gehören der Kaiserzeit an,
137 dem Schriftcharakter nach eher dem II. oder III. Jh. n. Chr., als dem I.
Nach diesen attischen ist eine lydische Inschrift aus Kula ergänzt: Μη-
τρί θεών Ιατρίνη] εύαντ[ήτω . . . ]ιος Άπολ[λα κακώς π]άσχων κα[ί ύγιανθεις]
ευλογώ (Keil - Premerstein, Denkschriften der Wiener Akad. LI II 1908, 82