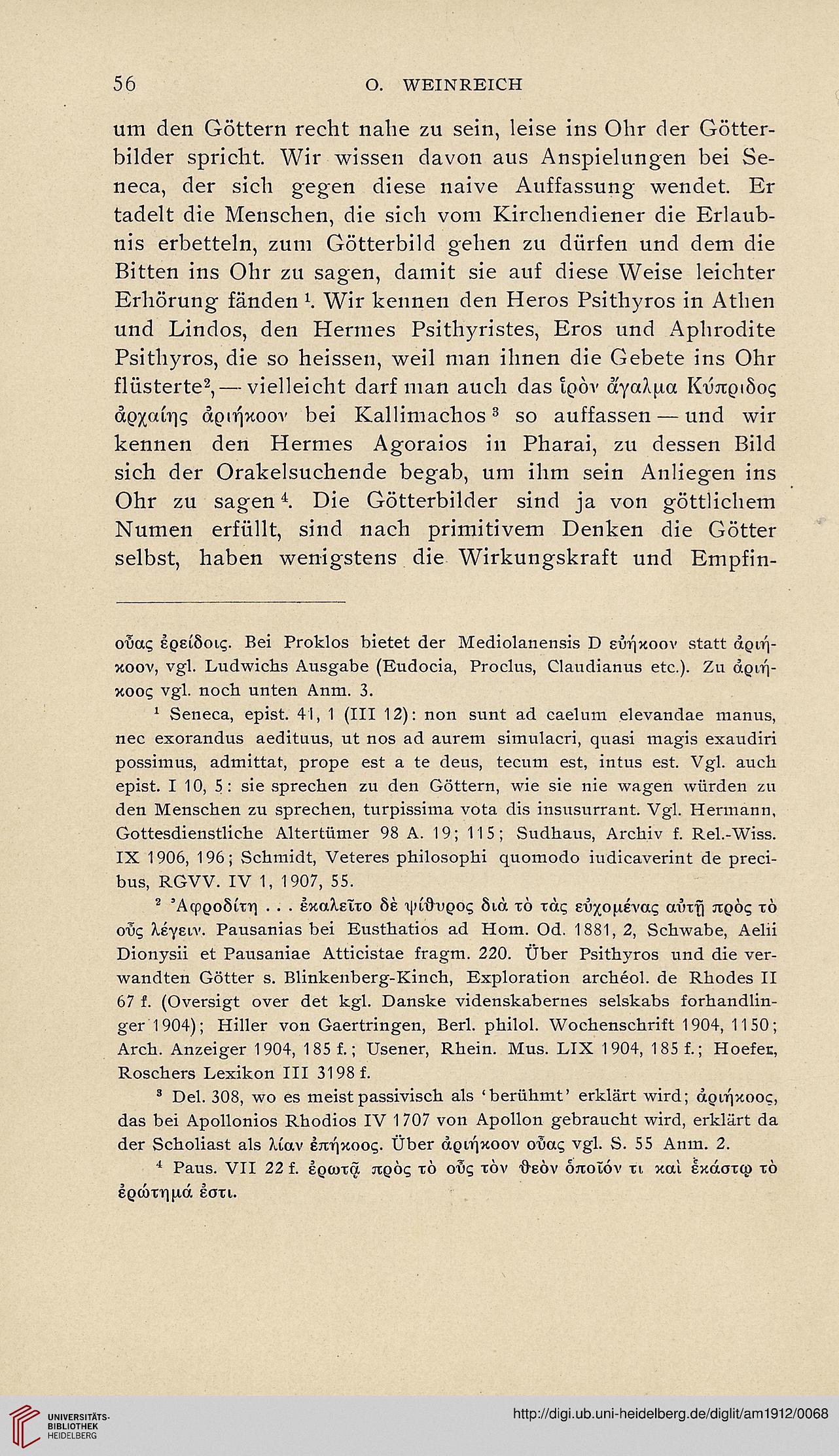56
O. WEINREICH
um den Göttern recht nahe zu sein, leise ins Ohr der Götter-
bilder spricht Wir wissen davon aus Anspielungen bei Se-
neca, der sich gegen diese naive Auffassung wendet. Er
tadelt die Menschen, die sich vom Kirchendiener die Erlaub-
nis erbetteln, zum Götterbild gehen zu dürfen und dem die
Bitten ins Ohr zu sagen, damit sie auf diese Weise leichter
Erhörung fänden K Wir kennen den Heros Psithyros in Athen
und Lindos, den Hermes Psithyristes, Eros und Aphrodite
Psithyros, die so heissen, weil man ihnen die Gebete ins Ohr
flüsterte* 1 2, — vielleicht darf man auch das ίρόν άγαλμα Κυπριδος
άρχαίης άριήκοον bei Kallimachos3 so auffassen — und wir
kennen den Hermes Agoraios in Pharai, zu dessen Bild
sich der Orakelsuchende begab, um ihm sein Anliegen ins
Ohr zu sagen4. Die Götterbilder sind ja von göttlichem
Numen erfüllt, sind nach primitivem Denken die Götter
selbst, haben wenigstens die Wirkungskraft und Empfin-
οΰας έρείδοις. Bei Proklos bietet der Mediolanensis D εύήκοον statt άριή-
κοον, vgl. Ludwichs Ausgabe (Eudocia, Proclus, Claudianus etc.). Zu άριή-
κοος vgl. noch unten Anm. 3.
1 Seneca, epist. 41, 1 (III 12): non sunt ad caelum elevandae manus,
nec exorandus aedituus, ut nos ad aurem simulacri, quasi magis exaudiri
possimus, admittat, prope est a te deus, tecum est, intus est. Vgl. auch
epist. I 10, 5: sie sprechen zu den Göttern, wie sie nie wagen würden zu
den Menschen zu sprechen, turpissima vota dis insusurrant. Vgl. Hermann,
Gottesdienstliche Altertümer 98 A. 19; 115; Sudhaus, Archiv f. Rel.-Wiss.
IX 1906, 196; Schmidt, Veteres philosophi quomodo iudicaverint de preci-
bus, RGW. IV 1, 1907, 55.
2 Άιρροδίτη . . . εκαλείτο δέ ψίθυρος διά τό τάς εύχομένας αότή πρός τό
οΰς λέγειν. Pausanias bei Eusthatios ad Hom. Od. 1881, 2, Schwabe, Aelii
Dionysii et Pausaniae Atticistae fragm. 220. Über Psithyros und die ver-
wandten Götter s. Blinkenberg-Kinch, Exploration archeol. de Rhodes II
67 f. (Oversigt over det kgl. Danske videnskabernes selskabs forhandlin-
ger 1904); Hiller von Gaertringen, Berl. philol. Wochenschrift 1904, 1150;
Arch. Anzeiger 1904, 185 f.; Usener, Rhein. Mus. LIX 1904, 185 f.; Hoefer,
Roschers Lexikon III 3198 f.
3 Del. 308, wo es meist passivisch als ‘berühmt’ erklärt wird; άριήκοος,
das bei Apollonios Rhodios IV 1707 von Apollon gebraucht wird, erklärt da
der Scholiast als λίαν έπήκοος. Über άριήκοον οΰας vgl. S. 55 Anm. 2.
4 Paus. VII 22 f. έρωτά πρός τό οΰς τόν θεόν όποιον τι καί έκάστφ τό
ερώτημά έστι.
O. WEINREICH
um den Göttern recht nahe zu sein, leise ins Ohr der Götter-
bilder spricht Wir wissen davon aus Anspielungen bei Se-
neca, der sich gegen diese naive Auffassung wendet. Er
tadelt die Menschen, die sich vom Kirchendiener die Erlaub-
nis erbetteln, zum Götterbild gehen zu dürfen und dem die
Bitten ins Ohr zu sagen, damit sie auf diese Weise leichter
Erhörung fänden K Wir kennen den Heros Psithyros in Athen
und Lindos, den Hermes Psithyristes, Eros und Aphrodite
Psithyros, die so heissen, weil man ihnen die Gebete ins Ohr
flüsterte* 1 2, — vielleicht darf man auch das ίρόν άγαλμα Κυπριδος
άρχαίης άριήκοον bei Kallimachos3 so auffassen — und wir
kennen den Hermes Agoraios in Pharai, zu dessen Bild
sich der Orakelsuchende begab, um ihm sein Anliegen ins
Ohr zu sagen4. Die Götterbilder sind ja von göttlichem
Numen erfüllt, sind nach primitivem Denken die Götter
selbst, haben wenigstens die Wirkungskraft und Empfin-
οΰας έρείδοις. Bei Proklos bietet der Mediolanensis D εύήκοον statt άριή-
κοον, vgl. Ludwichs Ausgabe (Eudocia, Proclus, Claudianus etc.). Zu άριή-
κοος vgl. noch unten Anm. 3.
1 Seneca, epist. 41, 1 (III 12): non sunt ad caelum elevandae manus,
nec exorandus aedituus, ut nos ad aurem simulacri, quasi magis exaudiri
possimus, admittat, prope est a te deus, tecum est, intus est. Vgl. auch
epist. I 10, 5: sie sprechen zu den Göttern, wie sie nie wagen würden zu
den Menschen zu sprechen, turpissima vota dis insusurrant. Vgl. Hermann,
Gottesdienstliche Altertümer 98 A. 19; 115; Sudhaus, Archiv f. Rel.-Wiss.
IX 1906, 196; Schmidt, Veteres philosophi quomodo iudicaverint de preci-
bus, RGW. IV 1, 1907, 55.
2 Άιρροδίτη . . . εκαλείτο δέ ψίθυρος διά τό τάς εύχομένας αότή πρός τό
οΰς λέγειν. Pausanias bei Eusthatios ad Hom. Od. 1881, 2, Schwabe, Aelii
Dionysii et Pausaniae Atticistae fragm. 220. Über Psithyros und die ver-
wandten Götter s. Blinkenberg-Kinch, Exploration archeol. de Rhodes II
67 f. (Oversigt over det kgl. Danske videnskabernes selskabs forhandlin-
ger 1904); Hiller von Gaertringen, Berl. philol. Wochenschrift 1904, 1150;
Arch. Anzeiger 1904, 185 f.; Usener, Rhein. Mus. LIX 1904, 185 f.; Hoefer,
Roschers Lexikon III 3198 f.
3 Del. 308, wo es meist passivisch als ‘berühmt’ erklärt wird; άριήκοος,
das bei Apollonios Rhodios IV 1707 von Apollon gebraucht wird, erklärt da
der Scholiast als λίαν έπήκοος. Über άριήκοον οΰας vgl. S. 55 Anm. 2.
4 Paus. VII 22 f. έρωτά πρός τό οΰς τόν θεόν όποιον τι καί έκάστφ τό
ερώτημά έστι.