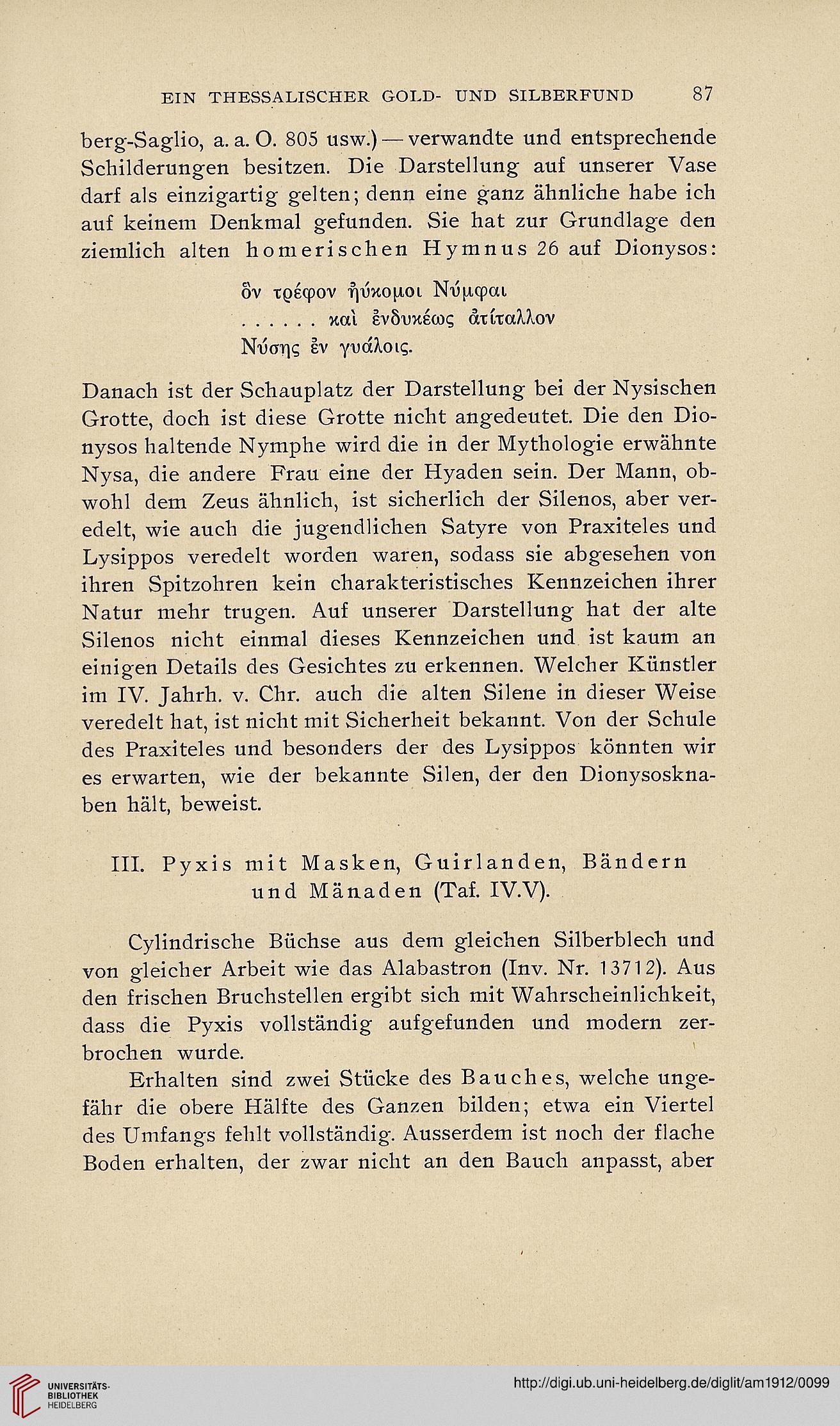EIN THESSALISCHER GOLD- UND SILBERFUND
87
berg-Saglio, a. a. 0. 805 usw.) — verwandte und entsprechende
Schilderungen besitzen. Die Darstellung auf unserer Vase
darf als einzigartig gelten; denn eine ganz ähnliche habe ich
auf keinem Denkmal gefunden. Sie hat zur Grundlage den
ziemlich alten homerischen Hymnus 26 auf Dionysos:
ον τρέφον ήΰκομοι Νΰμφαι
.καί ένδυκέως dt ίταλλον
Νιίσης εν γυάλοις.
Danach ist der Schauplatz der Darstellung bei der Nysischen
Grotte, doch ist diese Grotte nicht angedeutet. Die den Dio-
nysos haltende Nymphe wird die in der Mythologie erwähnte
Nysa, die andere Frau eine der Hyaden sein. Der Mann, ob-
wohl dem Zeus ähnlich, ist sicherlich der Silenos, aber ver-
edelt, wie auch die jugendlichen Satyre von Praxiteles und
Lysippos veredelt worden waren, sodass sie abgesehen von
ihren Spitzohren kein charakteristisches Kennzeichen ihrer
Natur mehr trugen. Auf unserer Darstellung hat der alte
Silenos nicht einmal dieses Kennzeichen und ist kaum an
einigen Details des Gesichtes zu erkennen. Welcher Künstler
im IV. Jahrh. v. Chr. auch die alten Silene in dieser Weise
veredelt hat, ist nicht mit Sicherheit bekannt. Von der Schule
des Praxiteles und besonders der des Lysippos könnten wir
es erwarten, wie der bekannte Silen, der den Dionysoskna-
ben hält, beweist.
III. Pyxis mit Masken, Guirlanden, Bändern
und Mänaden (Taf. IV.V).
Cylindrisclie Büchse aus dem gleichen Silberblech und
von gleicher Arbeit wie das Alabastron (Inv. Nr. 13712). Aus
den frischen Bruchstellen ergibt sich mit Wahrscheinlichkeit,
dass die Pyxis vollständig aufgefunden und modern zer-
brochen wurde.
Erhalten sind zwei Stücke des Bauches, welche unge-
fähr die obere Hälfte des Ganzen bilden; etwa ein Viertel
des Umfangs fehlt vollständig. Ausserdem ist noch der flache
Boden erhalten, der zwar nicht an den Bauch aiipasst, aber
87
berg-Saglio, a. a. 0. 805 usw.) — verwandte und entsprechende
Schilderungen besitzen. Die Darstellung auf unserer Vase
darf als einzigartig gelten; denn eine ganz ähnliche habe ich
auf keinem Denkmal gefunden. Sie hat zur Grundlage den
ziemlich alten homerischen Hymnus 26 auf Dionysos:
ον τρέφον ήΰκομοι Νΰμφαι
.καί ένδυκέως dt ίταλλον
Νιίσης εν γυάλοις.
Danach ist der Schauplatz der Darstellung bei der Nysischen
Grotte, doch ist diese Grotte nicht angedeutet. Die den Dio-
nysos haltende Nymphe wird die in der Mythologie erwähnte
Nysa, die andere Frau eine der Hyaden sein. Der Mann, ob-
wohl dem Zeus ähnlich, ist sicherlich der Silenos, aber ver-
edelt, wie auch die jugendlichen Satyre von Praxiteles und
Lysippos veredelt worden waren, sodass sie abgesehen von
ihren Spitzohren kein charakteristisches Kennzeichen ihrer
Natur mehr trugen. Auf unserer Darstellung hat der alte
Silenos nicht einmal dieses Kennzeichen und ist kaum an
einigen Details des Gesichtes zu erkennen. Welcher Künstler
im IV. Jahrh. v. Chr. auch die alten Silene in dieser Weise
veredelt hat, ist nicht mit Sicherheit bekannt. Von der Schule
des Praxiteles und besonders der des Lysippos könnten wir
es erwarten, wie der bekannte Silen, der den Dionysoskna-
ben hält, beweist.
III. Pyxis mit Masken, Guirlanden, Bändern
und Mänaden (Taf. IV.V).
Cylindrisclie Büchse aus dem gleichen Silberblech und
von gleicher Arbeit wie das Alabastron (Inv. Nr. 13712). Aus
den frischen Bruchstellen ergibt sich mit Wahrscheinlichkeit,
dass die Pyxis vollständig aufgefunden und modern zer-
brochen wurde.
Erhalten sind zwei Stücke des Bauches, welche unge-
fähr die obere Hälfte des Ganzen bilden; etwa ein Viertel
des Umfangs fehlt vollständig. Ausserdem ist noch der flache
Boden erhalten, der zwar nicht an den Bauch aiipasst, aber