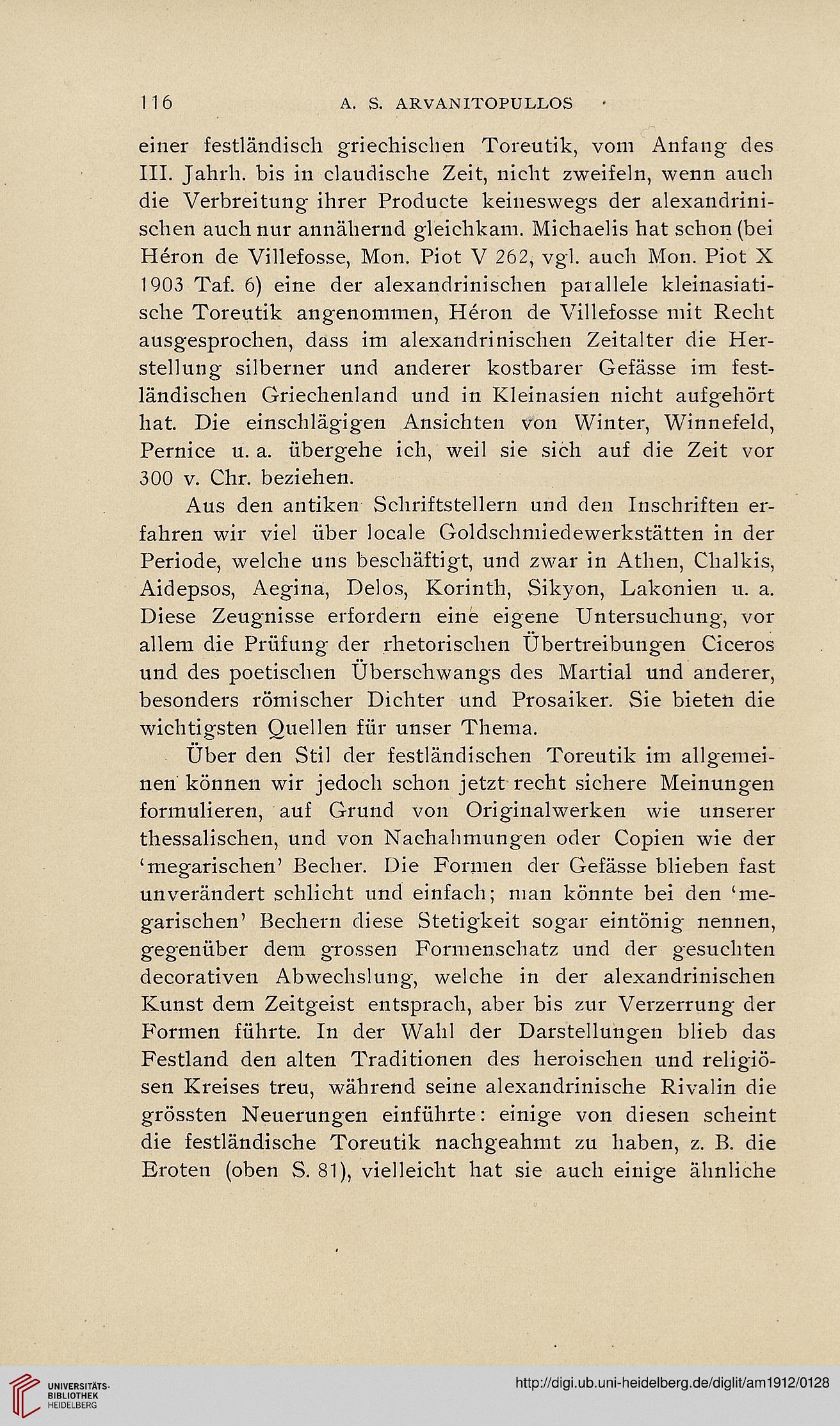116
A. S. ARVANITOPULLOS
einer festländisch griechischen Toreutik, vom Anfang des
III. Jahrh. bis in claudische Zeit, nicht zweifeln, wenn auch
die Verbreitung ihrer Producte keineswegs der alexandrini-
schen auch nur annähernd gleichkam. Michaelis hat schon (bei
Heron de Villefosse, Mon. Piot V 262, vgl. auch Mon. Piot X
1903 Taf. 6) eine der alexandrinischen parallele kleinasiati-
sche Toreutik angenommen, Heron de Villefosse mit Recht
ausgesprochen, dass im alexandrinischen Zeitalter die Her-
stellung silberner und anderer kostbarer Gefässe im fest-
ländischen Griechenland und in Kleinasien nicht aufgehört
hat. Die einschlägigen Ansichten von Winter, Winnefeld,
Pernice u. a. übergehe ich, weil sie sich auf die Zeit vor
300 v. Chr. beziehen.
Aus den antiken Schriftstellern und den Inschriften er-
fahren wir viel über locale Goldschmiedewerkstätten in der
Periode, welche uns beschäftigt, und zwar in Athen, Chalkis,
Aidepsos, Aegina, Delos, Korinth, Sikyon, Lakonien u. a.
Diese Zeugnisse erfordern eine eigene Untersuchung, vor
allem die Prüfung der rhetorischen Übertreibungen Ciceros
und des poetischen Überschwangs des Martial und anderer,
besonders römischer Dichter und Prosaiker. Sie bieten die
wichtigsten Quellen für unser Thema.
Über den Stil der festländischen Toreutik im allgemei-
nen können wir jedoch schon jetzt recht sichere Meinungen
formulieren, auf Grund von Originalwerken wie unserer
thessalischen, und von Nachahmungen oder Copien wie der
‘megarischen’ Becher. Die Formen der Gefässe blieben fast
unverändert schlicht und einfach; man könnte bei den ‘me-
garischen’ Bechern diese Stetigkeit sogar eintönig nennen,
gegenüber dem grossen Formenschatz und der gesuchten
decorativen Abwechslung, welche in der alexandrinischen
Kunst dem Zeitgeist entsprach, aber bis zur Verzerrung der
F'ormen führte. In der Wahl der Darstellungen blieb das
Festland den alten Traditionen des heroischen und religiö-
sen Kreises treu, während seine alexandrinisehe Rivalin die
grössten Neuerungen einführte: einige von diesen scheint
die festländische Toreutik nachgeahmt zu haben, z. B. die
Eroten (oben S. 81), vielleicht hat sie auch einige ähnliche
A. S. ARVANITOPULLOS
einer festländisch griechischen Toreutik, vom Anfang des
III. Jahrh. bis in claudische Zeit, nicht zweifeln, wenn auch
die Verbreitung ihrer Producte keineswegs der alexandrini-
schen auch nur annähernd gleichkam. Michaelis hat schon (bei
Heron de Villefosse, Mon. Piot V 262, vgl. auch Mon. Piot X
1903 Taf. 6) eine der alexandrinischen parallele kleinasiati-
sche Toreutik angenommen, Heron de Villefosse mit Recht
ausgesprochen, dass im alexandrinischen Zeitalter die Her-
stellung silberner und anderer kostbarer Gefässe im fest-
ländischen Griechenland und in Kleinasien nicht aufgehört
hat. Die einschlägigen Ansichten von Winter, Winnefeld,
Pernice u. a. übergehe ich, weil sie sich auf die Zeit vor
300 v. Chr. beziehen.
Aus den antiken Schriftstellern und den Inschriften er-
fahren wir viel über locale Goldschmiedewerkstätten in der
Periode, welche uns beschäftigt, und zwar in Athen, Chalkis,
Aidepsos, Aegina, Delos, Korinth, Sikyon, Lakonien u. a.
Diese Zeugnisse erfordern eine eigene Untersuchung, vor
allem die Prüfung der rhetorischen Übertreibungen Ciceros
und des poetischen Überschwangs des Martial und anderer,
besonders römischer Dichter und Prosaiker. Sie bieten die
wichtigsten Quellen für unser Thema.
Über den Stil der festländischen Toreutik im allgemei-
nen können wir jedoch schon jetzt recht sichere Meinungen
formulieren, auf Grund von Originalwerken wie unserer
thessalischen, und von Nachahmungen oder Copien wie der
‘megarischen’ Becher. Die Formen der Gefässe blieben fast
unverändert schlicht und einfach; man könnte bei den ‘me-
garischen’ Bechern diese Stetigkeit sogar eintönig nennen,
gegenüber dem grossen Formenschatz und der gesuchten
decorativen Abwechslung, welche in der alexandrinischen
Kunst dem Zeitgeist entsprach, aber bis zur Verzerrung der
F'ormen führte. In der Wahl der Darstellungen blieb das
Festland den alten Traditionen des heroischen und religiö-
sen Kreises treu, während seine alexandrinisehe Rivalin die
grössten Neuerungen einführte: einige von diesen scheint
die festländische Toreutik nachgeahmt zu haben, z. B. die
Eroten (oben S. 81), vielleicht hat sie auch einige ähnliche