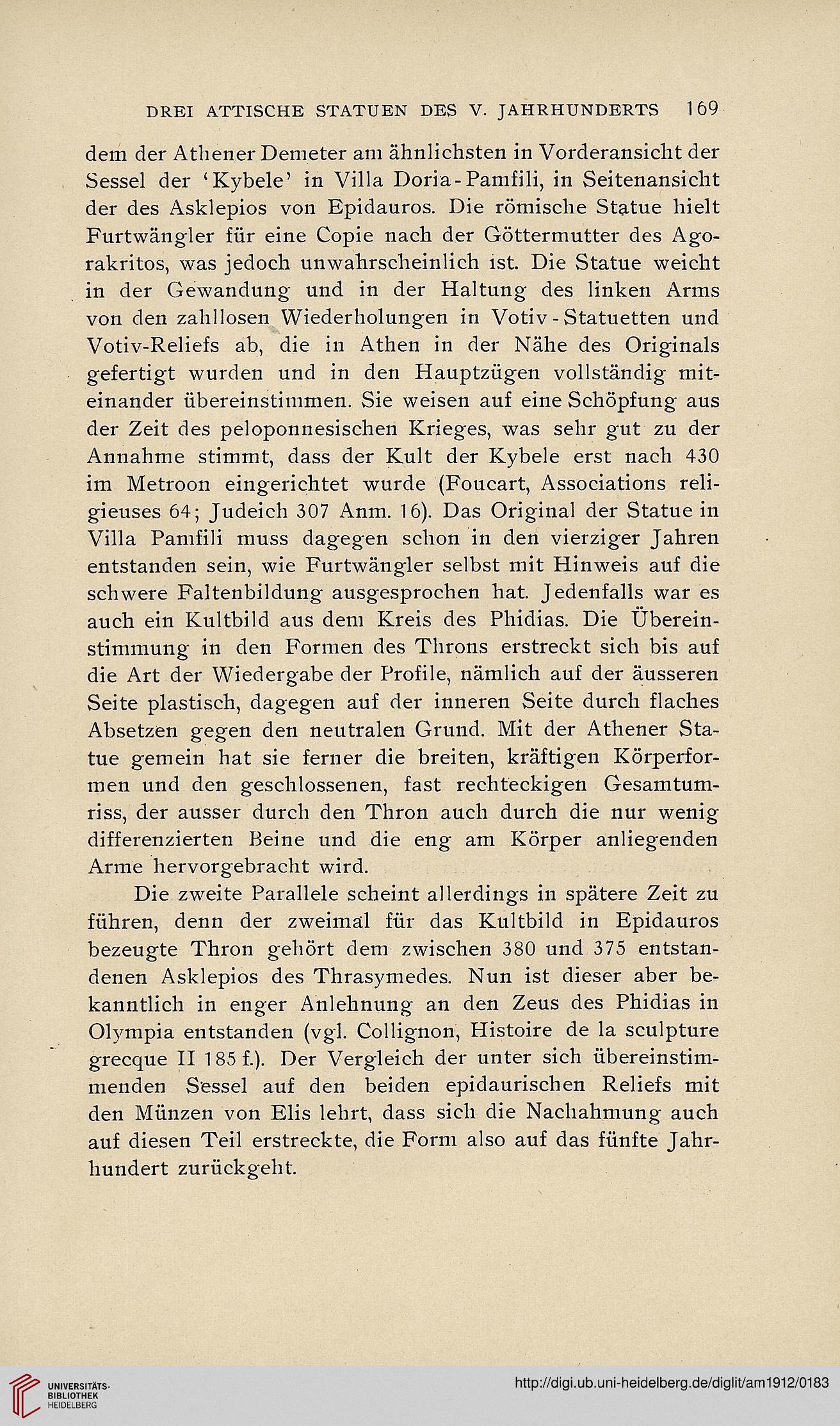DREI ATTISCHE STATUEN DES V. JAHRHUNDERTS 169
dein der Athener Demeter am ähnlichsten in Vorderansicht der
Sessel der ‘Kybele’ in Villa Doria -Pamfili, in Seitenansicht
der des Asklepios von Epidauros. Die römische Statue hielt
Furtwängler für eine Copie nach der Göttermutter des Ago-
rakritos, was jedoch unwahrscheinlich ist. Die Statue weicht
in der Gewandung und in der Haltung des linken Arms
von den zahllosen Wiederholungen in Votiv - Statuetten und
Votiv-Reliefs ab, die in Athen in der Nähe des Originals
gefertigt wurden und in den Hauptzügen vollständig mit-
einander übereinstimmen. Sie weisen auf eine Schöpfung aus
der Zeit des peloponnesischen Krieges, was sehr gut zu der
Annahme stimmt, dass der Kult der Kybele erst nach 430
im Metroon eingerichtet wurde (Foucart, Associations reli-
gieuses 64; Judeich 307 Anm. 16). Das Original der Statue in
Villa Pamfili muss dagegen schon in den vierziger Jahren
entstanden sein, wie Furtwängler selbst mit Hinweis auf die
schwere Faltenbildung ausgesprochen hat. Jedenfalls war es
auch ein Kultbild aus dem Kreis des Phidias. Die Überein-
stimmung in den Formen des Throns erstreckt sich bis auf
die Art der Wiedergabe der Profile, nämlich auf der äusseren
Seite plastisch, dagegen auf der inneren Seite durch flaches
Absetzen gegen den neutralen Grund. Mit der Athener Sta-
tue gemein hat sie ferner die breiten, kräftigen Körperfor-
men und den geschlossenen, fast rechteckigen Gesamtum-
riss, der ausser durch den Thron auch durch die nur wenig
differenzierten Beine und die eng am Körper anliegenden
Arme hervorgebracht wird.
Die zweite Parallele scheint allerdings in spätere Zeit zu
führen, denn der zweimal für das Kultbild in Epidauros
bezeugte Thron gehört dem zwischen 380 und 375 entstan-
denen Asklepios des Thrasymedes. Nun ist dieser aber be-
kanntlich in enger Anlehnung an den Zeus des Phidias in
Olympia entstanden (vgl. Collignon, Histoire de la sculpture
grecque II 1 85 f.). Der Vergleich der unter sich übereinstim-
menden Sessel auf den beiden epidaurischen Reliefs mit
den Münzen von Elis lehrt, dass sich die Nachahmung auch
auf diesen Teil erstreckte, die Form also auf das fünfte Jahr-
hundert zurückgeht.
dein der Athener Demeter am ähnlichsten in Vorderansicht der
Sessel der ‘Kybele’ in Villa Doria -Pamfili, in Seitenansicht
der des Asklepios von Epidauros. Die römische Statue hielt
Furtwängler für eine Copie nach der Göttermutter des Ago-
rakritos, was jedoch unwahrscheinlich ist. Die Statue weicht
in der Gewandung und in der Haltung des linken Arms
von den zahllosen Wiederholungen in Votiv - Statuetten und
Votiv-Reliefs ab, die in Athen in der Nähe des Originals
gefertigt wurden und in den Hauptzügen vollständig mit-
einander übereinstimmen. Sie weisen auf eine Schöpfung aus
der Zeit des peloponnesischen Krieges, was sehr gut zu der
Annahme stimmt, dass der Kult der Kybele erst nach 430
im Metroon eingerichtet wurde (Foucart, Associations reli-
gieuses 64; Judeich 307 Anm. 16). Das Original der Statue in
Villa Pamfili muss dagegen schon in den vierziger Jahren
entstanden sein, wie Furtwängler selbst mit Hinweis auf die
schwere Faltenbildung ausgesprochen hat. Jedenfalls war es
auch ein Kultbild aus dem Kreis des Phidias. Die Überein-
stimmung in den Formen des Throns erstreckt sich bis auf
die Art der Wiedergabe der Profile, nämlich auf der äusseren
Seite plastisch, dagegen auf der inneren Seite durch flaches
Absetzen gegen den neutralen Grund. Mit der Athener Sta-
tue gemein hat sie ferner die breiten, kräftigen Körperfor-
men und den geschlossenen, fast rechteckigen Gesamtum-
riss, der ausser durch den Thron auch durch die nur wenig
differenzierten Beine und die eng am Körper anliegenden
Arme hervorgebracht wird.
Die zweite Parallele scheint allerdings in spätere Zeit zu
führen, denn der zweimal für das Kultbild in Epidauros
bezeugte Thron gehört dem zwischen 380 und 375 entstan-
denen Asklepios des Thrasymedes. Nun ist dieser aber be-
kanntlich in enger Anlehnung an den Zeus des Phidias in
Olympia entstanden (vgl. Collignon, Histoire de la sculpture
grecque II 1 85 f.). Der Vergleich der unter sich übereinstim-
menden Sessel auf den beiden epidaurischen Reliefs mit
den Münzen von Elis lehrt, dass sich die Nachahmung auch
auf diesen Teil erstreckte, die Form also auf das fünfte Jahr-
hundert zurückgeht.