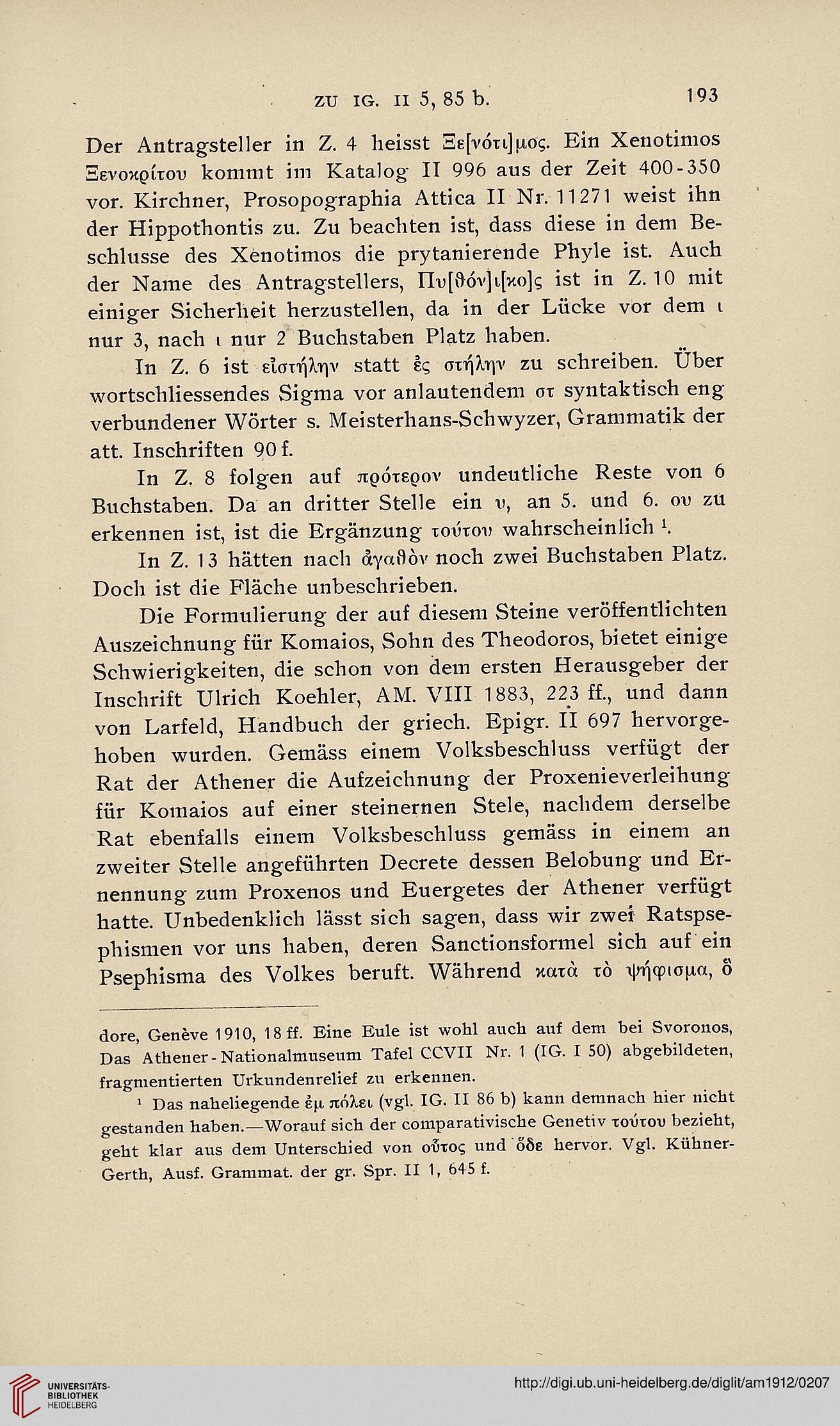zu ig. ii 5, 85 b.
193
Der Antragsteller in Z. 4 heisst Ξε[νότι]μος. Ein Xenotimos
Ξενοκρίτου kommt im Katalog· II 996 aus der Zeit 400-350
vor. Kirchner, Prosopographia Attica II Nr. 11271 weist ihn
der Hippothontis zu. Zu beachten ist, dass diese in dem Be-
schlüsse des Xenotimos die prytanierende Pliyle ist. Auch
der Name des Antragstellers, Πυ[θόν]ι[κο]ς ist in Z. 10 mit
einiger Sicherheit herzustellen, da in der Lücke vor dem t
nur 3, nach i nur 2 Buchstaben Platz haben.
In Z. 6 ist είστήλην statt ές στήλην zu schreiben. Über
wortschliessendes Sigma vor anlautendem ot syntaktisch eng
verbundener Wörter s. Meisterhans-Schwyzer, Grammatik der
att. Inschriften 90 f.
In Z. 8 folgen auf πρότερον undeutliche Reste von 6
Buchstaben. Da an dritter Stelle ein v, an 5. und 6. ου zu
erkennen ist, ist die Ergänzung τοΰτου wahrscheinlich *.
In Z. 13 hätten nach αγαθόν noch zwei Buchstaben Platz.
Doch ist die Fläche unbeschrieben.
Die Formulierung der auf diesem Steine veröffentlichten
Auszeichnung für Komaios, Sohn des Theodoros, bietet einige
Schwierigkeiten, die schon von dem ersten Herausgeber der
Inschrift Ulrich Koehler, AM. VIII 1883, 223 ff., und dann
von Larfeld, Handbuch der griech. Epigr. II 697 hervorge-
hoben wurden. Gemäss einem Volksbeschluss verfügt der
Rat der Athener die Aufzeichnung der Proxenieverleihung
für Komaios auf einer steinernen Stele, nachdem derselbe
Rat ebenfalls einem Volksbeschluss gemäss in einem an
zweiter Stelle angeführten Decrete dessen Belobung und Er-
nennung zum Proxenos und Euergetes der Athener verfügt
hatte. Unbedenklich lässt sich sagen, dass wir zwei Ratspse-
phismen vor uns haben, deren Sanctionsformel sich auf ein
Psephisma des Volkes beruft. Während κατά τό ψήφισμα, δ
dore, Geneve 1910, 18 ff. Eine Eule ist wohl auch auf dem bei Svoronos,
Das Athener-Nationalmuseum Tafel CCVII Nr. 1 (IG. I 50) abgebildeten,
fragmentierten Urkundenrelief zu erkennen.
1 Das naheliegende έμ ιτόλει (vgl. IG. II 86 b) kann demnach hier nicht
gestanden haben.—Worauf sich der comparativische Genetiv τούτου bezieht,
geht klar aus dem Unterschied von οδτος und δδε hervor. Vgl. Kühner-
Gerth, Ausf. Grammat. der gr. Spr. II 1, 645 f.
193
Der Antragsteller in Z. 4 heisst Ξε[νότι]μος. Ein Xenotimos
Ξενοκρίτου kommt im Katalog· II 996 aus der Zeit 400-350
vor. Kirchner, Prosopographia Attica II Nr. 11271 weist ihn
der Hippothontis zu. Zu beachten ist, dass diese in dem Be-
schlüsse des Xenotimos die prytanierende Pliyle ist. Auch
der Name des Antragstellers, Πυ[θόν]ι[κο]ς ist in Z. 10 mit
einiger Sicherheit herzustellen, da in der Lücke vor dem t
nur 3, nach i nur 2 Buchstaben Platz haben.
In Z. 6 ist είστήλην statt ές στήλην zu schreiben. Über
wortschliessendes Sigma vor anlautendem ot syntaktisch eng
verbundener Wörter s. Meisterhans-Schwyzer, Grammatik der
att. Inschriften 90 f.
In Z. 8 folgen auf πρότερον undeutliche Reste von 6
Buchstaben. Da an dritter Stelle ein v, an 5. und 6. ου zu
erkennen ist, ist die Ergänzung τοΰτου wahrscheinlich *.
In Z. 13 hätten nach αγαθόν noch zwei Buchstaben Platz.
Doch ist die Fläche unbeschrieben.
Die Formulierung der auf diesem Steine veröffentlichten
Auszeichnung für Komaios, Sohn des Theodoros, bietet einige
Schwierigkeiten, die schon von dem ersten Herausgeber der
Inschrift Ulrich Koehler, AM. VIII 1883, 223 ff., und dann
von Larfeld, Handbuch der griech. Epigr. II 697 hervorge-
hoben wurden. Gemäss einem Volksbeschluss verfügt der
Rat der Athener die Aufzeichnung der Proxenieverleihung
für Komaios auf einer steinernen Stele, nachdem derselbe
Rat ebenfalls einem Volksbeschluss gemäss in einem an
zweiter Stelle angeführten Decrete dessen Belobung und Er-
nennung zum Proxenos und Euergetes der Athener verfügt
hatte. Unbedenklich lässt sich sagen, dass wir zwei Ratspse-
phismen vor uns haben, deren Sanctionsformel sich auf ein
Psephisma des Volkes beruft. Während κατά τό ψήφισμα, δ
dore, Geneve 1910, 18 ff. Eine Eule ist wohl auch auf dem bei Svoronos,
Das Athener-Nationalmuseum Tafel CCVII Nr. 1 (IG. I 50) abgebildeten,
fragmentierten Urkundenrelief zu erkennen.
1 Das naheliegende έμ ιτόλει (vgl. IG. II 86 b) kann demnach hier nicht
gestanden haben.—Worauf sich der comparativische Genetiv τούτου bezieht,
geht klar aus dem Unterschied von οδτος und δδε hervor. Vgl. Kühner-
Gerth, Ausf. Grammat. der gr. Spr. II 1, 645 f.