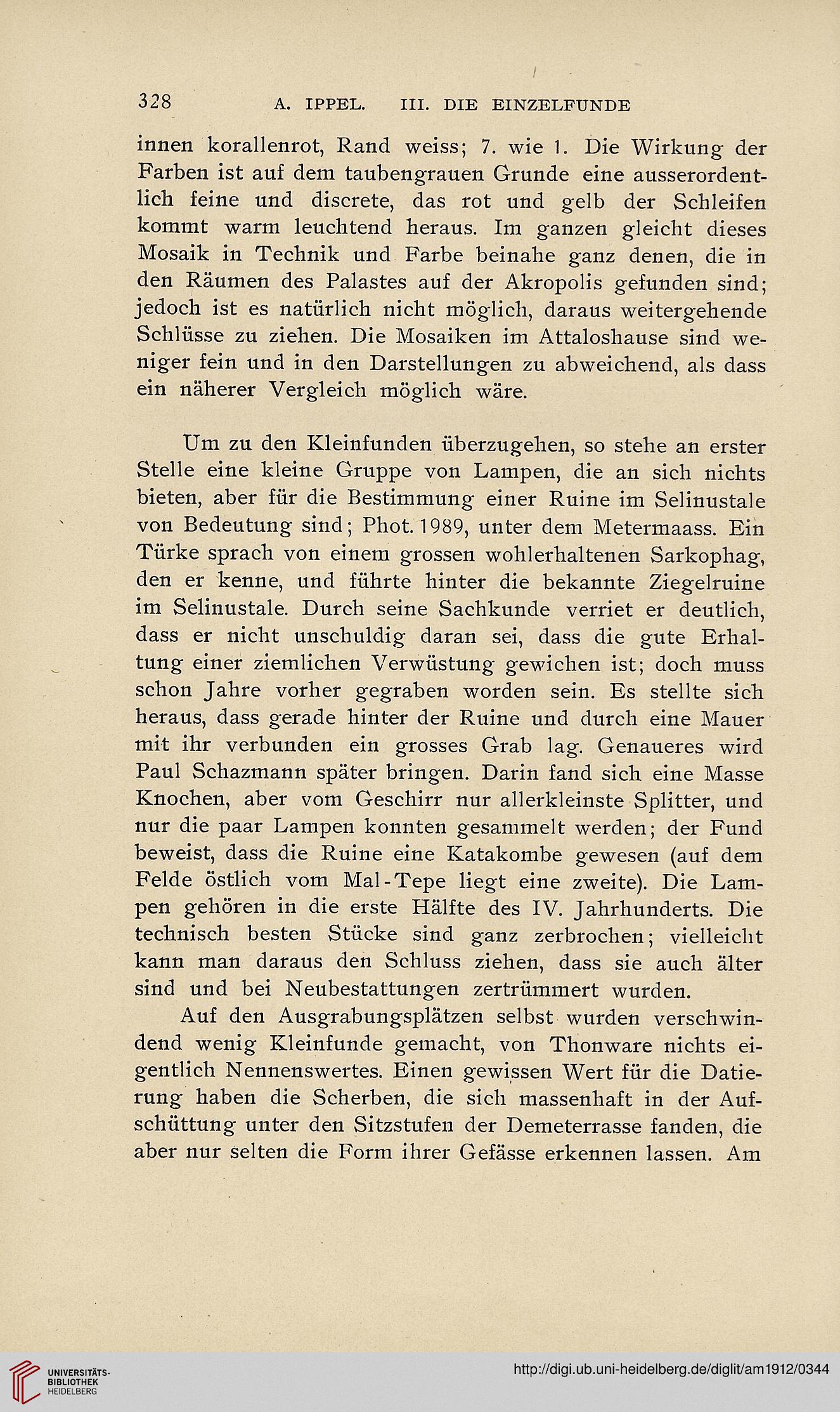328
A. IPPEL.
III. DIE EINZELFUNDE
innen korallenrot, Rand weiss; 7. wie 1. Die Wirkung der
Farben ist auf dem taubengrauen Grunde eine ausserordent-
lich feine und discrete, das rot und gelb der Schleifen
kommt warm leuchtend heraus. Im ganzen gleicht dieses
Mosaik in Technik und Farbe beinahe ganz denen, die in
den Räumen des Palastes auf der Akropolis gefunden sind;
jedoch ist es natürlich nicht möglich, daraus weitergehende
Schlüsse zu ziehen. Die Mosaiken im Attaloshause sind we-
niger fein und in den Darstellungen zu abweichend, als dass
ein näherer Vergleich möglich wäre.
Um zu den Kleinfunden überzugehen, so stehe an erster
Stelle eine kleine Gruppe von Lampen, die an sich nichts
bieten, aber für die Bestimmung einer Ruine im Selinustale
von Bedeutung sind; Phot. 1989, unter dem Metermaass. Ein
Türke sprach von einem grossen wohlerhaltenen Sarkophag,
den er kenne, und führte hinter die bekannte Ziegelruine
im Selinustale. Durch seine Sachkunde verriet er deutlich,
dass er nicht unschuldig daran sei, dass die gute Erhal-
tung einer ziemlichen Verwüstung gewichen ist; doch muss
schon Jahre vorher gegraben worden sein. Es stellte sich
heraus, dass gerade hinter der Ruine und durch eine Mauer
mit ihr verbunden ein grosses Grab lag. Genaueres wird
Paul Schazmann später bringen. Darin fand sich eine Masse
Knochen, aber vom Geschirr nur allerkleinste Splitter, und
nur die paar Lampen konnten gesammelt werden; der Fund
beweist, dass die Ruine eine Katakombe gewesen (auf dem
Felde östlich vom Mal-Tepe liegt eine zweite). Die Lam-
pen gehören in die erste Hälfte des IV. Jahrhunderts. Die
technisch besten Stücke sind ganz zerbrochen; vielleicht
kann man daraus den Schluss ziehen, dass sie auch älter
sind und bei Neubestattungen zertrümmert wurden.
Auf den Ausgrabungsplätzen selbst wurden verschwin-
dend wenig Kleinfunde gemacht, von Thonware nichts ei-
gentlich Nennenswertes. Einen gewissen Wert für die Datie-
rung haben die Scherben, die sich massenhaft in der Auf-
schüttung unter den Sitzstufen der Demeterrasse fanden, die
aber nur selten die Form ihrer Gefässe erkennen lassen. Am
A. IPPEL.
III. DIE EINZELFUNDE
innen korallenrot, Rand weiss; 7. wie 1. Die Wirkung der
Farben ist auf dem taubengrauen Grunde eine ausserordent-
lich feine und discrete, das rot und gelb der Schleifen
kommt warm leuchtend heraus. Im ganzen gleicht dieses
Mosaik in Technik und Farbe beinahe ganz denen, die in
den Räumen des Palastes auf der Akropolis gefunden sind;
jedoch ist es natürlich nicht möglich, daraus weitergehende
Schlüsse zu ziehen. Die Mosaiken im Attaloshause sind we-
niger fein und in den Darstellungen zu abweichend, als dass
ein näherer Vergleich möglich wäre.
Um zu den Kleinfunden überzugehen, so stehe an erster
Stelle eine kleine Gruppe von Lampen, die an sich nichts
bieten, aber für die Bestimmung einer Ruine im Selinustale
von Bedeutung sind; Phot. 1989, unter dem Metermaass. Ein
Türke sprach von einem grossen wohlerhaltenen Sarkophag,
den er kenne, und führte hinter die bekannte Ziegelruine
im Selinustale. Durch seine Sachkunde verriet er deutlich,
dass er nicht unschuldig daran sei, dass die gute Erhal-
tung einer ziemlichen Verwüstung gewichen ist; doch muss
schon Jahre vorher gegraben worden sein. Es stellte sich
heraus, dass gerade hinter der Ruine und durch eine Mauer
mit ihr verbunden ein grosses Grab lag. Genaueres wird
Paul Schazmann später bringen. Darin fand sich eine Masse
Knochen, aber vom Geschirr nur allerkleinste Splitter, und
nur die paar Lampen konnten gesammelt werden; der Fund
beweist, dass die Ruine eine Katakombe gewesen (auf dem
Felde östlich vom Mal-Tepe liegt eine zweite). Die Lam-
pen gehören in die erste Hälfte des IV. Jahrhunderts. Die
technisch besten Stücke sind ganz zerbrochen; vielleicht
kann man daraus den Schluss ziehen, dass sie auch älter
sind und bei Neubestattungen zertrümmert wurden.
Auf den Ausgrabungsplätzen selbst wurden verschwin-
dend wenig Kleinfunde gemacht, von Thonware nichts ei-
gentlich Nennenswertes. Einen gewissen Wert für die Datie-
rung haben die Scherben, die sich massenhaft in der Auf-
schüttung unter den Sitzstufen der Demeterrasse fanden, die
aber nur selten die Form ihrer Gefässe erkennen lassen. Am