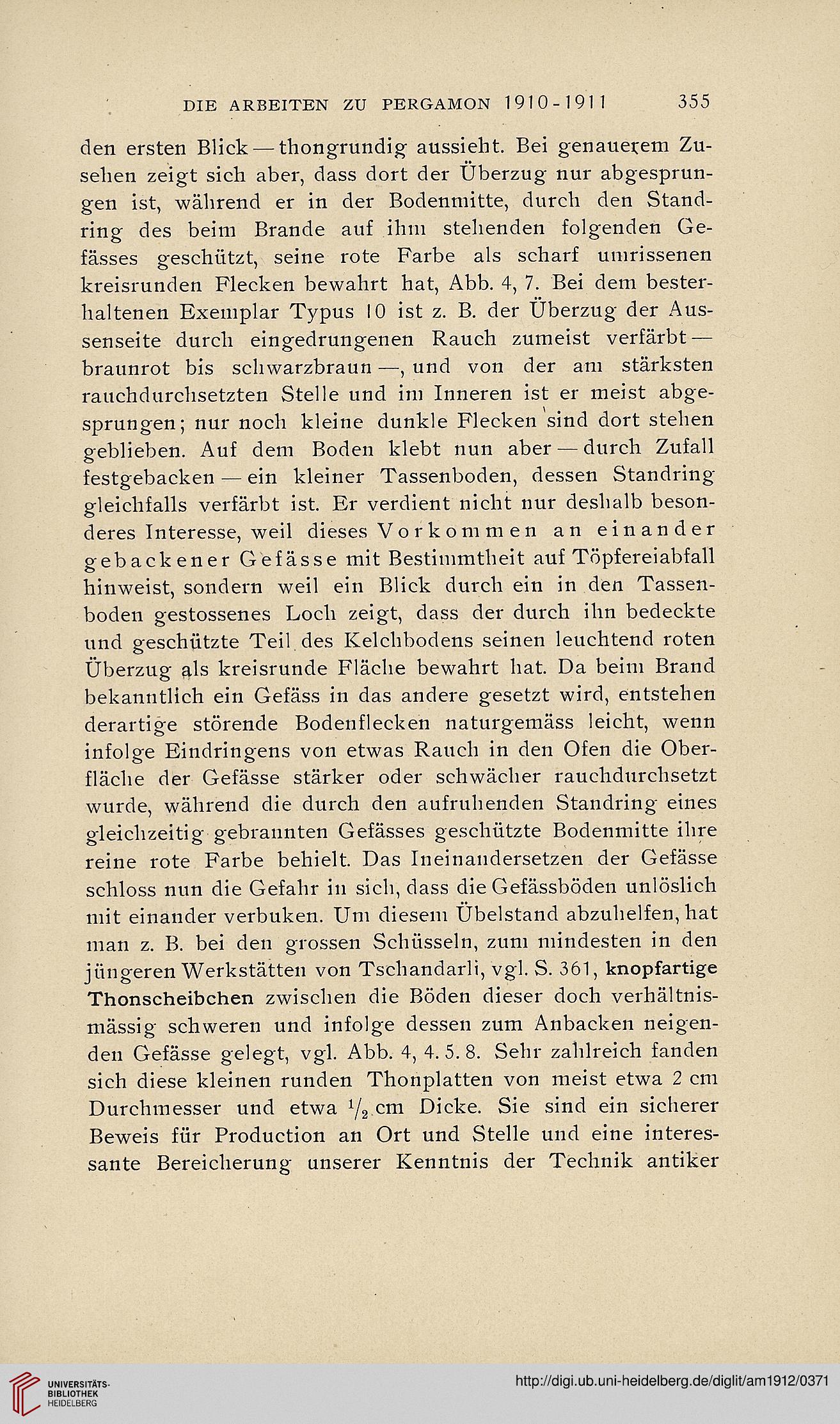DIE ARBEITEN ZU PERGAMON 1910-1911
355
den ersten Blick — thongrundig aussieht. Bei genauerem Zu-
sehen zeigt sich aber, dass dort der Überzug nur abgesprun-
gen ist, während er in der Bodenmitte, durch den Stand-
ring des beim Brande auf ihm stehenden folgenden Ge-
fässes geschützt, seine rote Farbe als scharf umrissenen
kreisrunden Flecken bewahrt hat, Abb. 4, 7. Bei dem bester-
haltenen Exemplar Typus 10 ist z. B. der Überzug der Aus-
senseite durch eingedrungenen Rauch zumeist verfärbt —
braunrot bis schwarzbraun —, und von der am stärksten
rauchdurchsetzten Stelle und im Inneren ist er meist abge-
sprungen; nur noch kleine dunkle Flecken sind dort stehen
geblieben. Auf dem Boden klebt nun aber — durch Zufall
festgebacken — ein kleiner Tassenboden, dessen Standring
gleichfalls verfärbt ist. Er verdient nicht nur deshalb beson-
deres Interesse, weil dieses Vorkommen an einander
gebackener Gefässe mit Bestimmtheit auf Töpfereiabfall
hinweist, sondern weil ein Blick durch ein in den Tassen-
boden gestossenes Loch zeigt, dass der durch ihn bedeckte
und geschützte Teil des Kelchbodens seinen leuchtend roten
Überzug als kreisrunde Fläche bewahrt hat. Da beim Brand
bekanntlich ein Gefäss in das andere gesetzt wird, entstehen
derartige störende Bodenflecken naturgemäss leicht, wenn
infolge Eindringens von etwas Rauch in den Ofen die Ober-
fläche der Gefässe stärker oder schwächer rauchdurchsetzt
wurde, während die durch den aufruhenden Standring eines
gleichzeitig gebrannten Gefässes geschützte Bodenmitte ihre
reine rote Farbe behielt. Das Ineinandersetzen der Gefässe
schloss nun die Gefahr in sich, dass die Gefässböden unlöslich
mit einander verbuken. Um diesem Übelstand abzuhelfen, hat
man z. B. bei den grossen Schüsseln, zum mindesten in den
jüngeren Werkstätten von Tschandarli, vgl. S. 361, knopfartige
Thonscheibchen zwischen die Böden dieser doch verhältnis-
mässig schweren und infolge dessen zum Aubacken neigen-
den Gefässe gelegt, vgl. Abb. 4, 4.5.8. Sehr zahlreich fanden
sich diese kleinen runden Thonplatten von meist etwa 2 cm
Durchmesser und etwa i/i cm Dicke. Sie sind ein sicherer
Beweis für Production an Ort und Stelle und eine interes-
sante Bereicherung unserer Kenntnis der Technik antiker
355
den ersten Blick — thongrundig aussieht. Bei genauerem Zu-
sehen zeigt sich aber, dass dort der Überzug nur abgesprun-
gen ist, während er in der Bodenmitte, durch den Stand-
ring des beim Brande auf ihm stehenden folgenden Ge-
fässes geschützt, seine rote Farbe als scharf umrissenen
kreisrunden Flecken bewahrt hat, Abb. 4, 7. Bei dem bester-
haltenen Exemplar Typus 10 ist z. B. der Überzug der Aus-
senseite durch eingedrungenen Rauch zumeist verfärbt —
braunrot bis schwarzbraun —, und von der am stärksten
rauchdurchsetzten Stelle und im Inneren ist er meist abge-
sprungen; nur noch kleine dunkle Flecken sind dort stehen
geblieben. Auf dem Boden klebt nun aber — durch Zufall
festgebacken — ein kleiner Tassenboden, dessen Standring
gleichfalls verfärbt ist. Er verdient nicht nur deshalb beson-
deres Interesse, weil dieses Vorkommen an einander
gebackener Gefässe mit Bestimmtheit auf Töpfereiabfall
hinweist, sondern weil ein Blick durch ein in den Tassen-
boden gestossenes Loch zeigt, dass der durch ihn bedeckte
und geschützte Teil des Kelchbodens seinen leuchtend roten
Überzug als kreisrunde Fläche bewahrt hat. Da beim Brand
bekanntlich ein Gefäss in das andere gesetzt wird, entstehen
derartige störende Bodenflecken naturgemäss leicht, wenn
infolge Eindringens von etwas Rauch in den Ofen die Ober-
fläche der Gefässe stärker oder schwächer rauchdurchsetzt
wurde, während die durch den aufruhenden Standring eines
gleichzeitig gebrannten Gefässes geschützte Bodenmitte ihre
reine rote Farbe behielt. Das Ineinandersetzen der Gefässe
schloss nun die Gefahr in sich, dass die Gefässböden unlöslich
mit einander verbuken. Um diesem Übelstand abzuhelfen, hat
man z. B. bei den grossen Schüsseln, zum mindesten in den
jüngeren Werkstätten von Tschandarli, vgl. S. 361, knopfartige
Thonscheibchen zwischen die Böden dieser doch verhältnis-
mässig schweren und infolge dessen zum Aubacken neigen-
den Gefässe gelegt, vgl. Abb. 4, 4.5.8. Sehr zahlreich fanden
sich diese kleinen runden Thonplatten von meist etwa 2 cm
Durchmesser und etwa i/i cm Dicke. Sie sind ein sicherer
Beweis für Production an Ort und Stelle und eine interes-
sante Bereicherung unserer Kenntnis der Technik antiker