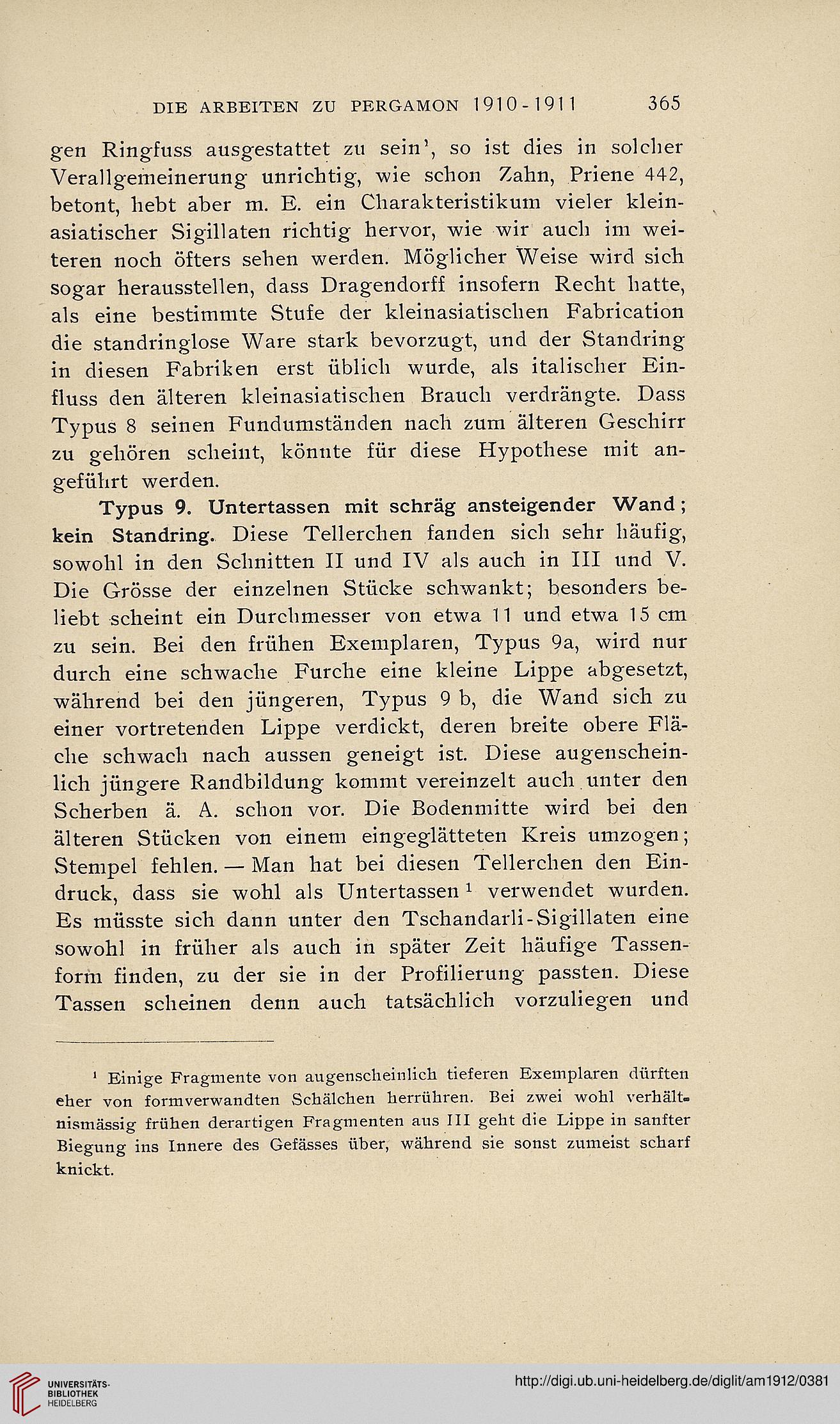DIE ARBEITEN ZU PERGAMON 1910-1911
365
gen Ringfuss ausgestattet zu sein’, so ist dies in solcher
Verallgemeinerung unrichtig, wie schon Zahn, Priene 442,
betont, hebt aber m. E. ein Charakteristikum vieler klein-
asiatischer Sigillaten richtig hervor, wie wir auch im wei-
teren noch öfters sehen werden. Möglicher Weise wird sich
sogar herausstellen, dass Dragendorff insofern Recht hatte,
als eine bestimmte Stufe der kleinasiatischen Fabrication
die standringlose Ware stark bevorzugt, und der Standring
in diesen Fabriken erst üblich wurde, als italischer Ein-
fluss den älteren kleinasiatischen Brauch verdrängte. Dass
Typus 8 seinen Fundumständen nach zum älteren Geschirr
zu gehören scheint, könnte für diese Hypothese mit an-
geführt werden.
Typus 9. Untertassen mit schräg ansteigender Wand;
kein Standring. Diese Tellerclien fanden sich sehr häufig,
sowohl in den Schnitten II und IV als auch in III und V.
Die Grösse der einzelnen Stücke schwankt; besonders be-
liebt scheint ein Durchmesser von etwa 11 und etwa 15 cm
zu sein. Bei den frühen Exemplaren, Typus 9a, wird nur
durch eine schwache Furche eine kleine Lippe abgesetzt,
während bei den jüngeren, Typus 9 b, die Wand sich zu
einer vortretenden Lippe verdickt, deren breite obere Flä-
che schwach nach aussen geneigt ist. Diese augenschein-
lich jüngere Randbildung kommt vereinzelt auch unter den
Scherben ä. A. schon vor. Die Bodenmitte wird bei den
älteren Stücken von einem eingeglätteten Kreis umzogen;
Stempel fehlen. — Man hat bei diesen Tellerclien den Ein-
druck, dass sie wohl als Untertassen1 verwendet wurden.
Es müsste sich dann unter den Tschandarli-Sigillaten eine
sowohl in früher als auch in später Zeit häufige Tassen-
form finden, zu der sie in der Profilierung passten. Diese
Tassen scheinen denn auch tatsächlich vorzuliegen und
1 Einige Fragmente von augenscheinlich tieferen Exemplaren dürften
eher von formverwandten Schälchen herrühren. Bei zwei wohl verhält,
nismässig frühen derartigen Fragmenten aus III geht die Lippe in sanfter
Biegung ins Innere des Gefässes über, während sie sonst zumeist scharf
knickt.
365
gen Ringfuss ausgestattet zu sein’, so ist dies in solcher
Verallgemeinerung unrichtig, wie schon Zahn, Priene 442,
betont, hebt aber m. E. ein Charakteristikum vieler klein-
asiatischer Sigillaten richtig hervor, wie wir auch im wei-
teren noch öfters sehen werden. Möglicher Weise wird sich
sogar herausstellen, dass Dragendorff insofern Recht hatte,
als eine bestimmte Stufe der kleinasiatischen Fabrication
die standringlose Ware stark bevorzugt, und der Standring
in diesen Fabriken erst üblich wurde, als italischer Ein-
fluss den älteren kleinasiatischen Brauch verdrängte. Dass
Typus 8 seinen Fundumständen nach zum älteren Geschirr
zu gehören scheint, könnte für diese Hypothese mit an-
geführt werden.
Typus 9. Untertassen mit schräg ansteigender Wand;
kein Standring. Diese Tellerclien fanden sich sehr häufig,
sowohl in den Schnitten II und IV als auch in III und V.
Die Grösse der einzelnen Stücke schwankt; besonders be-
liebt scheint ein Durchmesser von etwa 11 und etwa 15 cm
zu sein. Bei den frühen Exemplaren, Typus 9a, wird nur
durch eine schwache Furche eine kleine Lippe abgesetzt,
während bei den jüngeren, Typus 9 b, die Wand sich zu
einer vortretenden Lippe verdickt, deren breite obere Flä-
che schwach nach aussen geneigt ist. Diese augenschein-
lich jüngere Randbildung kommt vereinzelt auch unter den
Scherben ä. A. schon vor. Die Bodenmitte wird bei den
älteren Stücken von einem eingeglätteten Kreis umzogen;
Stempel fehlen. — Man hat bei diesen Tellerclien den Ein-
druck, dass sie wohl als Untertassen1 verwendet wurden.
Es müsste sich dann unter den Tschandarli-Sigillaten eine
sowohl in früher als auch in später Zeit häufige Tassen-
form finden, zu der sie in der Profilierung passten. Diese
Tassen scheinen denn auch tatsächlich vorzuliegen und
1 Einige Fragmente von augenscheinlich tieferen Exemplaren dürften
eher von formverwandten Schälchen herrühren. Bei zwei wohl verhält,
nismässig frühen derartigen Fragmenten aus III geht die Lippe in sanfter
Biegung ins Innere des Gefässes über, während sie sonst zumeist scharf
knickt.