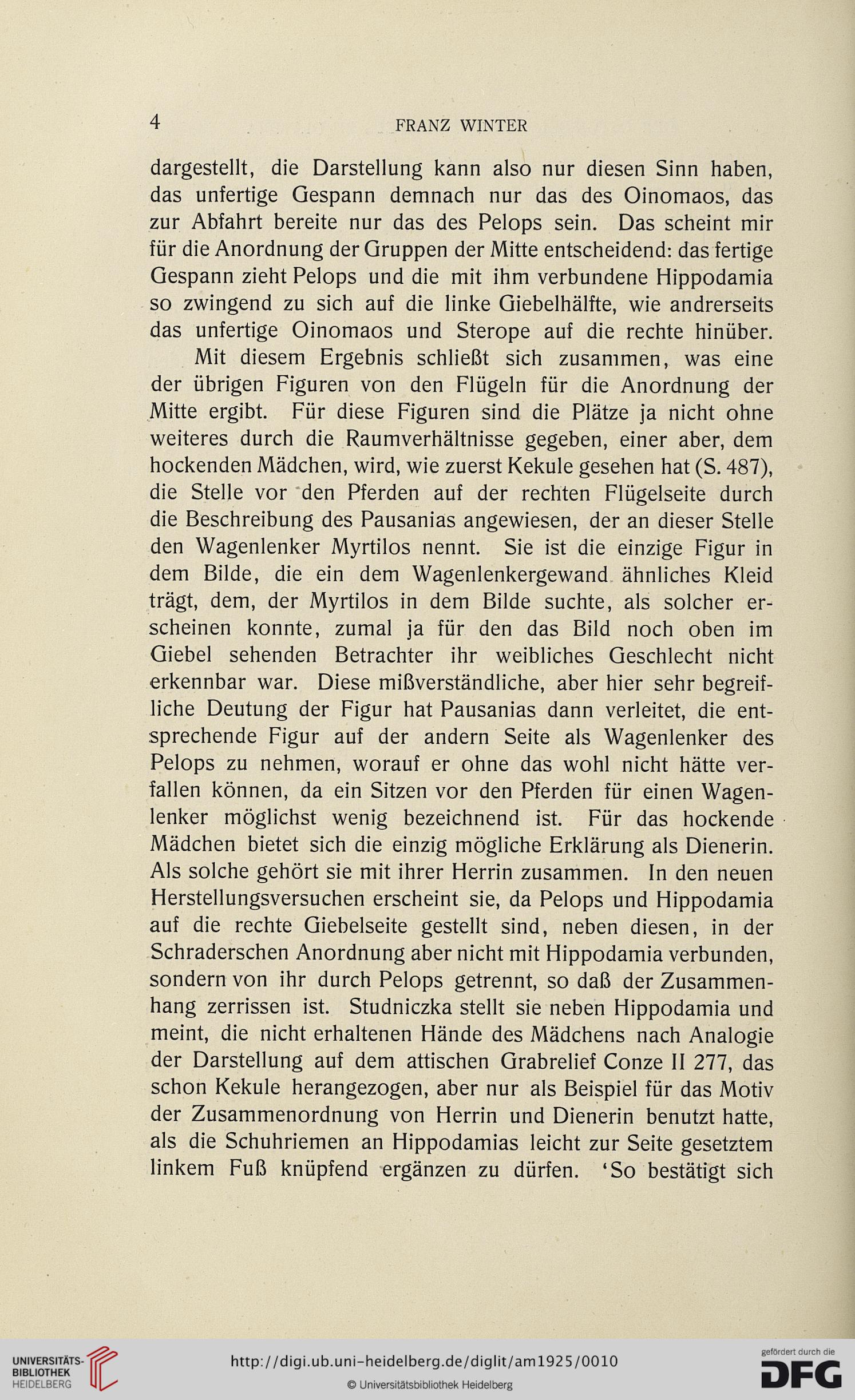4
FRANZ WINTER
dargestellt, die Darstellung kann also nur diesen Sinn haben,
das unfertige Gespann demnach nur das des Oinomaos, das
zur Abfahrt bereite nur das des Pelops sein. Das scheint mir
für die Anordnung der Gruppen der Mitte entscheidend: das fertige
Gespann zieht Pelops und die mit ihm verbundene Hippodamia
so zwingend zu sich auf die linke Giebelhälfte, wie andrerseits
das unfertige Oinomaos und Sterope auf die rechte hinüber.
Mit diesem Ergebnis schließt sich zusammen, was eine
der iibrigen Figuren von den Fliigeln fiir die Anordnung der
Mitte ergibt. Fiir diese Figuren sind die Plätze ja nicht ohne
weiteres durch die Raumverhältnisse gegeben, einer aber, dem
hockenden Mädchen, wird, wie zuerst Kekule gesehen hat (S. 487),
die Stelle vor den Pferden auf der rechten Fliigelseite durch
die Beschreibung des Pausanias angewiesen, der an dieser Stelle
den Wagenlenker Myrtilos nennt. Sie ist die einzige Figur in
dem Bilde, die ein dem Wagenlenkergewand ähnliches Kleid
trägt, dem, der Myrtilos in dem Bilde suchte, als solcher er-
scheinen konnte, zumal ja fiir den das Bild noch oben im
Giebel sehenden Betrachter ihr weibliches Geschlecht nicht
erkennbar war. Diese mißverständliche, aber hier sehr begreif-
liche Deutung der Figur hat Pausanias dann verleitet, die ent-
sprechende Figur auf der andern Seite als Wagenlenker des
Pelops zu nehmen, worauf er ohne das wohl nicht hätte ver-
fallen können, da ein Sitzen vor den Pferden fiir einen Wagen-
lenker möglichst wenig bezeichnend ist. Fiir das hockende
Mädchen bietet sich die einzig mögliche Erklärung als Dienerin.
Als solche gehört sie mit ihrer Herrin zusammen. In den neuen
Herstellungsversuchen erscheint sie, da Pelops und Hippodamia
auf die rechte Giebelseite gestellt sind, neben diesen, in der
Schraderschen Anordnung aber nicht mit Hippodamia verbunden,
sondern von ihr durch Pelops getrennt, so daß der Zusammen-
hang zerrissen ist. Studniczka stellt sie neben Hippodamia und
meint, die nicht erhaltenen Hände des Mädchens nach Analogie
der Darstellung auf dem attischen Grabrelief Conze II 277, das
schon Kekule herangezogen, aber nur als Beispiel für das Motiv
der Zusammenordnung von Herrin und Dienerin benutzt hatte,
als die Schuhriemen an Hippodamias leicht zur Seite gesetztem
linkem Fuß knüpfend ergänzen zu dürfen. ‘So bestätigt sich
FRANZ WINTER
dargestellt, die Darstellung kann also nur diesen Sinn haben,
das unfertige Gespann demnach nur das des Oinomaos, das
zur Abfahrt bereite nur das des Pelops sein. Das scheint mir
für die Anordnung der Gruppen der Mitte entscheidend: das fertige
Gespann zieht Pelops und die mit ihm verbundene Hippodamia
so zwingend zu sich auf die linke Giebelhälfte, wie andrerseits
das unfertige Oinomaos und Sterope auf die rechte hinüber.
Mit diesem Ergebnis schließt sich zusammen, was eine
der iibrigen Figuren von den Fliigeln fiir die Anordnung der
Mitte ergibt. Fiir diese Figuren sind die Plätze ja nicht ohne
weiteres durch die Raumverhältnisse gegeben, einer aber, dem
hockenden Mädchen, wird, wie zuerst Kekule gesehen hat (S. 487),
die Stelle vor den Pferden auf der rechten Fliigelseite durch
die Beschreibung des Pausanias angewiesen, der an dieser Stelle
den Wagenlenker Myrtilos nennt. Sie ist die einzige Figur in
dem Bilde, die ein dem Wagenlenkergewand ähnliches Kleid
trägt, dem, der Myrtilos in dem Bilde suchte, als solcher er-
scheinen konnte, zumal ja fiir den das Bild noch oben im
Giebel sehenden Betrachter ihr weibliches Geschlecht nicht
erkennbar war. Diese mißverständliche, aber hier sehr begreif-
liche Deutung der Figur hat Pausanias dann verleitet, die ent-
sprechende Figur auf der andern Seite als Wagenlenker des
Pelops zu nehmen, worauf er ohne das wohl nicht hätte ver-
fallen können, da ein Sitzen vor den Pferden fiir einen Wagen-
lenker möglichst wenig bezeichnend ist. Fiir das hockende
Mädchen bietet sich die einzig mögliche Erklärung als Dienerin.
Als solche gehört sie mit ihrer Herrin zusammen. In den neuen
Herstellungsversuchen erscheint sie, da Pelops und Hippodamia
auf die rechte Giebelseite gestellt sind, neben diesen, in der
Schraderschen Anordnung aber nicht mit Hippodamia verbunden,
sondern von ihr durch Pelops getrennt, so daß der Zusammen-
hang zerrissen ist. Studniczka stellt sie neben Hippodamia und
meint, die nicht erhaltenen Hände des Mädchens nach Analogie
der Darstellung auf dem attischen Grabrelief Conze II 277, das
schon Kekule herangezogen, aber nur als Beispiel für das Motiv
der Zusammenordnung von Herrin und Dienerin benutzt hatte,
als die Schuhriemen an Hippodamias leicht zur Seite gesetztem
linkem Fuß knüpfend ergänzen zu dürfen. ‘So bestätigt sich