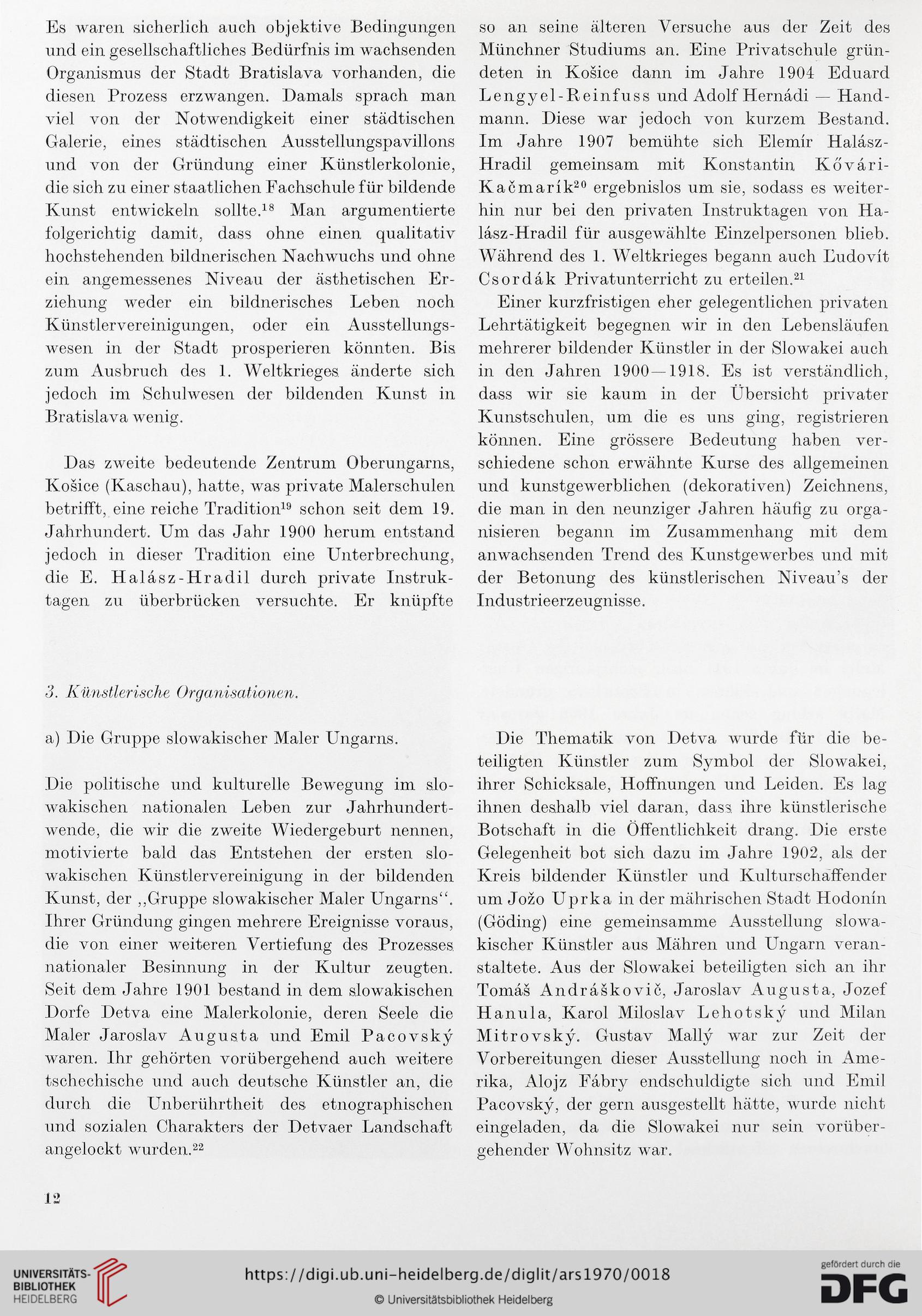Es waren sicherlich auch objektive Bedingungen
und ein gesellschaftliches Bedürfnis im wachsenden
Organismus der Stadt Bratislava vorhanden, die
diesen Prozess erzwangen. Damals sprach man
viel von der Notwendigkeit einer städtischen
Galerie, eines städtischen Ausstellungspavillons
und von der Gründung einer Künstlerkolonie,
die sich zu einer staatlichen Fachschule für bildende
Kunst entwickeln sollte.18 Man argumentierte
folgerichtig damit, dass ohne einen qualitativ
hochstehenden bildnerischen Nachwuchs und ohne
ein angemessenes Niveau der ästhetischen Er-
ziehung weder ein bildnerisches Leben noch
Künstlervereinigungen, oder ein Ausstellungs-
wesen in der Stadt prosperieren könnten. Bis
zum Ausbruch des 1. Weltkrieges, änderte sich
jedoch im Schulwesen der bildenden Kunst in
Bratislava wenig.
Das zweite bedeutende Zentrum Oberungarns,
Košice (Kaschau), hatte, was private Malerschulen
betrifft, eine reiche Tradition19 schon seit dem 19.
Jahrhundert. Um das Jahr 1900 herum entstand
jedoch in dieser Tradition eine Unterbrechung,
die E. Haläsz-Hradil durch private Instruk-
tagen zu überbrücken versuchte. Er knüpfte
3. Künstlerische Organisationen.
a) Die Gruppe slowakischer Maler Ungarns.
Die politische und kulturelle Bewegung im slo-
wakischen nationalen Leben zur Jahrhundert-
wende, die wir die zweite Wiedergeburt nennen,
motivierte bald das Entstehen der ersten slo-
wakischen Künstlervereinigung in der bildenden
Kunst, der „Gruppe slowakischer Maler Ungarns“.
Ihrer Gründung gingen mehrere Ereignisse voraus,
die von einer weiteren Vertiefung des Prozesses
nationaler Besinnung in der Kultur zeugten.
Seit dem Jahre 1901 bestand in dem slowakischen
Dorfe Detva eine Malerkolonie, deren Seele die
Maler Jaroslav Augusta und Emil Pacovský
waren. Ihr gehörten vorübergehend auch weitere
tschechische und auch deutsche Künstler an, die
durch die Unberührtheit des etnographischen
und sozialen Charakters der Detvaer Landschaft
angelockt wurden.22
so an seine älteren Versuche aus der Zeit des
Münchner Studiums an. Eine Privatschule grün-
deten in Košice dann im Jahre 1904 Eduard
Lengyel-Keinfuss und Adolf Hernädi — Hand-
mann. Diese war jedoch von kurzem Bestand.
Im Jahre 1907 bemühte sich Eiemir Haläsz-
Hradil gemeinsam mit Konstantin Köväri-
Kačmarík20 ergebnislos um sie, sodass es weiter-
hin nur bei den privaten Instruktagen von Ha-
läsz-Hradil für ausgewählte Einzelpersonen blieb.
Während des 1. Weltkrieges begann auch Ludovit
Csordäk Privatunterricht zu erteilen.21
Einer kurzfristigen eher gelegentlichen privaten
Lehrtätigkeit begegnen wir in den Lebensläufen
mehrerer bildender Künstler in der Slowakei auch
in den Jahren 1900—1918. Es ist verständlich,
dass wir sie kaum in der Übersicht privater
Kunstschulen, um die es uns ging, registrieren
können. Eine grössere Bedeutung haben ver-
schiedene schon erwähnte Kurse des allgemeinen
und kunstgewerblichen (dekorativen) Zeichnens,
die man in den neunziger Jahren häufig zu orga-
nisieren begann im Zusammenhang mit dem
anwachsenden Trend des Kunstgewerbes und mit
der Betonung des künstlerischen Niveau’s der
Industrieerzeugnisse.
Die Thematik von Detva wurde für die be-
teiligten Künstler zum Symbol der Slowakei,
ihrer Schicksale, Hoffnungen und Leiden. Es lag
ihnen deshalb viel daran, dass, ihre künstlerische
Botschaft in die Öffentlichkeit drang. Die erste
Gelegenheit bot sich dazu im Jahre 1902, als der
Kreis bildender Künstler und Kulturschaffender
um Jožo Uprka in der mährischen Stadt Hodonín
(Göding) eine gemeinsamme Ausstellung slowa-
kischer Künstler aus Mähren und Ungarn veran-
staltete. Aus der Slowakei beteiligten sich an ihr
Tomáš Andráškovič, Jaroslav Augusta, Jozef
Hann la, Karol Miloslav Lehotský und Milan
Mitrovský. Gustav Mallý war zur Zeit der
Vorbereitungen dieser Ausstellung noch in Ame-
rika, Alojz Fäbry endschuldigte sich und Emil
Pacovský, der gern ausgestellt hätte, wurde nicht
eingeladen, da die Slowakei nur sein vorüber-
gehender Wohnsitz war.
12
und ein gesellschaftliches Bedürfnis im wachsenden
Organismus der Stadt Bratislava vorhanden, die
diesen Prozess erzwangen. Damals sprach man
viel von der Notwendigkeit einer städtischen
Galerie, eines städtischen Ausstellungspavillons
und von der Gründung einer Künstlerkolonie,
die sich zu einer staatlichen Fachschule für bildende
Kunst entwickeln sollte.18 Man argumentierte
folgerichtig damit, dass ohne einen qualitativ
hochstehenden bildnerischen Nachwuchs und ohne
ein angemessenes Niveau der ästhetischen Er-
ziehung weder ein bildnerisches Leben noch
Künstlervereinigungen, oder ein Ausstellungs-
wesen in der Stadt prosperieren könnten. Bis
zum Ausbruch des 1. Weltkrieges, änderte sich
jedoch im Schulwesen der bildenden Kunst in
Bratislava wenig.
Das zweite bedeutende Zentrum Oberungarns,
Košice (Kaschau), hatte, was private Malerschulen
betrifft, eine reiche Tradition19 schon seit dem 19.
Jahrhundert. Um das Jahr 1900 herum entstand
jedoch in dieser Tradition eine Unterbrechung,
die E. Haläsz-Hradil durch private Instruk-
tagen zu überbrücken versuchte. Er knüpfte
3. Künstlerische Organisationen.
a) Die Gruppe slowakischer Maler Ungarns.
Die politische und kulturelle Bewegung im slo-
wakischen nationalen Leben zur Jahrhundert-
wende, die wir die zweite Wiedergeburt nennen,
motivierte bald das Entstehen der ersten slo-
wakischen Künstlervereinigung in der bildenden
Kunst, der „Gruppe slowakischer Maler Ungarns“.
Ihrer Gründung gingen mehrere Ereignisse voraus,
die von einer weiteren Vertiefung des Prozesses
nationaler Besinnung in der Kultur zeugten.
Seit dem Jahre 1901 bestand in dem slowakischen
Dorfe Detva eine Malerkolonie, deren Seele die
Maler Jaroslav Augusta und Emil Pacovský
waren. Ihr gehörten vorübergehend auch weitere
tschechische und auch deutsche Künstler an, die
durch die Unberührtheit des etnographischen
und sozialen Charakters der Detvaer Landschaft
angelockt wurden.22
so an seine älteren Versuche aus der Zeit des
Münchner Studiums an. Eine Privatschule grün-
deten in Košice dann im Jahre 1904 Eduard
Lengyel-Keinfuss und Adolf Hernädi — Hand-
mann. Diese war jedoch von kurzem Bestand.
Im Jahre 1907 bemühte sich Eiemir Haläsz-
Hradil gemeinsam mit Konstantin Köväri-
Kačmarík20 ergebnislos um sie, sodass es weiter-
hin nur bei den privaten Instruktagen von Ha-
läsz-Hradil für ausgewählte Einzelpersonen blieb.
Während des 1. Weltkrieges begann auch Ludovit
Csordäk Privatunterricht zu erteilen.21
Einer kurzfristigen eher gelegentlichen privaten
Lehrtätigkeit begegnen wir in den Lebensläufen
mehrerer bildender Künstler in der Slowakei auch
in den Jahren 1900—1918. Es ist verständlich,
dass wir sie kaum in der Übersicht privater
Kunstschulen, um die es uns ging, registrieren
können. Eine grössere Bedeutung haben ver-
schiedene schon erwähnte Kurse des allgemeinen
und kunstgewerblichen (dekorativen) Zeichnens,
die man in den neunziger Jahren häufig zu orga-
nisieren begann im Zusammenhang mit dem
anwachsenden Trend des Kunstgewerbes und mit
der Betonung des künstlerischen Niveau’s der
Industrieerzeugnisse.
Die Thematik von Detva wurde für die be-
teiligten Künstler zum Symbol der Slowakei,
ihrer Schicksale, Hoffnungen und Leiden. Es lag
ihnen deshalb viel daran, dass, ihre künstlerische
Botschaft in die Öffentlichkeit drang. Die erste
Gelegenheit bot sich dazu im Jahre 1902, als der
Kreis bildender Künstler und Kulturschaffender
um Jožo Uprka in der mährischen Stadt Hodonín
(Göding) eine gemeinsamme Ausstellung slowa-
kischer Künstler aus Mähren und Ungarn veran-
staltete. Aus der Slowakei beteiligten sich an ihr
Tomáš Andráškovič, Jaroslav Augusta, Jozef
Hann la, Karol Miloslav Lehotský und Milan
Mitrovský. Gustav Mallý war zur Zeit der
Vorbereitungen dieser Ausstellung noch in Ame-
rika, Alojz Fäbry endschuldigte sich und Emil
Pacovský, der gern ausgestellt hätte, wurde nicht
eingeladen, da die Slowakei nur sein vorüber-
gehender Wohnsitz war.
12