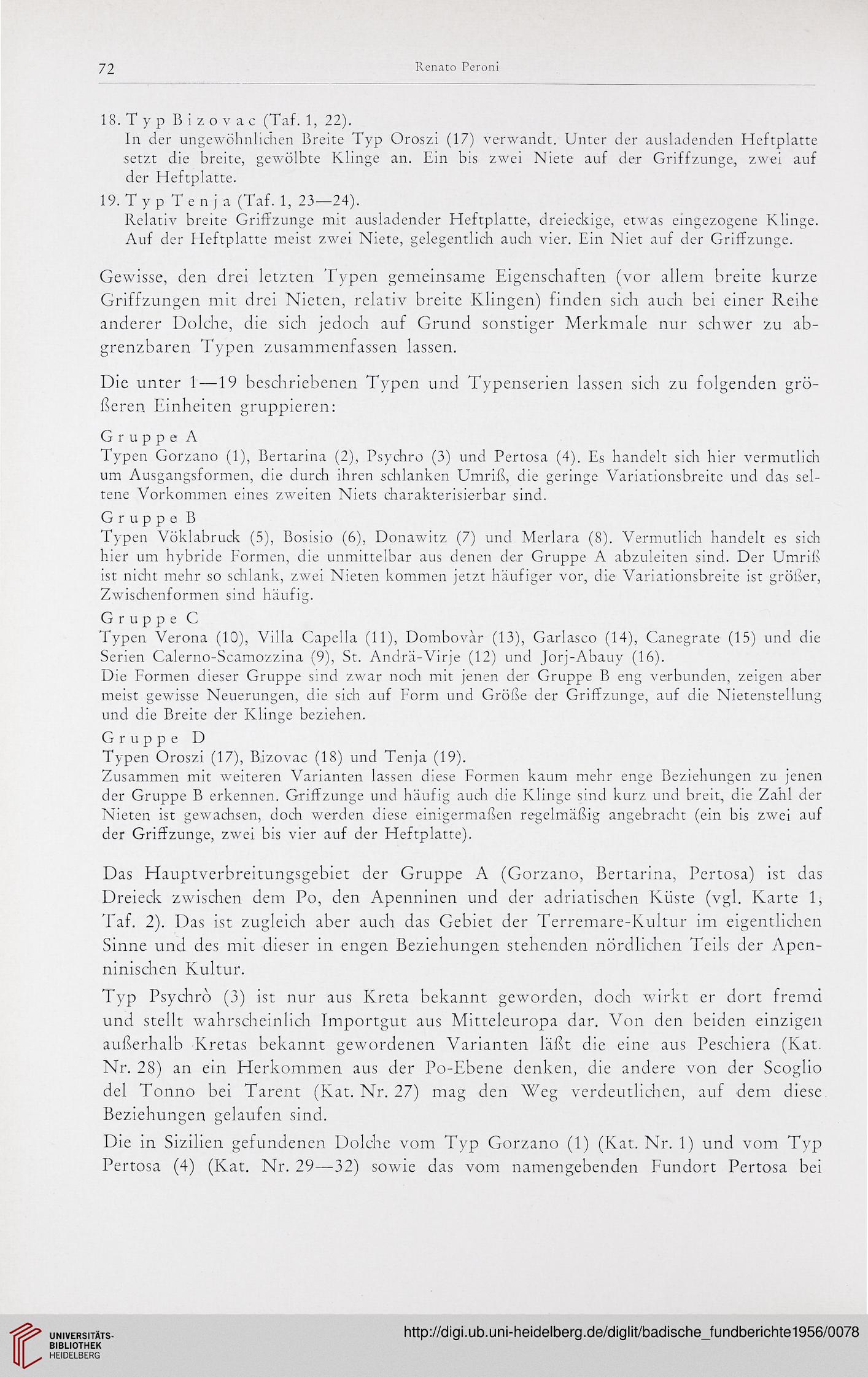72
Renato Pcroni
18. Typ Bizovac (Taf. 1, 22).
In der ungewöhnlichen Breite Typ Oroszi (17) verwandt. Unter der ausladenden Hcftplatte
setzt die breite, gewölbte Klinge an. Ein bis zwei Niete auf der Griffzunge, zwei auf
der Heftplatte.
19. T y p T e n j a (Taf. 1, 23—24).
Relativ breite Griffzunge mit ausladender Heftplatte, dreieckige, etwas eingezogene Klinge.
Auf der Heftplatte meist zwei Niete, gelegentlich auch vier. Ein Niet auf der Griffzunge.
Gewisse, den drei letzten Typen gemeinsame Eigenschaften (vor allem breite kurze
Griffzungen mit drei Nieten, relativ breite Klingen) finden sich auch bei einer Reihe
anderer Dolche, die sich jedoch auf Grund sonstiger Merkmale nur schwer zu ab-
grenzbaren Typen zusammenfassen lassen.
Die unter 1 —19 beschriebenen Typen und Typenserien lassen sich zu folgenden grö-
ßeren Einheiten gruppieren:
Gruppe A
Typen Gorzano (1), Bertarina (2), Psychro (3) und Pertosa (4). Es handelt sich hier vermutlich
um Ausgangsformen, die durch ihren schlanken Umriß, die geringe Variationsbreite und das sel-
tene Vorkommen eines zweiten Niets charakterisierbar sind.
Gruppe B
Typen Vöklabruck (5), Bosisio (6), Donawitz (7) und Merlara (8). Vermutlich handelt es sich
hier um hybride Formen, die unmittelbar aus denen der Gruppe A abzuleiten sind. Der Umriß
ist nicht mehr so schlank, zwei Nieten kommen jetzt häufiger vor, die Variationsbreite ist größer,
Zwischenformen sind häufig.
Gruppe C
Typen Verona (10), Villa Capella (11), Dombovär (13), Garlasco (14), Canegrate (15) und die
Serien Calerno-Scamozzina (9), St. Andrä-Virje (12) und Jorj-Abauy (16).
Die Formen dieser Gruppe sind zwar noch mit jenen der Gruppe B eng verbunden, zeigen aber
meist gewisse Neuerungen, die sich auf Form und Größe der Griffzunge, auf die Nietenstellung
und die Breite der Klinge beziehen.
Gruppe D
Typen Oroszi (17), Bizovac (18) und Tenja (19).
Zusammen mit weiteren Varianten lassen diese Formen kaum mehr enge Beziehungen zu jenen
der Gruppe B erkennen. Griffzunge und häufig auch die Klinge sind kurz und breit, die Zahl der
Nieten ist gewachsen, doch werden diese einigermaßen regelmäßig angebracht (ein bis zwei auf
der Griffzunge, zwei bis vier auf der Heftplatte).
Das Hauptverbreitungsgebiet der Gruppe A (Gorzano, Bertarina, Pertosa) ist das
Dreieck zwischen dem Po, den Apenninen und der adriatischen Küste (vgl. Karte 1,
Taf. 2). Das ist zugleich aber auch das Gebiet der Terremare-Kultur im eigentlichen
Sinne und des mit dieser in engen Beziehungen stehenden nördlichen Teils der Apen-
ninischen Kultur.
Typ Psychro (3) ist nur aus Kreta bekannt geworden, doch wirkt er dort fremd
und stellt wahrscheinlich Importgut aus Mitteleuropa dar. Von den beiden einzigen
außerhalb Kretas bekannt gewordenen Varianten läßt die eine aus Peschiera (Kat.
Nr. 28) an ein Herkommen aus der Po-Ebene denken, die andere von der Scoglio
del Tonno bei Tarent (Kat. Nr. 27) mag den Weg verdeutlichen, auf dem diese
Beziehungen gelaufen sind.
Die in Sizilien gefundenen Dolche vom Typ Gorzano (1) (Kat. Nr. 1) und vom Typ
Pertosa (4) (Kat. Nr. 29—32) sowie das vom namengebenden Fundort Pertosa bei
Renato Pcroni
18. Typ Bizovac (Taf. 1, 22).
In der ungewöhnlichen Breite Typ Oroszi (17) verwandt. Unter der ausladenden Hcftplatte
setzt die breite, gewölbte Klinge an. Ein bis zwei Niete auf der Griffzunge, zwei auf
der Heftplatte.
19. T y p T e n j a (Taf. 1, 23—24).
Relativ breite Griffzunge mit ausladender Heftplatte, dreieckige, etwas eingezogene Klinge.
Auf der Heftplatte meist zwei Niete, gelegentlich auch vier. Ein Niet auf der Griffzunge.
Gewisse, den drei letzten Typen gemeinsame Eigenschaften (vor allem breite kurze
Griffzungen mit drei Nieten, relativ breite Klingen) finden sich auch bei einer Reihe
anderer Dolche, die sich jedoch auf Grund sonstiger Merkmale nur schwer zu ab-
grenzbaren Typen zusammenfassen lassen.
Die unter 1 —19 beschriebenen Typen und Typenserien lassen sich zu folgenden grö-
ßeren Einheiten gruppieren:
Gruppe A
Typen Gorzano (1), Bertarina (2), Psychro (3) und Pertosa (4). Es handelt sich hier vermutlich
um Ausgangsformen, die durch ihren schlanken Umriß, die geringe Variationsbreite und das sel-
tene Vorkommen eines zweiten Niets charakterisierbar sind.
Gruppe B
Typen Vöklabruck (5), Bosisio (6), Donawitz (7) und Merlara (8). Vermutlich handelt es sich
hier um hybride Formen, die unmittelbar aus denen der Gruppe A abzuleiten sind. Der Umriß
ist nicht mehr so schlank, zwei Nieten kommen jetzt häufiger vor, die Variationsbreite ist größer,
Zwischenformen sind häufig.
Gruppe C
Typen Verona (10), Villa Capella (11), Dombovär (13), Garlasco (14), Canegrate (15) und die
Serien Calerno-Scamozzina (9), St. Andrä-Virje (12) und Jorj-Abauy (16).
Die Formen dieser Gruppe sind zwar noch mit jenen der Gruppe B eng verbunden, zeigen aber
meist gewisse Neuerungen, die sich auf Form und Größe der Griffzunge, auf die Nietenstellung
und die Breite der Klinge beziehen.
Gruppe D
Typen Oroszi (17), Bizovac (18) und Tenja (19).
Zusammen mit weiteren Varianten lassen diese Formen kaum mehr enge Beziehungen zu jenen
der Gruppe B erkennen. Griffzunge und häufig auch die Klinge sind kurz und breit, die Zahl der
Nieten ist gewachsen, doch werden diese einigermaßen regelmäßig angebracht (ein bis zwei auf
der Griffzunge, zwei bis vier auf der Heftplatte).
Das Hauptverbreitungsgebiet der Gruppe A (Gorzano, Bertarina, Pertosa) ist das
Dreieck zwischen dem Po, den Apenninen und der adriatischen Küste (vgl. Karte 1,
Taf. 2). Das ist zugleich aber auch das Gebiet der Terremare-Kultur im eigentlichen
Sinne und des mit dieser in engen Beziehungen stehenden nördlichen Teils der Apen-
ninischen Kultur.
Typ Psychro (3) ist nur aus Kreta bekannt geworden, doch wirkt er dort fremd
und stellt wahrscheinlich Importgut aus Mitteleuropa dar. Von den beiden einzigen
außerhalb Kretas bekannt gewordenen Varianten läßt die eine aus Peschiera (Kat.
Nr. 28) an ein Herkommen aus der Po-Ebene denken, die andere von der Scoglio
del Tonno bei Tarent (Kat. Nr. 27) mag den Weg verdeutlichen, auf dem diese
Beziehungen gelaufen sind.
Die in Sizilien gefundenen Dolche vom Typ Gorzano (1) (Kat. Nr. 1) und vom Typ
Pertosa (4) (Kat. Nr. 29—32) sowie das vom namengebenden Fundort Pertosa bei