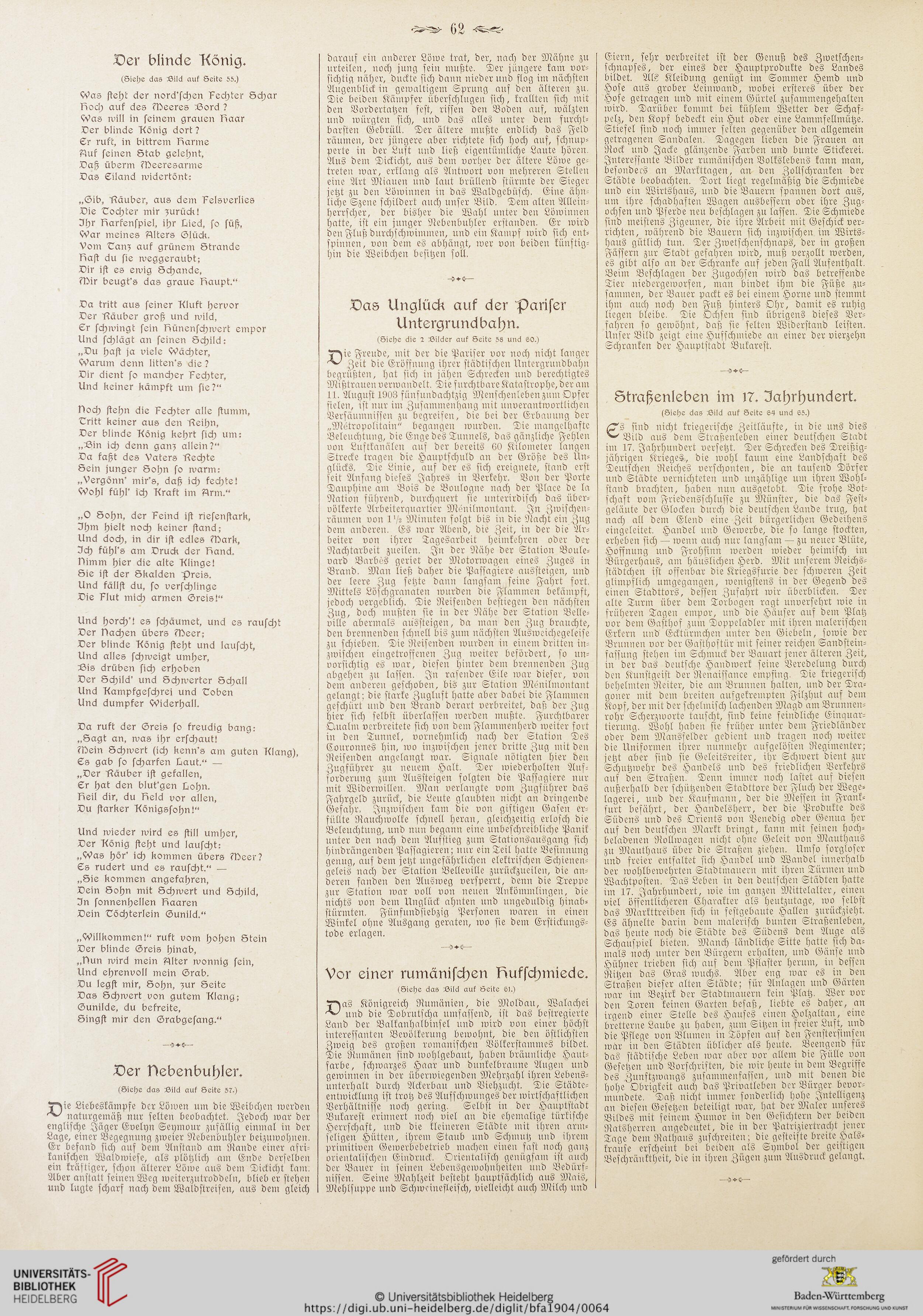Der blinde König.
(Siehe das Bild auf Seite 55.)
Was ſteht der nord'ſchen Fechter Schar
Roch auf des Meeres Sord?
Hyas will in ſeinem grauen Raar
Der blinde König dort?
Er ruft, in bittrem Rarme
Auf feinen Stab gelehnt,
Daß überm Meeresarme
Das Eiland widertönt:
„©ib, Räuber, aus dem Felsverlies
Die Tochter mir zurüchk!
Ihr Rarfenſpiel, ihr Lied, ſo ſüß,
Har meines Alters Glück.
Vom Tanz auf grünem Strande
Raſt du ſie weggeraubt;
Dir iſt es ewig Schande,
Mir beugt's das graue Raupt.“
Da tritt aus ſeiner Kluft hervor
Der Räuber groß und wild,
Er ſchwingt ſein Rünenſchwert empor
Und ſchlägt an ſeinen Schild:
„Du haſt ja viele wächter,
Hyarum denn litten's die?
Dir dient ſo mancher Fechter,
Und keiner kämpft um ſie?“
noch ſtehn die Fechter alle ſtumm,
Tritt keiner aus den Reihn,
Der blinde König kehrt ſich um:
„Bin ich denn ganz allein?“
Da faßt des vaters Rechte
Sein junger Sohn ſo warm-
„vergönn' mir's, daß ich fechte!
Hyohl fühl' ich Kraft im Arm.“
„O Sohn, der Feind iſt rieſenſtark,
Ihm hielt noch keiner ſtand;
Und doch, in dir iſt edles Mark,
Ich fühl's am Druck der Rand.
nimm hier die alte Nlinge!
Sie iſt der Skalden Preis.
Und fällſt du, ſo verſchlinge
Die Flut mich armen Sreis!“
Und horch'! es ſchäumet, und es rauſcht
Der nachen übers Meer;
Der blinde König ſteht und lauſcht,
Und alles ſchweigt umher,
Bis drüben ſich erhoben
Der Schild' und Schwerter Schall
Und Kampfgeſchrei und Toben
Und dumpfer miderhall.
Da ruft der Sreis ſo freudig bang:
„Sagt an, was ihr erſchaut!
Mein Schwert (ich kenn's am guten Klang),
Es gab ſo ſcharfen Laut.“ —
„Der Räuber iſt gefallen,
Er hat den blut'gen Lohn.
Reil dir, du Reld vor allen,
Du ſtarker Königsſohn!“
Und wieder wird es ſtill umher,
Der König ſteht und lauſcht:
„Was hör' ich kommen übers Meer?
Es rudert und es rauſcht.“ —
„Sie kommen angefahren,
Dein Sohn mit Schwert und Schild,
JIn ſonnenhellen Raaren
Dein Töchterlein Sunild.“
„Hvillkommen!“ ruft vom hohen Stein
Der blinde Sreis hinab,
„nun wird mein Alter wonnig ſein,
Und ehrenvoll mein Srab.
Du legſt mir, Sohn, zur Seite
Das Schwert von gutem Klang;
Gunilde, du befreſte,
Singſt mir den Grabgeſang.“
— —
Der Nnebenbuhler.
(Siehe das Bild auf Seite 57.)
Di Liebeskämpfe der Löwen um die Weibchen werden
naturgemäß nur ſelten beobachtet Jedoch war der
engliſche Jäger Evelyn Seymour zufällig einmal in der
Lage, einer Begegnung zweier Nebenbuhler beizuwohnen.
Er hefand ſich auf dem Anſtand am Rande einer afri-
kaniſchen Waldwieſe, als plötzlich am Ende derſelben
ein kräftiger, ſchon älterer Löwe aus dem Dickicht kam-
Aber anſtatt ſeinen Weg weiterzutroddeln, blieb er ſtehen
und lugte ſcharf nach dem Waldſtreifen, aus dem gleich
— 62 —
darauf ein anderer Löwe trat, der, nach der Mähne zu
urteilen, noch jung ſein mußte. Der jüngere kam vor-
ſichtig nähex, Duckte ſich dann nieder und flog im nächſten
Augenblick in gewaltigem Sprung auf den ältexen zu-
Die beiden Kämpfer uͤberſchlugen ſich, krallten ſich mit
und würgten ſich, und das alles unter dem furcht-
barſten Gebrüll. Der ältere mußte endlich das Feld
räumen, der jüngere aber richtete ſich hoch auf, ſchnup-
perte in der Luft und ließ eigentümliche Laute hören.
Aus dem Tickicht, aus dem vorher der ältere Löwe ge-
treten war, erklang als Antwort von mehreren Stellen
eine Art Miauen und laut brüllend ſtürmte der Sieger
jetzt zu den Löwinnen in das Waldgebüſch. Eine ähn-
liche Szene ſchildert auch unſer Bild. Dem alten Allein-
herrſcher, der bisher die Wahl unter den Löwinnen
hatte, iſt ein junger Nebenbuhler erſtanden. Ex wird
den Fluß durchſchwimmen, und ein Kampf wird ſich ent-
ſpinnen, von dem es abhängt, wer von beiden künftig-
hin die Weibchen beſitzen ſoll.
—
Das Unglück auf der Pariſer
Untergrundbahn.
(Siehe die 2 Bilder auf Seite 58 und 60.)
Di Freude, mit der die Paxiſer vor noch nicht langer
Zeit die Eröffnung ihrer ſtädtiſchen Untergrundhahn
begruͤßten, hat ſich in jähen Schrecken und bexechttgtes
Mißtrauen verwandelt. Die furchtbare Kataſtrophe, der am
11. Auguſt 1908 fünfundachtzig Menſchenleben zum Opfer
fielen, iſt nur im Zuſammenhang mit unverantwortlichen
Verſäumniſſen zu begreifen, die bei der Erbauung der
„Métropolitain“ begangen wurden. Die mangelhafte
Beleuchtung, die Enge des Tunnels, das gänzliche Fehlen
von Luftkanälen auf der bereits 60 Kilometer langen
Strecke tragen die Hauptſchuld an der Größe des Un-
glücks. Die Linie, auf der es ſich ereignete, ſtand erſt
feit Anfang dieſes Jahres in Verkehr. Von der Porte
Dauphine am Bois de Boulogne nach der Place de Ia
Nation führend, durchquert ſie unterirdiſch das über-
völkerte Arbeiterquartier Ménilmontant. In Zwiſchen-
räumen von 1' Minuten folgt bis in die Nachk ein Zug
dem anderen. Es war Abend, die Zeit, in der die Ar-
beiter von ihrer Tagesarbeit heimkehren oder der
Nachtarbeit zueilen. In der Nähe der Station Boule-
vard Barbés geriet der Motorwagen eines Zuges in
Brand. Man kieß daher die Paſſagiere ausſteigen, und
der leere Zug ſetzte dann langſam ſeine Fahrt fort.
Mittels Löſchgranaten wurden die Flammen bekämpft,
jedoch vergeblich. Die Reiſenden heſtiegen den nächſten
Zug, doch mußten ſie in der Nähe der Station Belle-
dille abermals ausſteigen, da man den Zug brauchte,
den brennenden ſchnell bis zum nächſten Ausweichegeleiſe
zu ſchieben. Die Reiſenden wurden in einem dritten in-
zwiſchen eingetroffenen Zug weiter befördert, ſo un-
vorſichtig es war, dieſen hinter dem brennenden Zug
abgehen zu laſſen. In raſender Gile war dieſer, von
dem anderen geſchoben, bis zur Station Ménilmontant
gelangt; die ſtarke Zugluft hatte abex dabei die Flammen
geſchürt und den Brand derart verbreitet, daß der Zug
hier ſich ſelbſt überlaſſen werden mußte. Furchtbarer
Qualm verbreitete ſich von dem Flammenherd weiter fort
in den Tunnel, vornehmlich nach der Station Des
Couronnes hin, wo inzwiſchen jener dritte Zug mit den
Reiſenden angelangt war. Signale nötigten hier den
Zugführer zu neuem Halt. Der wiederholten Auf-
forderung zum Ausſteigen folgten die Paſſagiere nur
mit Widerwillen. Man verlangte vom Zugführer das
Fahrgeld zurück, die Leute glaubten nicht an dringende
Gefahr. Inzwiſchen kam die von giftigen Gaſen er-
füllte Rauchwolke ſchnell heran, gleichzeitig erloſch die
unter den nach dem Aufſtieg zum Stationsausgang ſich
hindrängenden Paſſagieren; nur ein Teil hatte Beſinnung
genug, auf dem jetzt ungefährlichen elektriſchen Schienen-
geleis nach der Station Belleville zurückzueilen, die an-
deren fanden den Ausweg verſperrt, denn die Treppe
zur Station war voll von neuen Ankömmlingen, die
nichts von dem Unglück ahnten und ungeduldig hinab-
ſtürmten. Fünfundſtebzig Perſonen waren in einen
Winkel ohne Ausgang geraten, wo ſie dem Erſtickungs-
tode erlagen.
—
vor einer rumäniſchen Rufſchmiede.
(Siehe das Bild auf Seite 6J.)
as Königreich Rumänien, die Moldau, Walachei
und die Dobrutſcha umfaſſend, iſt das beſtregierte
Land der Balkanhalbinſel und wird von einer höchſt
intereſſanten Bevölkerung bewohnt, die den öſtlichſten
Zweig des großen romäniſchen Völkexſtammes bildet.
Die Rumänen ſind wohlgebaut, haben bräunliche Haut-
farbe, ſchwarzes Haar und dunkelbraune Augen und
gewinnen in der überwiegenden Mehrzahl ihren Lebens-
ünterhalt durch Ackerbau und Viehzucht. Die Städte-
entwicklung iſt trotz des Aufſchwunges der wirtſchaftlichen
Verhältniſſe noch gering! Selbjt in der Hauptſtadt
Bukareſt erinnerk noch viel an die ehemalige türkiſche
Herrſchaft, und die kleineren Städte mit ihren arm-
feligen Hütten, ihrem Staub und Schmutz und ihrem
primitiven Gewerbebetrieb machen einen faſt noch ganz
drientaliſchen Eindruck. Orientaliſch genügſam iſt auch
der Bauer in ſeinen Lebensgewohnhetten und Bedürf-
niſſen. Seine Mahlzeit beſteht hauptſächlich aus Mais,
Mehlſuppe und Schweinefleiſch, vielleicht auch Milch und
Fiern, ſehr verbreitet iſt der Genuß des Zwetſchen-
ſchnapſes, der eines der Hauptprodukte des Landes
bildet. Als Kleidung genügt im Sommer Hemd und
Hoſe aus grober Leinwand, wobei erſteres über der
wird. Darüber kommt bei kühlem Wetter der Schaf-
pelz, den Kopf hedeckt ein Hut oder eine Lammfellmütze.
Stiefel ſind noch immer ſelten gegenüber den allgemein
getragenen Sandalen. Dagegen lieben die Frauen an
Vock und Jacke glänzende Farben und buntẽ Stickerei-
Intereſſante Bilder rumäniſchen Volkslebens kann man,
beſonders an Markttagen, an den Zollſchranken der
Städte beobachten. Dort liegt regelmäßig die Schmiede
und ein Wirtshaus, und die Bauern ſpannen dort aus,
um ihre ſchadhaften Wagen ausbeſſern oder ihre Zug-
ochſen und Pferde neu beſchlagen zu laſſen. Die Schmiede
ſind meiſtens Zigeuner, die ihre Arbeit mit Geſchick ver-
richten, während die Bauern ſich inzwiſchen im Wirts-
haus gütlich tun. Der Zwetſchenſchnaps, der in großen
Fäſſern zur Stadt gefahren wird, muß verzollt werden,
ez gibt alſo an der Schranke auf jeden Fall Aufenthalt.
Beim Beſchlagen der Zugochſen wird das betreffende
Tier niedergeworfen, man bindet ihm die Füße zu-
ſammen, der Bauer packt es bei einem Horne und ſtemmt
ihm auch noch den Fuß hinters Ohr, damit es ruhig
liegen bleibe. Die Ochſen ſind übrigens dieſes Ver-
fahren ſo gewöhnt, daß ſie ſelten Widerſtand leiſten.
Unſer Bild zeigt eine Hufſchmiede an einer der vierzehn
Schranken der Hauptſtadt Bukareſt.
—
Straßenleben im N. Jahrhundert.
(Siehe das Sild auf Seite 64 und 65.)
ſind nicht kriegeriſche Zeitläufte, in die uns dies
Bild aus dem Straßenleben einer deutſchen Stadt
im 17. Jahrhundert verſetzt. Der Schrecken des Dreißig-
jährigen Krieges, die wohl kaum eine Landſchaft des
Deutfchen Reiches verſchonten, die an tauſend Dörfer
und Städte vernichteten und unzählige um ihren Wohl-
ſtand brachten, haben nun ausgetobt. Die frohe Bot-
ſchaft vom Friedensſchluſſe zu Münſter, die das Feſt-
geläute der Glocken durch die deutſchen Lande trug, hat
nach all dem Elend eine Zeit büxgerlichen Gedeihens
eingeleitet. Handel und Gewerbe, die ſo lange ſtockten,
erheben ſich wenn auch nur langſam — zu neuer Blüte,
Hoffnung und Frohſinn werden wieder heimiſch im
Bürgerhaus, anı häuslichen Herd. Mit unſerem Reichs-
ſtädichen iſt offenbar die Kriegsfurie dex ſchweren Zeit
glimpflich umgegangen, wenigſtens in der Gegend des
einen Stadttors, deſſen Zufahrt wir überblicken. Der -
alte Turm über dem Torbogen ragt unverſehrt wie in
früheren Tagen empor, und die Häuſer auf dem Platz
vor dem Gaſthof zum Doppeladler mit ihren maleriſchen
Erkern und Ecktürmchen unter den Giebeln, ſowie der
Brunnen vor der Gaſthoftür mit ſeiner reichen Sandſtein-
faſſung ſtehen im Schmuck der Bauart jener älteren Zeit,
in der das deutſche Handwerk ſeine Veredelung durch
den Kunſtgeiſt der Renaiſſance empfing. Die kriegexiſch
behelmten Reiter, die am Brunnen halten, und der Dra-
goner mit dem breiten aufgekrempten Filzhut auf dem
Kopf, der mit der ſchelmiſch lachenden Magd am Brunnen-
rohr Scherzworte tauſcht, ſind keine feindliche Einquar-
tierung. Wohl haben fie früher unter dem Friedländer
oder dem Mansfelder gedient und tragen noch weiter
die Uniformen ihrex nunmehr aufgelöſten Regimenter;
jetzt aber ſind ſie Geleitsreiter, ihr Schwert dient zux
Schutzwehr des Handels und des friedlichen Vexkehrs
auf den Straßen Denn immer noch laſtet auf dieſen
außerhalb der ſchützenden Stadttore der Fluch der Wege-
lagerei, und der Kaufmann, der die Meſſen in Frank-
furt befährt, der Handelsherr, der die Produkte des
Suͤdens und des Orients von Venedig oder Genug her
auf den deutſchen Markt bringt, kann mit feinen hoch-
beladenen Rollwagen nicht ohne Geleit von Mauthaus
zu Mauthaus über die Straßen ziehen. Umſo ſorgloſer
und freier entfaltet ſich Handel und Wandel innerhalb
der wohlbewehrten Stadtmauern mit ihren Türmen und
Wachtpoͤſten. Das Leben in den deutſchen Städten hatte
im 17. Jahrhundert, wie im ganzen Mittelalter, einen
viel öffentlicheren Chaxaktex äls heutzutage, wo ſelbſt
das Markttreiben ſich in feſtgebaute Hallen zurückzieht.
S3 ähnelte darin dem malekiſch bunten Straßenleben,
das heute noch die Städte des Südens dem Auge als
Schauſpiel bieten. Manch ländliche Sitte hHatte ſich da-
mals noch unter den Bürgern erhalten, und Gänſe und
Hühner trieben ſich auf dem Pflaſter herum, in. deſſen
NRigen das Gras wuchs. Aber eng war es in den
Straßen dieſer alten Städte; für Anlagen und Härten
war im Bezirk der Stadtmauern kein Platz Wer vor
den Toren keinen Garten beſaß, liebte e& daher, an
irgend einer Stelle des Hauſes einen Holzaltan, eine
bretterne Laubè zu haben, zum Sitzen in freier Luft und
die Pflege von Blumen in Töpfen auf den Fenſterſumſen
waͤr in den Staͤdten üblicher als heute. Beengend für
das ſtädtiſche Leben war aͤber vor allem die Fülle ven
Geſetzen und Vorſchriften, die wir heute in dem Begriffe
des Zunftowangs zuſammenfaſſen, und mit denen die
hohe Sorigkeit auch das Privatleben dex Bürger bevor-
mundete. Daß nicht immer ſonderlich hohe Intelligenz
an diefen Gefetzen beteiligt war, hat dex Maler unſeres
Bildes mit feinem Humor in den Geſichkexn der beiden
Ratsherren angedeutet, die in der Patetziertracht jener
Tage dem Rathaus zuſchreiten; Ddie geſteifte breite Hals-
fraufe erſcheint bei heiden als Symbol der geijtigen
Beſchränktheit, die in ihren Zügen zum Ausdruck gelangt.
—
(Siehe das Bild auf Seite 55.)
Was ſteht der nord'ſchen Fechter Schar
Roch auf des Meeres Sord?
Hyas will in ſeinem grauen Raar
Der blinde König dort?
Er ruft, in bittrem Rarme
Auf feinen Stab gelehnt,
Daß überm Meeresarme
Das Eiland widertönt:
„©ib, Räuber, aus dem Felsverlies
Die Tochter mir zurüchk!
Ihr Rarfenſpiel, ihr Lied, ſo ſüß,
Har meines Alters Glück.
Vom Tanz auf grünem Strande
Raſt du ſie weggeraubt;
Dir iſt es ewig Schande,
Mir beugt's das graue Raupt.“
Da tritt aus ſeiner Kluft hervor
Der Räuber groß und wild,
Er ſchwingt ſein Rünenſchwert empor
Und ſchlägt an ſeinen Schild:
„Du haſt ja viele wächter,
Hyarum denn litten's die?
Dir dient ſo mancher Fechter,
Und keiner kämpft um ſie?“
noch ſtehn die Fechter alle ſtumm,
Tritt keiner aus den Reihn,
Der blinde König kehrt ſich um:
„Bin ich denn ganz allein?“
Da faßt des vaters Rechte
Sein junger Sohn ſo warm-
„vergönn' mir's, daß ich fechte!
Hyohl fühl' ich Kraft im Arm.“
„O Sohn, der Feind iſt rieſenſtark,
Ihm hielt noch keiner ſtand;
Und doch, in dir iſt edles Mark,
Ich fühl's am Druck der Rand.
nimm hier die alte Nlinge!
Sie iſt der Skalden Preis.
Und fällſt du, ſo verſchlinge
Die Flut mich armen Sreis!“
Und horch'! es ſchäumet, und es rauſcht
Der nachen übers Meer;
Der blinde König ſteht und lauſcht,
Und alles ſchweigt umher,
Bis drüben ſich erhoben
Der Schild' und Schwerter Schall
Und Kampfgeſchrei und Toben
Und dumpfer miderhall.
Da ruft der Sreis ſo freudig bang:
„Sagt an, was ihr erſchaut!
Mein Schwert (ich kenn's am guten Klang),
Es gab ſo ſcharfen Laut.“ —
„Der Räuber iſt gefallen,
Er hat den blut'gen Lohn.
Reil dir, du Reld vor allen,
Du ſtarker Königsſohn!“
Und wieder wird es ſtill umher,
Der König ſteht und lauſcht:
„Was hör' ich kommen übers Meer?
Es rudert und es rauſcht.“ —
„Sie kommen angefahren,
Dein Sohn mit Schwert und Schild,
JIn ſonnenhellen Raaren
Dein Töchterlein Sunild.“
„Hvillkommen!“ ruft vom hohen Stein
Der blinde Sreis hinab,
„nun wird mein Alter wonnig ſein,
Und ehrenvoll mein Srab.
Du legſt mir, Sohn, zur Seite
Das Schwert von gutem Klang;
Gunilde, du befreſte,
Singſt mir den Grabgeſang.“
— —
Der Nnebenbuhler.
(Siehe das Bild auf Seite 57.)
Di Liebeskämpfe der Löwen um die Weibchen werden
naturgemäß nur ſelten beobachtet Jedoch war der
engliſche Jäger Evelyn Seymour zufällig einmal in der
Lage, einer Begegnung zweier Nebenbuhler beizuwohnen.
Er hefand ſich auf dem Anſtand am Rande einer afri-
kaniſchen Waldwieſe, als plötzlich am Ende derſelben
ein kräftiger, ſchon älterer Löwe aus dem Dickicht kam-
Aber anſtatt ſeinen Weg weiterzutroddeln, blieb er ſtehen
und lugte ſcharf nach dem Waldſtreifen, aus dem gleich
— 62 —
darauf ein anderer Löwe trat, der, nach der Mähne zu
urteilen, noch jung ſein mußte. Der jüngere kam vor-
ſichtig nähex, Duckte ſich dann nieder und flog im nächſten
Augenblick in gewaltigem Sprung auf den ältexen zu-
Die beiden Kämpfer uͤberſchlugen ſich, krallten ſich mit
und würgten ſich, und das alles unter dem furcht-
barſten Gebrüll. Der ältere mußte endlich das Feld
räumen, der jüngere aber richtete ſich hoch auf, ſchnup-
perte in der Luft und ließ eigentümliche Laute hören.
Aus dem Tickicht, aus dem vorher der ältere Löwe ge-
treten war, erklang als Antwort von mehreren Stellen
eine Art Miauen und laut brüllend ſtürmte der Sieger
jetzt zu den Löwinnen in das Waldgebüſch. Eine ähn-
liche Szene ſchildert auch unſer Bild. Dem alten Allein-
herrſcher, der bisher die Wahl unter den Löwinnen
hatte, iſt ein junger Nebenbuhler erſtanden. Ex wird
den Fluß durchſchwimmen, und ein Kampf wird ſich ent-
ſpinnen, von dem es abhängt, wer von beiden künftig-
hin die Weibchen beſitzen ſoll.
—
Das Unglück auf der Pariſer
Untergrundbahn.
(Siehe die 2 Bilder auf Seite 58 und 60.)
Di Freude, mit der die Paxiſer vor noch nicht langer
Zeit die Eröffnung ihrer ſtädtiſchen Untergrundhahn
begruͤßten, hat ſich in jähen Schrecken und bexechttgtes
Mißtrauen verwandelt. Die furchtbare Kataſtrophe, der am
11. Auguſt 1908 fünfundachtzig Menſchenleben zum Opfer
fielen, iſt nur im Zuſammenhang mit unverantwortlichen
Verſäumniſſen zu begreifen, die bei der Erbauung der
„Métropolitain“ begangen wurden. Die mangelhafte
Beleuchtung, die Enge des Tunnels, das gänzliche Fehlen
von Luftkanälen auf der bereits 60 Kilometer langen
Strecke tragen die Hauptſchuld an der Größe des Un-
glücks. Die Linie, auf der es ſich ereignete, ſtand erſt
feit Anfang dieſes Jahres in Verkehr. Von der Porte
Dauphine am Bois de Boulogne nach der Place de Ia
Nation führend, durchquert ſie unterirdiſch das über-
völkerte Arbeiterquartier Ménilmontant. In Zwiſchen-
räumen von 1' Minuten folgt bis in die Nachk ein Zug
dem anderen. Es war Abend, die Zeit, in der die Ar-
beiter von ihrer Tagesarbeit heimkehren oder der
Nachtarbeit zueilen. In der Nähe der Station Boule-
vard Barbés geriet der Motorwagen eines Zuges in
Brand. Man kieß daher die Paſſagiere ausſteigen, und
der leere Zug ſetzte dann langſam ſeine Fahrt fort.
Mittels Löſchgranaten wurden die Flammen bekämpft,
jedoch vergeblich. Die Reiſenden heſtiegen den nächſten
Zug, doch mußten ſie in der Nähe der Station Belle-
dille abermals ausſteigen, da man den Zug brauchte,
den brennenden ſchnell bis zum nächſten Ausweichegeleiſe
zu ſchieben. Die Reiſenden wurden in einem dritten in-
zwiſchen eingetroffenen Zug weiter befördert, ſo un-
vorſichtig es war, dieſen hinter dem brennenden Zug
abgehen zu laſſen. In raſender Gile war dieſer, von
dem anderen geſchoben, bis zur Station Ménilmontant
gelangt; die ſtarke Zugluft hatte abex dabei die Flammen
geſchürt und den Brand derart verbreitet, daß der Zug
hier ſich ſelbſt überlaſſen werden mußte. Furchtbarer
Qualm verbreitete ſich von dem Flammenherd weiter fort
in den Tunnel, vornehmlich nach der Station Des
Couronnes hin, wo inzwiſchen jener dritte Zug mit den
Reiſenden angelangt war. Signale nötigten hier den
Zugführer zu neuem Halt. Der wiederholten Auf-
forderung zum Ausſteigen folgten die Paſſagiere nur
mit Widerwillen. Man verlangte vom Zugführer das
Fahrgeld zurück, die Leute glaubten nicht an dringende
Gefahr. Inzwiſchen kam die von giftigen Gaſen er-
füllte Rauchwolke ſchnell heran, gleichzeitig erloſch die
unter den nach dem Aufſtieg zum Stationsausgang ſich
hindrängenden Paſſagieren; nur ein Teil hatte Beſinnung
genug, auf dem jetzt ungefährlichen elektriſchen Schienen-
geleis nach der Station Belleville zurückzueilen, die an-
deren fanden den Ausweg verſperrt, denn die Treppe
zur Station war voll von neuen Ankömmlingen, die
nichts von dem Unglück ahnten und ungeduldig hinab-
ſtürmten. Fünfundſtebzig Perſonen waren in einen
Winkel ohne Ausgang geraten, wo ſie dem Erſtickungs-
tode erlagen.
—
vor einer rumäniſchen Rufſchmiede.
(Siehe das Bild auf Seite 6J.)
as Königreich Rumänien, die Moldau, Walachei
und die Dobrutſcha umfaſſend, iſt das beſtregierte
Land der Balkanhalbinſel und wird von einer höchſt
intereſſanten Bevölkerung bewohnt, die den öſtlichſten
Zweig des großen romäniſchen Völkexſtammes bildet.
Die Rumänen ſind wohlgebaut, haben bräunliche Haut-
farbe, ſchwarzes Haar und dunkelbraune Augen und
gewinnen in der überwiegenden Mehrzahl ihren Lebens-
ünterhalt durch Ackerbau und Viehzucht. Die Städte-
entwicklung iſt trotz des Aufſchwunges der wirtſchaftlichen
Verhältniſſe noch gering! Selbjt in der Hauptſtadt
Bukareſt erinnerk noch viel an die ehemalige türkiſche
Herrſchaft, und die kleineren Städte mit ihren arm-
feligen Hütten, ihrem Staub und Schmutz und ihrem
primitiven Gewerbebetrieb machen einen faſt noch ganz
drientaliſchen Eindruck. Orientaliſch genügſam iſt auch
der Bauer in ſeinen Lebensgewohnhetten und Bedürf-
niſſen. Seine Mahlzeit beſteht hauptſächlich aus Mais,
Mehlſuppe und Schweinefleiſch, vielleicht auch Milch und
Fiern, ſehr verbreitet iſt der Genuß des Zwetſchen-
ſchnapſes, der eines der Hauptprodukte des Landes
bildet. Als Kleidung genügt im Sommer Hemd und
Hoſe aus grober Leinwand, wobei erſteres über der
wird. Darüber kommt bei kühlem Wetter der Schaf-
pelz, den Kopf hedeckt ein Hut oder eine Lammfellmütze.
Stiefel ſind noch immer ſelten gegenüber den allgemein
getragenen Sandalen. Dagegen lieben die Frauen an
Vock und Jacke glänzende Farben und buntẽ Stickerei-
Intereſſante Bilder rumäniſchen Volkslebens kann man,
beſonders an Markttagen, an den Zollſchranken der
Städte beobachten. Dort liegt regelmäßig die Schmiede
und ein Wirtshaus, und die Bauern ſpannen dort aus,
um ihre ſchadhaften Wagen ausbeſſern oder ihre Zug-
ochſen und Pferde neu beſchlagen zu laſſen. Die Schmiede
ſind meiſtens Zigeuner, die ihre Arbeit mit Geſchick ver-
richten, während die Bauern ſich inzwiſchen im Wirts-
haus gütlich tun. Der Zwetſchenſchnaps, der in großen
Fäſſern zur Stadt gefahren wird, muß verzollt werden,
ez gibt alſo an der Schranke auf jeden Fall Aufenthalt.
Beim Beſchlagen der Zugochſen wird das betreffende
Tier niedergeworfen, man bindet ihm die Füße zu-
ſammen, der Bauer packt es bei einem Horne und ſtemmt
ihm auch noch den Fuß hinters Ohr, damit es ruhig
liegen bleibe. Die Ochſen ſind übrigens dieſes Ver-
fahren ſo gewöhnt, daß ſie ſelten Widerſtand leiſten.
Unſer Bild zeigt eine Hufſchmiede an einer der vierzehn
Schranken der Hauptſtadt Bukareſt.
—
Straßenleben im N. Jahrhundert.
(Siehe das Sild auf Seite 64 und 65.)
ſind nicht kriegeriſche Zeitläufte, in die uns dies
Bild aus dem Straßenleben einer deutſchen Stadt
im 17. Jahrhundert verſetzt. Der Schrecken des Dreißig-
jährigen Krieges, die wohl kaum eine Landſchaft des
Deutfchen Reiches verſchonten, die an tauſend Dörfer
und Städte vernichteten und unzählige um ihren Wohl-
ſtand brachten, haben nun ausgetobt. Die frohe Bot-
ſchaft vom Friedensſchluſſe zu Münſter, die das Feſt-
geläute der Glocken durch die deutſchen Lande trug, hat
nach all dem Elend eine Zeit büxgerlichen Gedeihens
eingeleitet. Handel und Gewerbe, die ſo lange ſtockten,
erheben ſich wenn auch nur langſam — zu neuer Blüte,
Hoffnung und Frohſinn werden wieder heimiſch im
Bürgerhaus, anı häuslichen Herd. Mit unſerem Reichs-
ſtädichen iſt offenbar die Kriegsfurie dex ſchweren Zeit
glimpflich umgegangen, wenigſtens in der Gegend des
einen Stadttors, deſſen Zufahrt wir überblicken. Der -
alte Turm über dem Torbogen ragt unverſehrt wie in
früheren Tagen empor, und die Häuſer auf dem Platz
vor dem Gaſthof zum Doppeladler mit ihren maleriſchen
Erkern und Ecktürmchen unter den Giebeln, ſowie der
Brunnen vor der Gaſthoftür mit ſeiner reichen Sandſtein-
faſſung ſtehen im Schmuck der Bauart jener älteren Zeit,
in der das deutſche Handwerk ſeine Veredelung durch
den Kunſtgeiſt der Renaiſſance empfing. Die kriegexiſch
behelmten Reiter, die am Brunnen halten, und der Dra-
goner mit dem breiten aufgekrempten Filzhut auf dem
Kopf, der mit der ſchelmiſch lachenden Magd am Brunnen-
rohr Scherzworte tauſcht, ſind keine feindliche Einquar-
tierung. Wohl haben fie früher unter dem Friedländer
oder dem Mansfelder gedient und tragen noch weiter
die Uniformen ihrex nunmehr aufgelöſten Regimenter;
jetzt aber ſind ſie Geleitsreiter, ihr Schwert dient zux
Schutzwehr des Handels und des friedlichen Vexkehrs
auf den Straßen Denn immer noch laſtet auf dieſen
außerhalb der ſchützenden Stadttore der Fluch der Wege-
lagerei, und der Kaufmann, der die Meſſen in Frank-
furt befährt, der Handelsherr, der die Produkte des
Suͤdens und des Orients von Venedig oder Genug her
auf den deutſchen Markt bringt, kann mit feinen hoch-
beladenen Rollwagen nicht ohne Geleit von Mauthaus
zu Mauthaus über die Straßen ziehen. Umſo ſorgloſer
und freier entfaltet ſich Handel und Wandel innerhalb
der wohlbewehrten Stadtmauern mit ihren Türmen und
Wachtpoͤſten. Das Leben in den deutſchen Städten hatte
im 17. Jahrhundert, wie im ganzen Mittelalter, einen
viel öffentlicheren Chaxaktex äls heutzutage, wo ſelbſt
das Markttreiben ſich in feſtgebaute Hallen zurückzieht.
S3 ähnelte darin dem malekiſch bunten Straßenleben,
das heute noch die Städte des Südens dem Auge als
Schauſpiel bieten. Manch ländliche Sitte hHatte ſich da-
mals noch unter den Bürgern erhalten, und Gänſe und
Hühner trieben ſich auf dem Pflaſter herum, in. deſſen
NRigen das Gras wuchs. Aber eng war es in den
Straßen dieſer alten Städte; für Anlagen und Härten
war im Bezirk der Stadtmauern kein Platz Wer vor
den Toren keinen Garten beſaß, liebte e& daher, an
irgend einer Stelle des Hauſes einen Holzaltan, eine
bretterne Laubè zu haben, zum Sitzen in freier Luft und
die Pflege von Blumen in Töpfen auf den Fenſterſumſen
waͤr in den Staͤdten üblicher als heute. Beengend für
das ſtädtiſche Leben war aͤber vor allem die Fülle ven
Geſetzen und Vorſchriften, die wir heute in dem Begriffe
des Zunftowangs zuſammenfaſſen, und mit denen die
hohe Sorigkeit auch das Privatleben dex Bürger bevor-
mundete. Daß nicht immer ſonderlich hohe Intelligenz
an diefen Gefetzen beteiligt war, hat dex Maler unſeres
Bildes mit feinem Humor in den Geſichkexn der beiden
Ratsherren angedeutet, die in der Patetziertracht jener
Tage dem Rathaus zuſchreiten; Ddie geſteifte breite Hals-
fraufe erſcheint bei heiden als Symbol der geijtigen
Beſchränktheit, die in ihren Zügen zum Ausdruck gelangt.
—