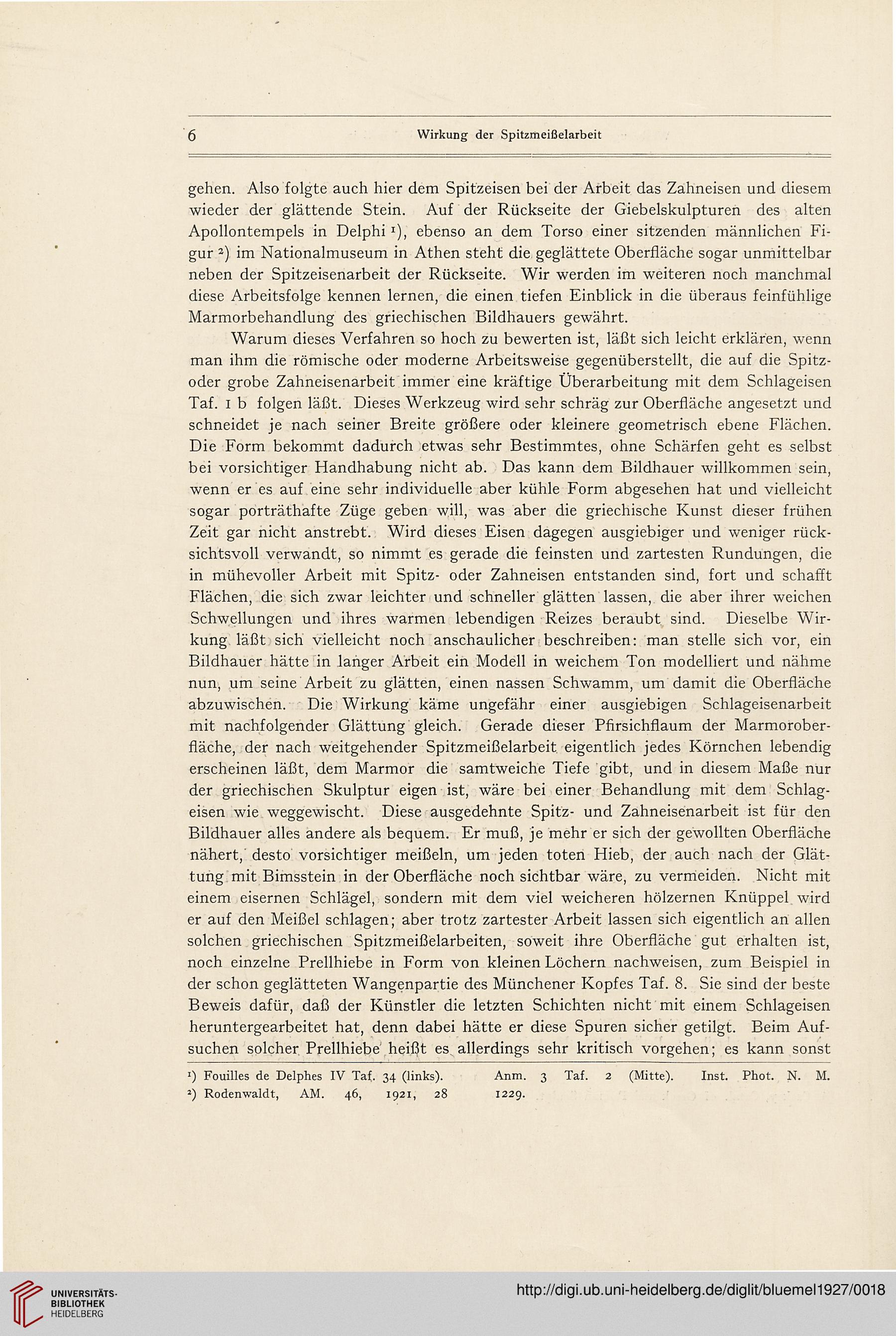6
Wirkung der Spitzmeißelarbeit
gehen. Also folgte auch hier dem Spitzeisen bei der Arbeit das Zahneisen und diesem
wieder der glättende Stein. Auf der Rückseite der Giebelskulpturen des alten
Apollontempels in Delphir), ebenso an dem Torso einer sitzenden männlichen Fi-
gur * 2) im Nationalmuseum in Athen steht die geglättete Oberfläche sogar unmittelbar
neben der Spitzeisenarbeit der Rückseite. Wir werden im weiteren noch manchmal
diese Arbeitsfolge kennen lernen, die einen tiefen Einblick in die überaus feinfühlige
Marmorbehandlung des griechischen Bildhauers gewährt.
Warum dieses Verfahren so hoch zu bewerten ist, läßt sich leicht erklären, wenn
man ihm die römische oder moderne Arbeitsweise gegenüberstellt, die auf die Spitz-
oder grobe Zahneisenarbeit immer eine kräftige Überarbeitung mit dem Schlageisen
Taf. i b folgen läßt. Dieses Werkzeug wird sehr schräg zur Oberfläche angesetzt und
schneidet je nach seiner Breite größere oder kleinere geometrisch ebene Flächen.
Die Form bekommt dadurch etwas sehr Bestimmtes, ohne Schärfen geht es selbst
bei vorsichtiger Handhabung nicht ab. Das kann dem Bildhauer willkommen sein,
wenn er es auf eine sehr individuelle aber kühle Form abgesehen hat und vielleicht
sogar porträthafte Züge geben will, was aber die griechische Kunst dieser frühen
Zeit gar nicht anstrebt. Wird dieses Eisen dagegen ausgiebiger und weniger rück-
sichtsvoll verwandt, so nimmt es gerade die feinsten und zartesten Rundungen, die
in mühevoller Arbeit mit Spitz- oder Zahneisen entstanden sind, fort und schafft
Flächen, die sich zwar leichter und schneller glätten lassen, die aber ihrer weichen
Schwellungen und ihres warmen lebendigen Reizes beraubt sind. Dieselbe Wir-
kung läßt sich vielleicht noch anschaulicher beschreiben: man stelle sich vor, ein
Bildhauer hätte in langer Arbeit ein Modell in weichem Ton modelliert und nähme
nun, um seine Arbeit zu glätten, einen nassen Schwamm, um damit die Oberfläche
abzuwischen. Die Wirkung käme ungefähr einer ausgiebigen Schlageisenarbeit
mit nachfolgender Glättung gleich. Gerade dieser Pfirsichflaum der Marmorober-
fläche, der nach weitgehender Spitzmeißelarbeit eigentlich jedes Körnchen lebendig
erscheinen läßt, dem Marmor die samtweiche Tiefe gibt, und in diesem Maße nur
der griechischen Skulptur eigen ist, wäre bei einer Behandlung mit dem Schlag-
eisen wie weggewischt. Diese ausgedehnte Spitz- und Zahneisenarbeit ist für den
Bildhauer alles andere als bequem. Er muß, je mehr er sich der gewollten Oberfläche
nähert, desto vorsichtiger meißeln, um jeden toten Hieb, der auch nach der Glät-
tung mit Bimsstein in der Oberfläche noch sichtbar wäre, zu vermeiden. Nicht mit
einem eisernen Schlägel, sondern mit dem viel weicheren hölzernen Knüppel wird
er auf den Meißel schlagen; aber trotz zartester Arbeit lassen sich eigentlich an allen
solchen griechischen Spitzmeißelarbeiten, soweit ihre Oberfläche gut erhalten ist,
noch einzelne Prellhiebe in Form von kleinen Löchern nachweisen, zum Beispiel in
der schon geglätteten Wangenpartie des Münchener Kopfes Taf. 8. Sie sind der beste
Beweis dafür, daß der Künstler die letzten Schichten nicht mit einem Schlageisen
heruntergearbeitet hat, denn dabei hätte er diese Spuren sicher getilgt. Beim Auf-
suchen solcher Prellhiebe heißt es allerdings sehr kritisch vorgehen; es kann sonst
') Fouilles de Delphes IV Taf. 34 (links). Anm. 3 Taf. 2 (Mitte). Inst. Phot. N. M.
2) Rodenwaldt, AM. 46, 1921, 28 1229.
Wirkung der Spitzmeißelarbeit
gehen. Also folgte auch hier dem Spitzeisen bei der Arbeit das Zahneisen und diesem
wieder der glättende Stein. Auf der Rückseite der Giebelskulpturen des alten
Apollontempels in Delphir), ebenso an dem Torso einer sitzenden männlichen Fi-
gur * 2) im Nationalmuseum in Athen steht die geglättete Oberfläche sogar unmittelbar
neben der Spitzeisenarbeit der Rückseite. Wir werden im weiteren noch manchmal
diese Arbeitsfolge kennen lernen, die einen tiefen Einblick in die überaus feinfühlige
Marmorbehandlung des griechischen Bildhauers gewährt.
Warum dieses Verfahren so hoch zu bewerten ist, läßt sich leicht erklären, wenn
man ihm die römische oder moderne Arbeitsweise gegenüberstellt, die auf die Spitz-
oder grobe Zahneisenarbeit immer eine kräftige Überarbeitung mit dem Schlageisen
Taf. i b folgen läßt. Dieses Werkzeug wird sehr schräg zur Oberfläche angesetzt und
schneidet je nach seiner Breite größere oder kleinere geometrisch ebene Flächen.
Die Form bekommt dadurch etwas sehr Bestimmtes, ohne Schärfen geht es selbst
bei vorsichtiger Handhabung nicht ab. Das kann dem Bildhauer willkommen sein,
wenn er es auf eine sehr individuelle aber kühle Form abgesehen hat und vielleicht
sogar porträthafte Züge geben will, was aber die griechische Kunst dieser frühen
Zeit gar nicht anstrebt. Wird dieses Eisen dagegen ausgiebiger und weniger rück-
sichtsvoll verwandt, so nimmt es gerade die feinsten und zartesten Rundungen, die
in mühevoller Arbeit mit Spitz- oder Zahneisen entstanden sind, fort und schafft
Flächen, die sich zwar leichter und schneller glätten lassen, die aber ihrer weichen
Schwellungen und ihres warmen lebendigen Reizes beraubt sind. Dieselbe Wir-
kung läßt sich vielleicht noch anschaulicher beschreiben: man stelle sich vor, ein
Bildhauer hätte in langer Arbeit ein Modell in weichem Ton modelliert und nähme
nun, um seine Arbeit zu glätten, einen nassen Schwamm, um damit die Oberfläche
abzuwischen. Die Wirkung käme ungefähr einer ausgiebigen Schlageisenarbeit
mit nachfolgender Glättung gleich. Gerade dieser Pfirsichflaum der Marmorober-
fläche, der nach weitgehender Spitzmeißelarbeit eigentlich jedes Körnchen lebendig
erscheinen läßt, dem Marmor die samtweiche Tiefe gibt, und in diesem Maße nur
der griechischen Skulptur eigen ist, wäre bei einer Behandlung mit dem Schlag-
eisen wie weggewischt. Diese ausgedehnte Spitz- und Zahneisenarbeit ist für den
Bildhauer alles andere als bequem. Er muß, je mehr er sich der gewollten Oberfläche
nähert, desto vorsichtiger meißeln, um jeden toten Hieb, der auch nach der Glät-
tung mit Bimsstein in der Oberfläche noch sichtbar wäre, zu vermeiden. Nicht mit
einem eisernen Schlägel, sondern mit dem viel weicheren hölzernen Knüppel wird
er auf den Meißel schlagen; aber trotz zartester Arbeit lassen sich eigentlich an allen
solchen griechischen Spitzmeißelarbeiten, soweit ihre Oberfläche gut erhalten ist,
noch einzelne Prellhiebe in Form von kleinen Löchern nachweisen, zum Beispiel in
der schon geglätteten Wangenpartie des Münchener Kopfes Taf. 8. Sie sind der beste
Beweis dafür, daß der Künstler die letzten Schichten nicht mit einem Schlageisen
heruntergearbeitet hat, denn dabei hätte er diese Spuren sicher getilgt. Beim Auf-
suchen solcher Prellhiebe heißt es allerdings sehr kritisch vorgehen; es kann sonst
') Fouilles de Delphes IV Taf. 34 (links). Anm. 3 Taf. 2 (Mitte). Inst. Phot. N. M.
2) Rodenwaldt, AM. 46, 1921, 28 1229.