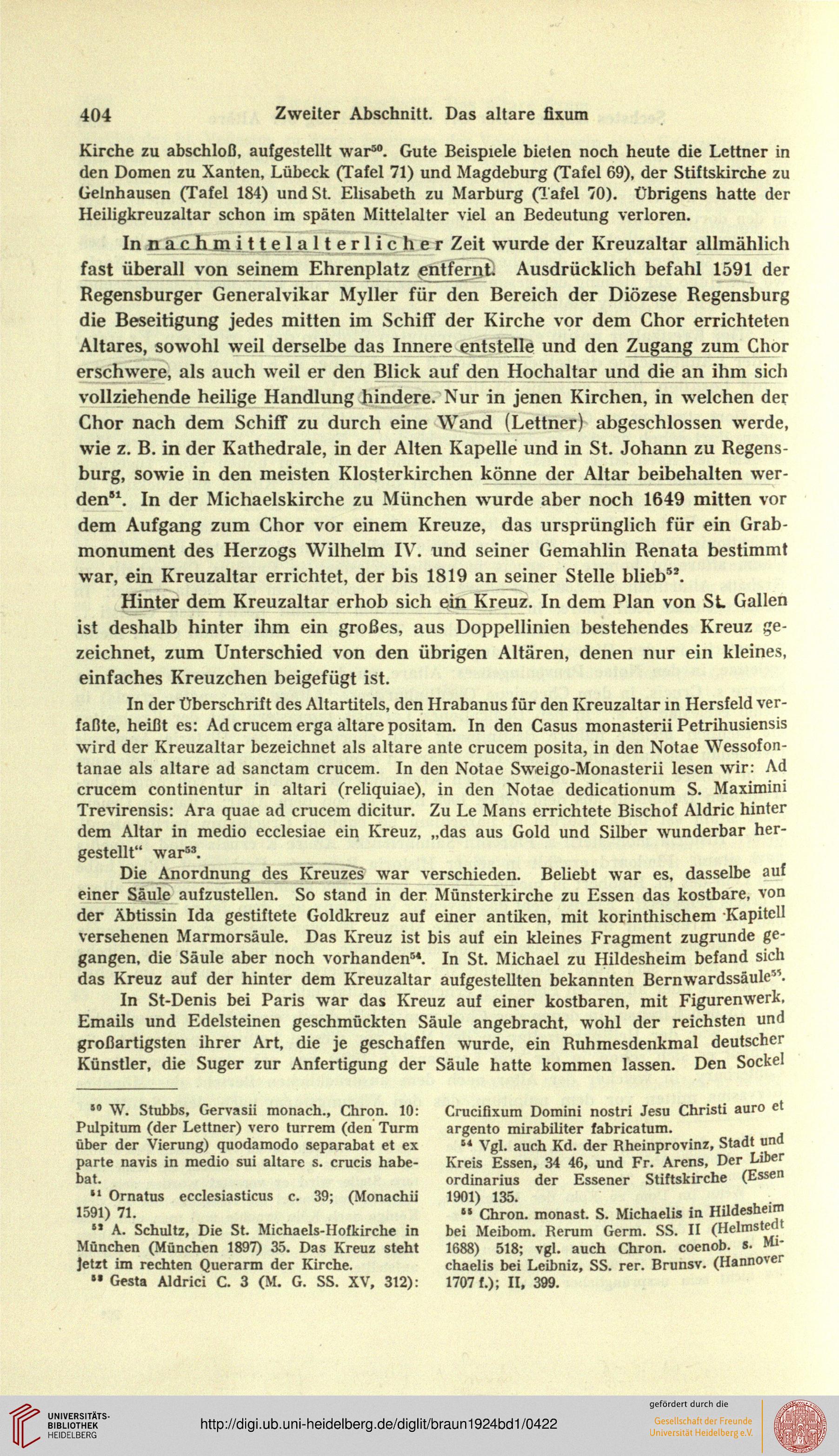404 Zweiter Abschnitt. Das altare fixum
Kirche zu abschloO, aufgestellt war50. Gute Beispiele bieten noch heute die Lettner in
den Domen zu Xanten, Lübeck (Tafel 71) und Magdeburg (Tafel 69), der Stiftskirche zu
Gelnhausen (Tafel 184) und St. Elisabeth zu Marburg (Tafel 70). Übrigens hatte der
Heiligkreuzaltar schon im späten Mittelalter viel an Bedeutung verloren.
In n ac h m i 11 e 1 a 11 e r 1 i c h e r Zeit wurde der Kreuzaltar allmählich
fast überall von seinem Ehrenplatz entfernt. Ausdrücklich befahl 1591 der
Regensburger Generalvikar Myller für den Bereich der Diözese Regensburg
die Beseitigung jedes mitten im Schiff der Kirche vor dem Chor errichteten
Altares, sowohl weil derselbe das Innere entstelle und den Zugang zum Chor
erschwere, als auch weil er den Blick auf den Hochaltar und die an ihm sich
vollziehende heilige Handlung hindere. Nur in jenen Kirchen, in welchen der
Chor nach dem Schiff zu durch eine Wand (Lettner) abgeschlossen werde,
wie z. B. in der Kathedrale, in der Alten Kapelle und in St. Johann zu Regens-
burg, sowie in den meisten Klosterkirchen könne der Altar beibehalten wer-
den51. In der Michaelskirche zu München wurde aber noch 1649 mitten vor
dem Aufgang zum Chor vor einem Kreuze, das ursprünglich für ein Grab-
monument des Herzogs Wilhelm IV. und seiner Gemahlin Renata bestimmt
war, ein Kreuzaltar errichtet, der bis 1819 an seiner Stelle blieb".
Hinter dem Kreuzaltar erhob sich ein Kreuz. In dem Plan von St. Gallen
ist deshalb hinter ihm ein großes, aus Doppellinien bestehendes Kreuz ge-
zeichnet, zum Unterschied von den übrigen Altären, denen nur ein kleines,
einfaches Kreuzchen beigefügt ist.
In der Überschrift des Altarütels, den Hrabanus für den Kreuzaltar in Hersfeld ver-
faflte, heißt es: Ad crucem erga altare positam. In den Casus monasterii Petrihusiensis
wird der Kreuzaltar bezeichnet als altare ante crucem posita, in den Notae "Wessofon-
tanae als altare ad sanctam crucem. In den Notae Sweigo-Monasterii lesen wir: Ad
crucem continentur in altari (reliquiae), in den Notae dedicationum S. Maxiniini
Trevirensis: Ära quae ad crucem dicitur. Zu Le Mans errichtete Bischof Aldric hinter
dem Altar in medio ecclesiae ein Kreuz, „das aus Gold und Silber wunderbar her-
gestellt" war53.
Die Anordnung des Kreuzes war verschieden. Behebt war es, dasselbe auf
einer Säule aufzustellen. So stand in der Münsterkirche zu Essen das kostbare, von
der Äbtissin Ida gestiftete Goldkreuz auf einer antiken, mit korinthischem Kapitell
versehenen Marmorsäule. Das Kreuz ist bis auf ein kleines Fragment zugrunde ge-
gangen, die Säule aber noch vorhanden5*. In St. Michael zu Hildesheim befand sich
das Kreuz auf der hinter dem Kreuzaltar aufgestellten bekannten Bernwardssäule".
In St-Denis bei Paris war das Kreuz auf einer kostbaren, mit Figurenwerk.
Emails und Edelsteinen geschmückten Säule angebracht, wohl der reichsten und
großartigsten ihrer Art, die je geschaffen wurde, ein Ruhmesdenkmal deutscher
Künstler, die Suger zur Anfertigung der Säule hatte kommen lassen. Den Sockel
50 W. Stubbs, Gervasii monach., Chron. 10: Crucifixum Doraini nostri Jesu Christi auro et
Pulpitum (der Lettner) vero turrem (den Turm argento mirabüiter fabrieatum.
über der Vierung) quodamodo separabat et ex " Vgl. auch Kd. der Rheinprovinz, Stadt und
parte navis in medio sui altare s. crucis habe- Kreis Essen, 34 46, und Fr. Arens, Der Liber
bat. Ordinarius der Essener Stiftskirche (Essen
11 Ornatus ecclesiasticus c. 39; (Monachii 1901) 135.
1591) 71. » Chron. monast. S. Michaelis in Hildesheim
" A. Schultz, Die St. Michaels-Hofkirche in bei Meibom. Rerum Germ. SS. II (Helmstedt
München (München 1897) 35. Das Kreuz steht 1688) 518; vgl. auch Chron. coenob. s- M1"
Jetzt im rechten Querarm der Kirche. chaelis bei Leibniz, SS. rer. Brunsv. (Hannover
" Gesta Aldrici C. 3 (M. G. SS. XV, 312): 1707 f.); II, 399.
Kirche zu abschloO, aufgestellt war50. Gute Beispiele bieten noch heute die Lettner in
den Domen zu Xanten, Lübeck (Tafel 71) und Magdeburg (Tafel 69), der Stiftskirche zu
Gelnhausen (Tafel 184) und St. Elisabeth zu Marburg (Tafel 70). Übrigens hatte der
Heiligkreuzaltar schon im späten Mittelalter viel an Bedeutung verloren.
In n ac h m i 11 e 1 a 11 e r 1 i c h e r Zeit wurde der Kreuzaltar allmählich
fast überall von seinem Ehrenplatz entfernt. Ausdrücklich befahl 1591 der
Regensburger Generalvikar Myller für den Bereich der Diözese Regensburg
die Beseitigung jedes mitten im Schiff der Kirche vor dem Chor errichteten
Altares, sowohl weil derselbe das Innere entstelle und den Zugang zum Chor
erschwere, als auch weil er den Blick auf den Hochaltar und die an ihm sich
vollziehende heilige Handlung hindere. Nur in jenen Kirchen, in welchen der
Chor nach dem Schiff zu durch eine Wand (Lettner) abgeschlossen werde,
wie z. B. in der Kathedrale, in der Alten Kapelle und in St. Johann zu Regens-
burg, sowie in den meisten Klosterkirchen könne der Altar beibehalten wer-
den51. In der Michaelskirche zu München wurde aber noch 1649 mitten vor
dem Aufgang zum Chor vor einem Kreuze, das ursprünglich für ein Grab-
monument des Herzogs Wilhelm IV. und seiner Gemahlin Renata bestimmt
war, ein Kreuzaltar errichtet, der bis 1819 an seiner Stelle blieb".
Hinter dem Kreuzaltar erhob sich ein Kreuz. In dem Plan von St. Gallen
ist deshalb hinter ihm ein großes, aus Doppellinien bestehendes Kreuz ge-
zeichnet, zum Unterschied von den übrigen Altären, denen nur ein kleines,
einfaches Kreuzchen beigefügt ist.
In der Überschrift des Altarütels, den Hrabanus für den Kreuzaltar in Hersfeld ver-
faflte, heißt es: Ad crucem erga altare positam. In den Casus monasterii Petrihusiensis
wird der Kreuzaltar bezeichnet als altare ante crucem posita, in den Notae "Wessofon-
tanae als altare ad sanctam crucem. In den Notae Sweigo-Monasterii lesen wir: Ad
crucem continentur in altari (reliquiae), in den Notae dedicationum S. Maxiniini
Trevirensis: Ära quae ad crucem dicitur. Zu Le Mans errichtete Bischof Aldric hinter
dem Altar in medio ecclesiae ein Kreuz, „das aus Gold und Silber wunderbar her-
gestellt" war53.
Die Anordnung des Kreuzes war verschieden. Behebt war es, dasselbe auf
einer Säule aufzustellen. So stand in der Münsterkirche zu Essen das kostbare, von
der Äbtissin Ida gestiftete Goldkreuz auf einer antiken, mit korinthischem Kapitell
versehenen Marmorsäule. Das Kreuz ist bis auf ein kleines Fragment zugrunde ge-
gangen, die Säule aber noch vorhanden5*. In St. Michael zu Hildesheim befand sich
das Kreuz auf der hinter dem Kreuzaltar aufgestellten bekannten Bernwardssäule".
In St-Denis bei Paris war das Kreuz auf einer kostbaren, mit Figurenwerk.
Emails und Edelsteinen geschmückten Säule angebracht, wohl der reichsten und
großartigsten ihrer Art, die je geschaffen wurde, ein Ruhmesdenkmal deutscher
Künstler, die Suger zur Anfertigung der Säule hatte kommen lassen. Den Sockel
50 W. Stubbs, Gervasii monach., Chron. 10: Crucifixum Doraini nostri Jesu Christi auro et
Pulpitum (der Lettner) vero turrem (den Turm argento mirabüiter fabrieatum.
über der Vierung) quodamodo separabat et ex " Vgl. auch Kd. der Rheinprovinz, Stadt und
parte navis in medio sui altare s. crucis habe- Kreis Essen, 34 46, und Fr. Arens, Der Liber
bat. Ordinarius der Essener Stiftskirche (Essen
11 Ornatus ecclesiasticus c. 39; (Monachii 1901) 135.
1591) 71. » Chron. monast. S. Michaelis in Hildesheim
" A. Schultz, Die St. Michaels-Hofkirche in bei Meibom. Rerum Germ. SS. II (Helmstedt
München (München 1897) 35. Das Kreuz steht 1688) 518; vgl. auch Chron. coenob. s- M1"
Jetzt im rechten Querarm der Kirche. chaelis bei Leibniz, SS. rer. Brunsv. (Hannover
" Gesta Aldrici C. 3 (M. G. SS. XV, 312): 1707 f.); II, 399.