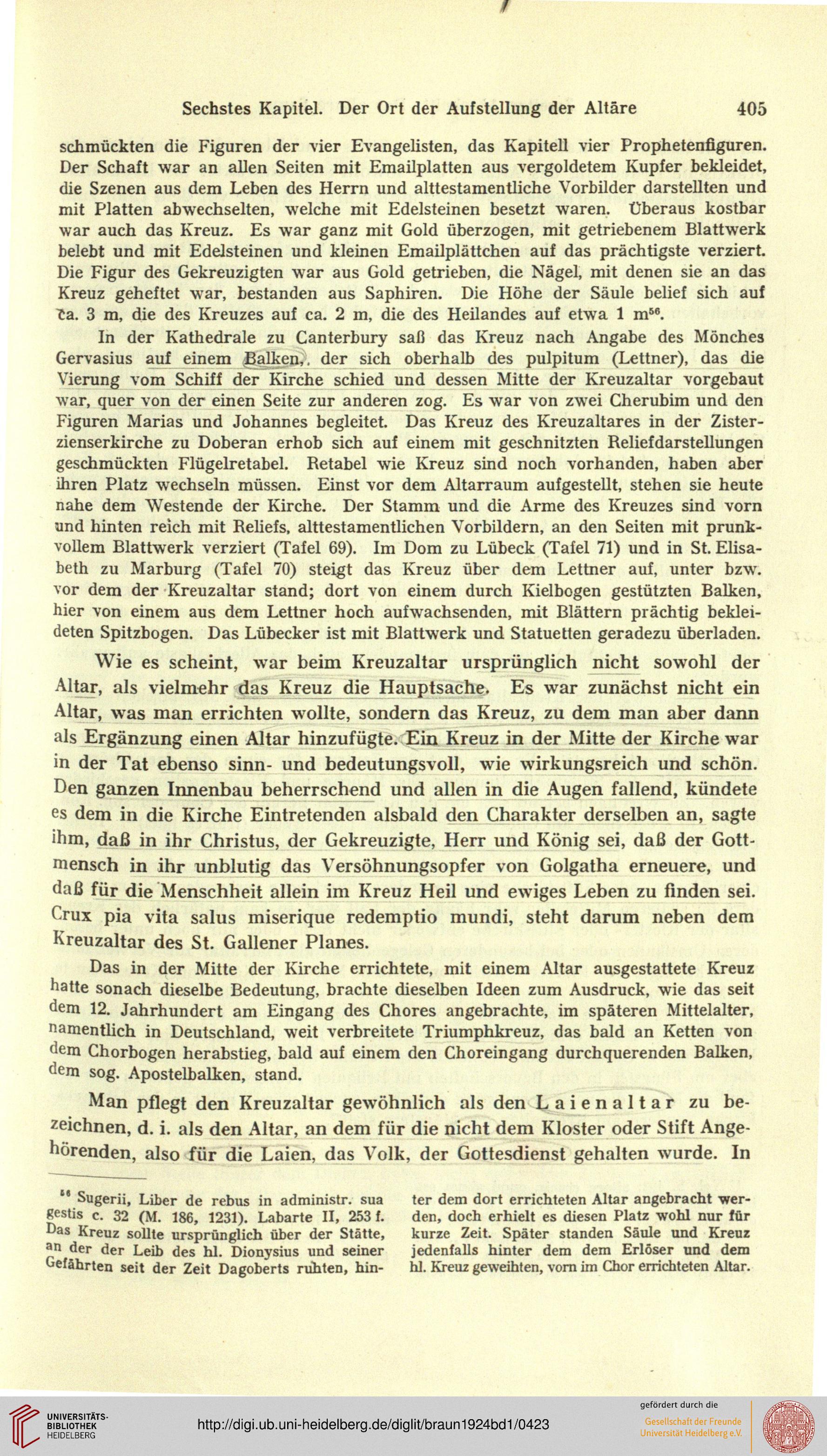Sechstes Kapitel. Der Ort der Aufstellung der Altäre 405
schmückten die Figuren der vier Evangelisten, das Kapitell vier Prophetenfiguren.
Der Schaft war an allen Seiten mit Emailplatten aus vergoldetem Kupfer bekleidet,
die Szenen aus dem Leben des Herrn und alttestamentliche Vorbilder darstellten und
mit Platten abwechselten, welche mit Edelsteinen besetzt waren, überaus kostbar
war auch das Kreuz. Es war ganz mit Gold überzogen, mit getriebenem Blattwerk
belebt und mit Edelsteinen und kleinen Emailplättchen auf das prächtigste verziert.
Die Figur des Gekreuzigten war aus Gold getrieben, die Nägel, mit denen sie an das
Kreuz geheftet war, bestanden aus Saphiren. Die Höhe der Säule belief sich auf
*a. 3 m, die des Kreuzes auf ca. 2 m, die des Heilandes auf etwa 1 m56.
In der Kathedrale zu Canterbury saß das Kreuz nach Angabe des Mönches
Gervasius auf einem Balken,, der sich oberhalb des pulpitum (Lettner), das die
Vierung vom Schiff der Kirche schied und dessen Mitte der Kreuzaltar vorgebaut
war, quer von der einen Seite zur anderen zog. Es war von zwei Cherubim und den
Figuren Marias und Johannes begleitet. Das Kreuz des Kreuzaltares in der Zister-
zienserkirche zu Doberan erhob sich auf einem mit geschnitzten Reliefdarstellungen
geschmückten Flügelretabel. Retabel wie Kreuz sind noch vorhanden, haben aber
ihren Platz wechseln müssen. Einst vor dem Altarraum aufgestellt, stehen sie heute
nahe dem Westende der Kirche. Der Stamm und die Arme des Kreuzes sind vorn
und hinten reich mit Reliefs, alttestamentlichen Vorbildern, an den Seiten mit prunk-
vollem Blattwerk verziert (Tafel 69). Im Dom zu Lübeck (Tafel 71) und in St. Elisa-
beth zu Marburg (Tafel 70) steigt das Kreuz über dem Lettner auf, unter bzw.
vor dem der Kreuzaltar stand; dort von einem durch Kielbogen gestützten Balken,
hier von einem aus dem Lettner hoch aufwachsenden, mit Blättern prächtig beklei-
deten Spitzbogen. Das Lübecker ist mit Blattwerk und Statuetten geradezu überladen.
Wie es scheint, war beim Kreuzaltar ursprünglich nicht sowohl der
Altar, als vielmehr das Kreuz die Hauptsache. Es war zunächst nicht ein
Altar, was man errichten wollte, sondern das Kreuz, zu dem man aber dann
als Ergänzung einen Altar hinzufügte. Ein Kreuz in der Mitte der Kirche war
in der Tat ebenso sinn- und bedeutungsvoll, wie wirkungsreich und schön.
Den ganzen Innenbau beherrschend und allen in die Augen fallend, kündete
es dem in die Kirche Eintretenden alsbald den Charakter derselben an, sagte
ihm, daß in ihr Christus, der Gekreuzigte, Herr und König sei, daß der Gott-
mensch in ihr unblutig das Versöhnungsopfer von Golgatha erneuere, und
daß für die Menschheit allein im Kreuz Heil und ewiges Leben zu finden sei.
Crux pia vita salus miserique redemptio mundi, steht darum neben dem
Kreuzaltar des St. Gallener Planes.
Das in der Mitte der Kirche errichtete, mit einem Altar ausgestattete Kreuz
hatte sonach dieselbe Bedeutung, brachte dieselben Ideen zum Ausdruck, wie das seit
dem 12. Jahrhundert am Eingang des Chores angebrachte, im späteren Mittelalter,
namentlich in Deutschland, weit verbreitete Triumphkreuz, das bald an Ketten von
dem Chorbogen herabstieg, bald auf einem den Choreingang durchquerenden Balken,
dem sog. Apostelbalken, stand.
Man pflegt den Kreuzaltar gewöhnlich als den L a i e n a 11 a r zu be-
zeichnen, d. i. als den Altar, an dem für die nicht dem Kloster oder Stift Ange-
hörenden, also für die Laien, das Volk, der Gottesdienst gehalten wurde. In
" Sugerii, Liber de rebus in administr. sua ter dem dort errichteten Altar angebracht wer-
Sestis c. 32 (M. 186, 1231). Labarte II, 253 f. den, doch erhielt es diesen Platz wohl nur für
Das Kreuz sollte ursprünglich über der Stätte, kurze Zeit. Später standen Säule und Kreuz
an der der Leib des hl. Dionysius und seiner jedenfalls hinter dem dem Erlöser und dem
Gefährten seit der Zeit Dagoberts ruhten, hin- hl. Kreuz geweihten, vorn im Chor errichteten Altar.
schmückten die Figuren der vier Evangelisten, das Kapitell vier Prophetenfiguren.
Der Schaft war an allen Seiten mit Emailplatten aus vergoldetem Kupfer bekleidet,
die Szenen aus dem Leben des Herrn und alttestamentliche Vorbilder darstellten und
mit Platten abwechselten, welche mit Edelsteinen besetzt waren, überaus kostbar
war auch das Kreuz. Es war ganz mit Gold überzogen, mit getriebenem Blattwerk
belebt und mit Edelsteinen und kleinen Emailplättchen auf das prächtigste verziert.
Die Figur des Gekreuzigten war aus Gold getrieben, die Nägel, mit denen sie an das
Kreuz geheftet war, bestanden aus Saphiren. Die Höhe der Säule belief sich auf
*a. 3 m, die des Kreuzes auf ca. 2 m, die des Heilandes auf etwa 1 m56.
In der Kathedrale zu Canterbury saß das Kreuz nach Angabe des Mönches
Gervasius auf einem Balken,, der sich oberhalb des pulpitum (Lettner), das die
Vierung vom Schiff der Kirche schied und dessen Mitte der Kreuzaltar vorgebaut
war, quer von der einen Seite zur anderen zog. Es war von zwei Cherubim und den
Figuren Marias und Johannes begleitet. Das Kreuz des Kreuzaltares in der Zister-
zienserkirche zu Doberan erhob sich auf einem mit geschnitzten Reliefdarstellungen
geschmückten Flügelretabel. Retabel wie Kreuz sind noch vorhanden, haben aber
ihren Platz wechseln müssen. Einst vor dem Altarraum aufgestellt, stehen sie heute
nahe dem Westende der Kirche. Der Stamm und die Arme des Kreuzes sind vorn
und hinten reich mit Reliefs, alttestamentlichen Vorbildern, an den Seiten mit prunk-
vollem Blattwerk verziert (Tafel 69). Im Dom zu Lübeck (Tafel 71) und in St. Elisa-
beth zu Marburg (Tafel 70) steigt das Kreuz über dem Lettner auf, unter bzw.
vor dem der Kreuzaltar stand; dort von einem durch Kielbogen gestützten Balken,
hier von einem aus dem Lettner hoch aufwachsenden, mit Blättern prächtig beklei-
deten Spitzbogen. Das Lübecker ist mit Blattwerk und Statuetten geradezu überladen.
Wie es scheint, war beim Kreuzaltar ursprünglich nicht sowohl der
Altar, als vielmehr das Kreuz die Hauptsache. Es war zunächst nicht ein
Altar, was man errichten wollte, sondern das Kreuz, zu dem man aber dann
als Ergänzung einen Altar hinzufügte. Ein Kreuz in der Mitte der Kirche war
in der Tat ebenso sinn- und bedeutungsvoll, wie wirkungsreich und schön.
Den ganzen Innenbau beherrschend und allen in die Augen fallend, kündete
es dem in die Kirche Eintretenden alsbald den Charakter derselben an, sagte
ihm, daß in ihr Christus, der Gekreuzigte, Herr und König sei, daß der Gott-
mensch in ihr unblutig das Versöhnungsopfer von Golgatha erneuere, und
daß für die Menschheit allein im Kreuz Heil und ewiges Leben zu finden sei.
Crux pia vita salus miserique redemptio mundi, steht darum neben dem
Kreuzaltar des St. Gallener Planes.
Das in der Mitte der Kirche errichtete, mit einem Altar ausgestattete Kreuz
hatte sonach dieselbe Bedeutung, brachte dieselben Ideen zum Ausdruck, wie das seit
dem 12. Jahrhundert am Eingang des Chores angebrachte, im späteren Mittelalter,
namentlich in Deutschland, weit verbreitete Triumphkreuz, das bald an Ketten von
dem Chorbogen herabstieg, bald auf einem den Choreingang durchquerenden Balken,
dem sog. Apostelbalken, stand.
Man pflegt den Kreuzaltar gewöhnlich als den L a i e n a 11 a r zu be-
zeichnen, d. i. als den Altar, an dem für die nicht dem Kloster oder Stift Ange-
hörenden, also für die Laien, das Volk, der Gottesdienst gehalten wurde. In
" Sugerii, Liber de rebus in administr. sua ter dem dort errichteten Altar angebracht wer-
Sestis c. 32 (M. 186, 1231). Labarte II, 253 f. den, doch erhielt es diesen Platz wohl nur für
Das Kreuz sollte ursprünglich über der Stätte, kurze Zeit. Später standen Säule und Kreuz
an der der Leib des hl. Dionysius und seiner jedenfalls hinter dem dem Erlöser und dem
Gefährten seit der Zeit Dagoberts ruhten, hin- hl. Kreuz geweihten, vorn im Chor errichteten Altar.