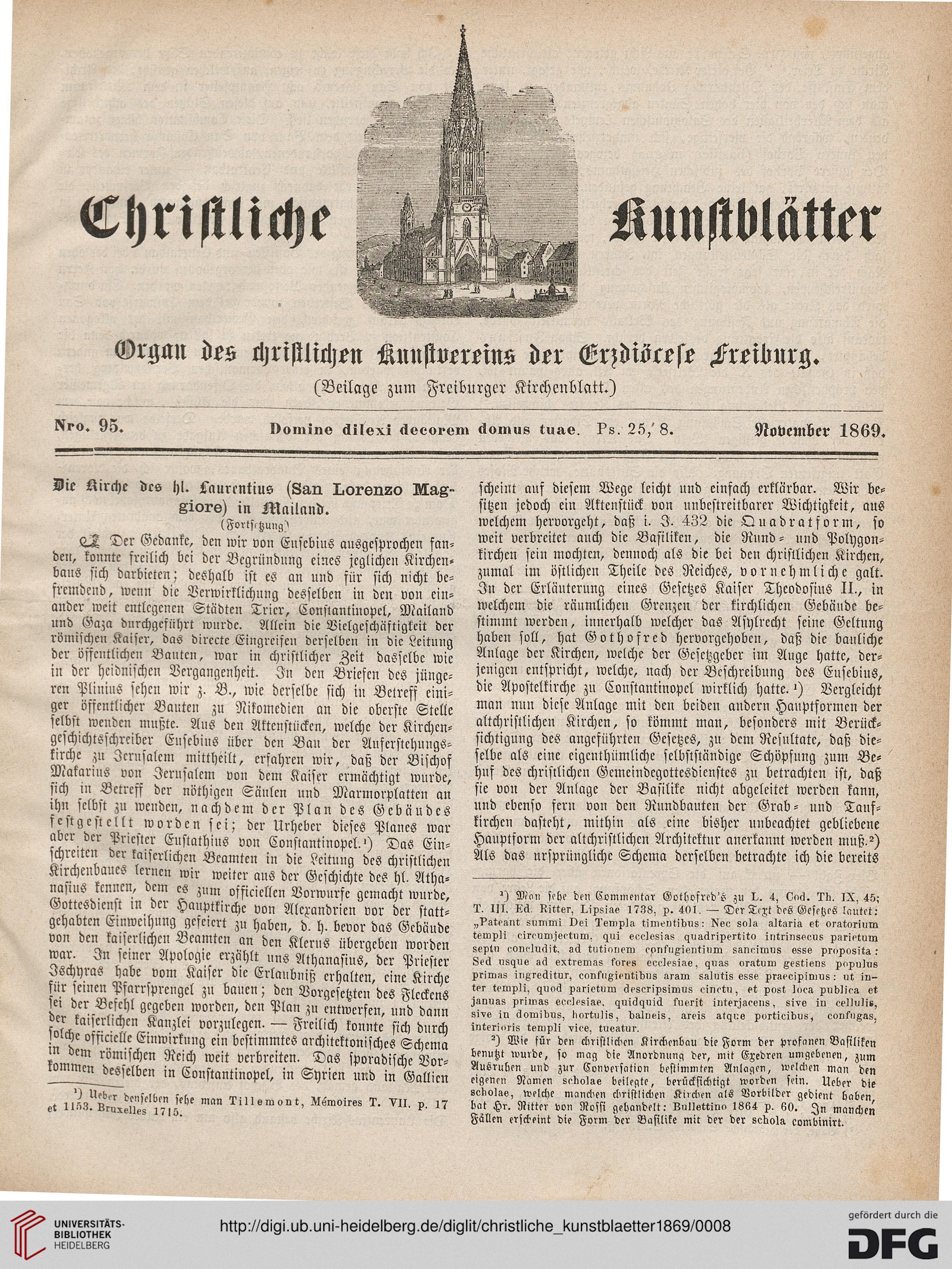Chriſtliche
Kunſtblätter
Organ des chriſtlichen Kunſtvereins der Erzdiöceſe Freiburg
(Beilage zum Freiburger Kirchenblatt.)
Nro. 95.
Domine diloxi decorom domus tuae. Ps. 25, 8.
November 1869.
ſcheint auf dieſem Wege leicht und einfach erklärbar. Wir be-
ſitzen jedoch ein Aktenſtück von unbeſtreitbarer Wichtigkeit, aus
welchem hervorgeht, daß i. J. 432 die Quadratform, ſo
weit verbreitet auch die Baſiliken, die Rund- und Polygon-
kirchen ſein mochten, dennoch als die bei den chriſtlichen Kirchen,
zumal im öſtlichen Theile des Reiches, vornehmliche galt.
Jn der Erläuterung eines Geſetzes Kaiſer Theodoſius JJ., in
welchem die räumlichen Grenzen der kirchlichen Gebäude be-
ſtimmt werden, innerhalb welcher das Aſylrecht ſeine Geltung
haben ſoll, hat Gothofred hervorgehoben, daß die bauliche
Anlage der Kirchen, welche der Geſetzgeber im Auge hatte, der-
jenigen entſpricht, welche, nach der Beſchreibung des Euſebius,
die Apoſtelkirche zu Conſtantinopel wirklich hatte.) Vergleicht
man nun dieſe Anlage mit den beiden andern Hauptformen der
altchriſtlichen Kirchen, ſo kömmt man, beſonders mit Berück-
ſichtigung des angeführten Geſetzes, zu dem Reſultate, daß die-
ſelbe als eine eigenthümliche ſelbſtſtändige Schöpfung zum Be-
huf des chriſtlichen Gemeindegottesdienſtes zu betrachten iſt, daß
ſie von der Anlage der Baſilike nicht abgeleitet werden kann,
und ebenſo fern von den Rundbauten der Grab- und Tauf-
kirchen daſteht, mithin als eine bisher unbeachtet gebliebene
Hauptform der altchriſtlichen Architektur anerkannt werden muß.)
ls das urſprüngliche Schema derſelben betrachte ich die bereits
Die Rirche des hl. ſaurentius (San Loronzo Mag-
gioro) in Mailand.
(Fortſetzung)
O Der Gedanke, den wir von Euſebius ausgeſprochen fan-
den, konnte freilich bei der Begründung eines jeglichen Kirchen-
baus ſich darbieten; deshalb iſt es an und für ſich nicht be-
fremdend, wenn die Verwirklichung desſelben in den von ein-
ander weit entlegenen Städten Trier, Conſtantinopel, Mailand
und Gaza durchgeführt wurde. Allein die Vielgeſchäftigkeit der
römiſchen Kaiſer, das directe Eingreifen derſelben in die Leitung
der öffentlichen Bauten, war in chriſtlicher Zeit dasſelbe wie
in der heidniſchen Vergangenheit. Jn den Briefen des jünge-
ren Plinius ſehen wir z. B., wie derſelbe ſich in Betreff eini-
ger öffentlicher Bauten zu Nikomedien an die oberſte Stelle
ſelbſt wenden mußte. Aus den Aktenſtücken, welche der Kirchen-
geſchichtsſchreiber Euſebius über den Ban der Auferſtehungs-
kirche zu Jeruſalem mittheilt, erfahren wir, daß der Biſchof
Makarius von Jeruſalem von dem Kaiſer ermächtigt wurde,
ſich in Betreff der nöthigen Säulen und Marmorplatten an
ihn ſelbſt zu wenden, nachdem der Plan des Gebäudes
feſtgeſtellt worden ſei; der Urheber dieſes Planes war
aber der Prieſter Euſtathius von Conſtantinopel.) Das Ein-
ſchreiten der kaiſerlichen Beamten in die Leitung des chriſtlichen
Kirchenbaues lernen wir weiter aus der Geſchichte des hl. Atha-
naſius kennen, dem es zum officiellen Vorwurfe gemacht wurde,
Gottesdienſt in der Hauptkirche von Alexandrien vor der ſtatt-
gehabten Einweihung gefeiert zu haben, d. h. bevor das Gebäude
von den kaiſerlichen Beamten an den Klerus übergeben worden
war. Jn ſeiner Apologie erzählt uns Athanaſius, der Prieſter
Jschhras habe vom Kaiſer die Erlaubniß erhalten, eine Kirche
für ſeinen Pfarrſprengel zu bauen; den Vorgeſetzten des Fleckens
ſei der Befehl gegeben worden, den Plan zu entwerfen, und dann
der kaiſerlichen Kanzlei vorzulegen. — Freilich konnte ſich durch
ſolche officielle Einwirkung ein beſtimmtes architektoniſches Schema
in dem römiſchen Reich weit verbreiten. Das ſporadiſche Vor-
kommen desſelben in Conſtantinopel, in Syrien und in Gallien
Man ſehe den Commentar Gothofred's zu L. 4, Cod. . JX, 45;
P. IJJ. Ed. Ritter, Lipsiae 1738, p. 401. — Der Text des Geſetzes lautet:
,Pateant summi Dei Templa timentibus: Nec sola altaria et oratorium
templi cireumjeetum, qui ecclesias quadripertito intrinsecus parietum
sepin coneludit, ad tutionem eonfugientium sancius esse proposita:
Sed usque ad extremas fores ecclesiae, quas oratum gestions populus
primas ingreditur, confngientibus aram salutis esse praecipimus: ut in-
ter templi, quod parietum descripsimus einetu, et post loca publica et
januas prias ecclesiae. quidqnid fnerit interjacens, sive in eellulis,
sive in domibus, hortulis, balveis, areis atque porticibus, confugas,
interioris templi vice, tueatur.
2) Wie für den chriſtlichen Kirchenbau die Form der profanen Baſiliken
benutzt wurde, ſo mag die Anordnung der, mit Exedren umgebenen, zum
Ausruhen und zur Converſation beſtimmten Anlagen, welchen man den
eigenen Namen scholae beilegte, berückſichtigt worden ſein. Ueber die
scholas, welche manchen chriſtlichen Kirchen als Vorbilder gedient haben.
hat Hr. Ritter von Roſſi gehandelt: Bunsttino 1864 p. 60. Jn manchen
Fallen erſcbeint die Form der Baſilike mit der der schola eomsini'
Ueber denſelben ſehe man TiI1emont, Mémoires P. VJJ. p. 17
et 1153. Braxelles 1716.
Kunſtblätter
Organ des chriſtlichen Kunſtvereins der Erzdiöceſe Freiburg
(Beilage zum Freiburger Kirchenblatt.)
Nro. 95.
Domine diloxi decorom domus tuae. Ps. 25, 8.
November 1869.
ſcheint auf dieſem Wege leicht und einfach erklärbar. Wir be-
ſitzen jedoch ein Aktenſtück von unbeſtreitbarer Wichtigkeit, aus
welchem hervorgeht, daß i. J. 432 die Quadratform, ſo
weit verbreitet auch die Baſiliken, die Rund- und Polygon-
kirchen ſein mochten, dennoch als die bei den chriſtlichen Kirchen,
zumal im öſtlichen Theile des Reiches, vornehmliche galt.
Jn der Erläuterung eines Geſetzes Kaiſer Theodoſius JJ., in
welchem die räumlichen Grenzen der kirchlichen Gebäude be-
ſtimmt werden, innerhalb welcher das Aſylrecht ſeine Geltung
haben ſoll, hat Gothofred hervorgehoben, daß die bauliche
Anlage der Kirchen, welche der Geſetzgeber im Auge hatte, der-
jenigen entſpricht, welche, nach der Beſchreibung des Euſebius,
die Apoſtelkirche zu Conſtantinopel wirklich hatte.) Vergleicht
man nun dieſe Anlage mit den beiden andern Hauptformen der
altchriſtlichen Kirchen, ſo kömmt man, beſonders mit Berück-
ſichtigung des angeführten Geſetzes, zu dem Reſultate, daß die-
ſelbe als eine eigenthümliche ſelbſtſtändige Schöpfung zum Be-
huf des chriſtlichen Gemeindegottesdienſtes zu betrachten iſt, daß
ſie von der Anlage der Baſilike nicht abgeleitet werden kann,
und ebenſo fern von den Rundbauten der Grab- und Tauf-
kirchen daſteht, mithin als eine bisher unbeachtet gebliebene
Hauptform der altchriſtlichen Architektur anerkannt werden muß.)
ls das urſprüngliche Schema derſelben betrachte ich die bereits
Die Rirche des hl. ſaurentius (San Loronzo Mag-
gioro) in Mailand.
(Fortſetzung)
O Der Gedanke, den wir von Euſebius ausgeſprochen fan-
den, konnte freilich bei der Begründung eines jeglichen Kirchen-
baus ſich darbieten; deshalb iſt es an und für ſich nicht be-
fremdend, wenn die Verwirklichung desſelben in den von ein-
ander weit entlegenen Städten Trier, Conſtantinopel, Mailand
und Gaza durchgeführt wurde. Allein die Vielgeſchäftigkeit der
römiſchen Kaiſer, das directe Eingreifen derſelben in die Leitung
der öffentlichen Bauten, war in chriſtlicher Zeit dasſelbe wie
in der heidniſchen Vergangenheit. Jn den Briefen des jünge-
ren Plinius ſehen wir z. B., wie derſelbe ſich in Betreff eini-
ger öffentlicher Bauten zu Nikomedien an die oberſte Stelle
ſelbſt wenden mußte. Aus den Aktenſtücken, welche der Kirchen-
geſchichtsſchreiber Euſebius über den Ban der Auferſtehungs-
kirche zu Jeruſalem mittheilt, erfahren wir, daß der Biſchof
Makarius von Jeruſalem von dem Kaiſer ermächtigt wurde,
ſich in Betreff der nöthigen Säulen und Marmorplatten an
ihn ſelbſt zu wenden, nachdem der Plan des Gebäudes
feſtgeſtellt worden ſei; der Urheber dieſes Planes war
aber der Prieſter Euſtathius von Conſtantinopel.) Das Ein-
ſchreiten der kaiſerlichen Beamten in die Leitung des chriſtlichen
Kirchenbaues lernen wir weiter aus der Geſchichte des hl. Atha-
naſius kennen, dem es zum officiellen Vorwurfe gemacht wurde,
Gottesdienſt in der Hauptkirche von Alexandrien vor der ſtatt-
gehabten Einweihung gefeiert zu haben, d. h. bevor das Gebäude
von den kaiſerlichen Beamten an den Klerus übergeben worden
war. Jn ſeiner Apologie erzählt uns Athanaſius, der Prieſter
Jschhras habe vom Kaiſer die Erlaubniß erhalten, eine Kirche
für ſeinen Pfarrſprengel zu bauen; den Vorgeſetzten des Fleckens
ſei der Befehl gegeben worden, den Plan zu entwerfen, und dann
der kaiſerlichen Kanzlei vorzulegen. — Freilich konnte ſich durch
ſolche officielle Einwirkung ein beſtimmtes architektoniſches Schema
in dem römiſchen Reich weit verbreiten. Das ſporadiſche Vor-
kommen desſelben in Conſtantinopel, in Syrien und in Gallien
Man ſehe den Commentar Gothofred's zu L. 4, Cod. . JX, 45;
P. IJJ. Ed. Ritter, Lipsiae 1738, p. 401. — Der Text des Geſetzes lautet:
,Pateant summi Dei Templa timentibus: Nec sola altaria et oratorium
templi cireumjeetum, qui ecclesias quadripertito intrinsecus parietum
sepin coneludit, ad tutionem eonfugientium sancius esse proposita:
Sed usque ad extremas fores ecclesiae, quas oratum gestions populus
primas ingreditur, confngientibus aram salutis esse praecipimus: ut in-
ter templi, quod parietum descripsimus einetu, et post loca publica et
januas prias ecclesiae. quidqnid fnerit interjacens, sive in eellulis,
sive in domibus, hortulis, balveis, areis atque porticibus, confugas,
interioris templi vice, tueatur.
2) Wie für den chriſtlichen Kirchenbau die Form der profanen Baſiliken
benutzt wurde, ſo mag die Anordnung der, mit Exedren umgebenen, zum
Ausruhen und zur Converſation beſtimmten Anlagen, welchen man den
eigenen Namen scholae beilegte, berückſichtigt worden ſein. Ueber die
scholas, welche manchen chriſtlichen Kirchen als Vorbilder gedient haben.
hat Hr. Ritter von Roſſi gehandelt: Bunsttino 1864 p. 60. Jn manchen
Fallen erſcbeint die Form der Baſilike mit der der schola eomsini'
Ueber denſelben ſehe man TiI1emont, Mémoires P. VJJ. p. 17
et 1153. Braxelles 1716.