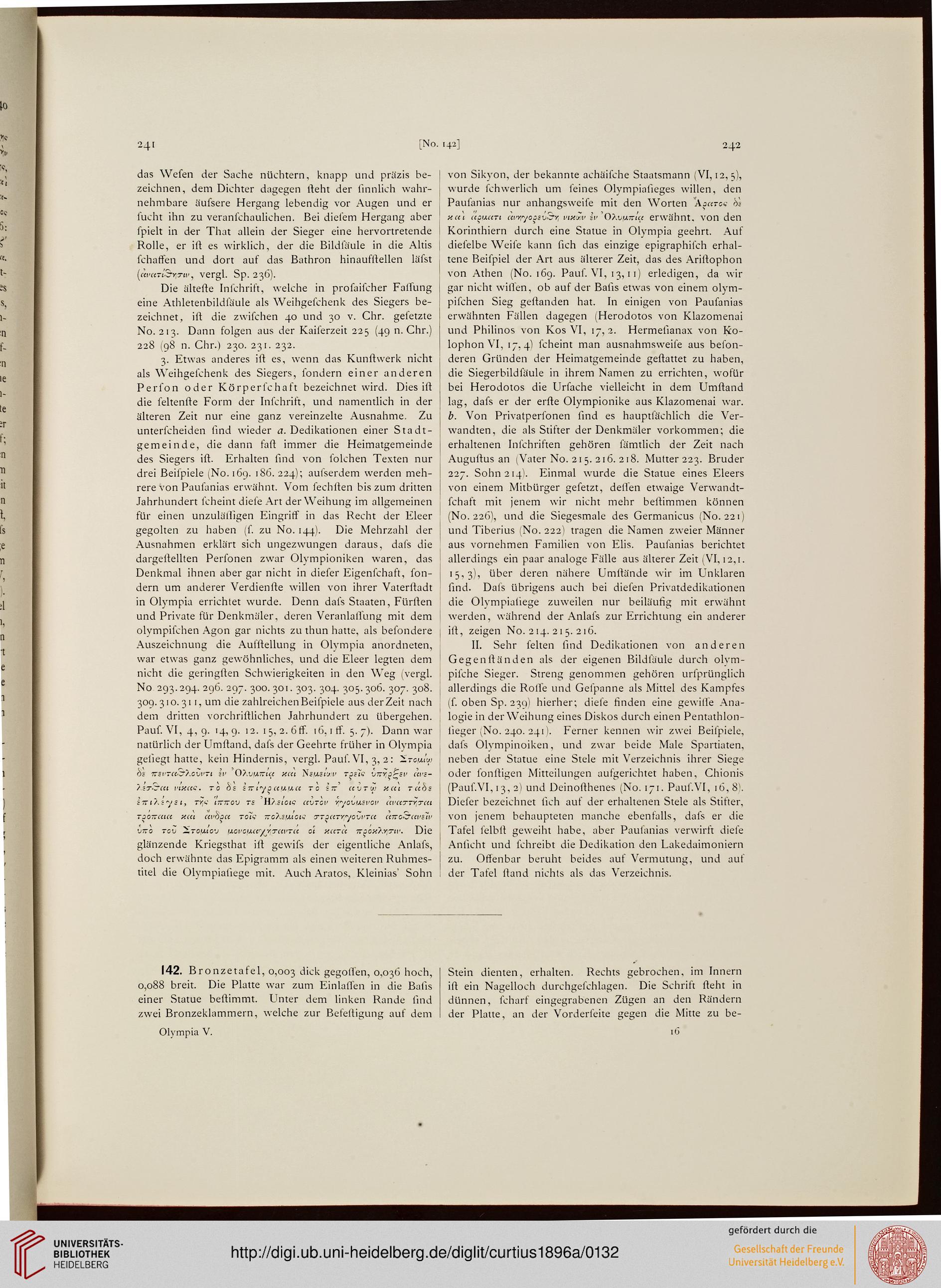24'
[No. 142]
242
das Wesen der Sache nüchtern, knapp und präzis be-
zeichnen, dem Dichter dagegen fleht der sinnlich wahr-
nehmbare äussere Hergang lebendig vor Augen und er
l'ucht ihn zu veranschaulichen. Bei diel'em Hergang aber
spielt in der That allein der Sieger eine hervortretende
Rolle, er ist es wirklich, der die Bildsäule in die Altis
schaffen und dort auf das Bathron hinausstellen lä'sst
(ανκτίΒνιτιν, vergl. Sp. 236).
Die älteste Inschrift, welche in prosaischer Fällung
eine Athletenbildsäule als Weihges'chenk des Siegers be-
zeichnet, ist die zwischen 40 und 30 v. Chr. geletzte
No. 213. Dann folgen aus der Kailerzeit 225 (49 n. Chr.)
228 (98 n. Chr.) 230. 231. 232.
3. Etwas anderes ist es, wenn das Kunstwerk nicht
als Weihgeschenk des Siegers, sondern einer anderen
Person oder Körperschaft bezeichnet wird. Dies ist
die seltenste Form der Insehrist, und namentlich in der
älteren Zeit nur eine ganz vereinzelte Ausnahme. Zu
unterscheiden sind wieder a. Dedikationen einer Stadt-
gemeinde, die dann fast immer die Heimatgemeinde
des Siegers ist. Erhalten sind von solchen Texten nur
drei Beilpiele (No. 169. 186. 224); aul'serdem werden meh-
rere von Pausanias erwähnt. Vom sechsten bis zum dritten
Jahrhundert scheint diele Art der Weihung im allgemeinen
für einen unzulälligen Eingrisf in das Recht der Eleer
gegolten zu haben (s. zu No. 144). Die Mehrzahl der
Ausnahmen erklärt sich ungezwungen daraus, dals die
dargestellten Personen zwar Olympioniken waren, das
Denkmal ihnen aber gar nicht in dieser Eigenschaft, son-
dern um anderer Verdienste willen von ihrer Vaterltadt
in Olympia errichtet wurde. Denn dals Staaten, Fürsten
und Private für Denkmäler, deren Veranlalsung mit dem
olympischen Agon gar nichts zu thun hatte, als besondere
Auszeichnung die Ausstellung in Olympia anordneten,
war etwas ganz gewöhnliches, und die Eleer legten dem
nicht die geringsten Schwierigkeiten in den Weg (vergl.
No 293.294. 296. 207. 300. 301. 303. 304. 305. 306. 307. 308.
300. 310. 31 1, um die zahlreichen Beilpiele aus derZeit nach
dem dritten vorchristlichen Jahrhundert zu übergehen.
Paus. VI, 4, 9. 14, 9. 12. 15, 2. 6fs. 16,1 tf. 5. 7). Dann war
natürlich der Umstand, dals der Geehrte früher in Olympia
geliegt hatte, kein Hindernis, vergl. Paus. VI, 3, 2: l-outw
os T7zi'7a~}.cZvTi Iv 0}.vu7riu και Νεμείωυ rjsic νπΤιρΡεν ars-
/ sxcra νικάς, το os ίττ tyo auu.cc το \ 77 αυτυ.< και rccbs
ίπι/.iyst, T*j«i iinza'j ~z H/Sictc ctvTou yyohuii'ci' ceuccTTYjTai
tjottccicc y.ui ανορα τοϊς παλεμιοις ττρατΥΐγονντα απο&αι/έϊν
υπο του — τομιου uovoaayjrrav-a οι χατα προκ?.γιτιν. Die
glänzende Kriegsthat ist gewiss der eigentliche Anläss,
doch erwähnte das Epigramm als einen weiteren Ruhmes-
titel die Olympiasiege mit. Auch Aratos, Kleinias' Sohn
von Sikyon, der bekannte achäische Staatsmann (VI, 12,5),
wurde schwerlich um seines Olympiasieges willen, den
Pausanias nur anhangsweise mit den Worten \pa-oa os
και apuari ai'rr/ops'u3"f< νικϊηυ Iv Ολυιλπια erwähnt, von den
Korinthiern durch eine Statue in Olympia geehrt. Auf
dieselbe Weise kann sich das einzige epigraphisch erhal-
tene Beispiel der Art aus älterer Zeit, das des Aristophon
von Athen (No. 169. Paus. VI, 13,11) erledigen, da wir
gar nicht willen, ob auf der Balls etwas von einem olym-
pischen Sieg gestanden hat. In einigen von Pausanias
erwähnten Fällen dagegen (Herodotos von Klazomenai
und Philinos von Kos VI, 17,2. Hermesianax von Ko-
lophon VI, 17.4) scheint man ausnahmsweise aus beson-
deren Gründen der Heimatgemeinde gestattet zu haben,
die Siegerbildsäule in ihrem Namen zu errichten, wosür
bei Herodotos die Ursache vielleicht in dem Umstand
lag, dass er der erste Olympionike aus Klazomenai war.
b. Von Privatpersonen sind es hauptsächlich die Ver-
wandten, die als Stifter der Denkmäler vorkommen; die
erhaltenen Inschriften gehören sämtlich der Zeit nach
Augustus an (Vater No. 21 5. 216. 218. Mutter 223. Bruder
227. Sohn 214). Einmal wurde die Statue eines Eleers
von einem Mitbürger gesetzt, dellen etwaige Verwandt-
schaft mit jenem wir nicht mehr bestimmen können
(No. 226), und die Siegesmale des Germanicus (No. 221)
und Tiberius (No. 222) tragen die Namen zweier Männer
aus vornehmen Familien von Elis. Pausanias berichtet
allerdings ein paar analoge Fälle aus älterer Zeit (VI, 12,1.
15,3), über deren nähere Umstände wir im Unklaren
sind. Dals übrigens auch bei diesen Privatdedikationen
die Olvmpialiege zuweilen nur beiläufig mit erwähnt
werden, während der Anlass zur Errichtung ein anderer
1 ist, zeigen No. 214. 21 5. 216.
II. Sehr seiten sind Dedikationen von anderen
Gegenständen als der eigenen Bildsäule durch olvm-
pilche Sieger. Streng genommen gehören ursprünglich
allerdings die Rolse und Gelpanne als Mittel des Kampfes
(s. oben Sp. 239) hierher; diele finden eine gewilse Ana-
logie in der Weihung eines Diskos durch einen Pentathlon-
sieger (No. 240. 241). Ferner kennen wir zwei Beilpiele,
dals Olvmpinoiken, und zwar beide Male Spartiaten,
neben der Statue eine Stele mit Verzeichnis ihrer Siege
oder sonstigen Mitteilungen ausgerichtet haben, Chionis
(Paus.VI, 13, 2) und üeinosthenes (No. 171. Paus.VI, 16,8'.
Dieser bezeichnet sich auf der erhaltenen Stele als Stifter,
von jenem behaupteten manche ebenfalls, dals er die
Tafel selbst geweiht habe, aber Pausanias verwirft diele
Anlicht und schreibt die Dedikation den Lakedaimoniern
zu. Ofsenbar beruht beides auf Vermutung, und auf
der Tafel stand nichts als das Verzeichnis.
142. Bronzetafel, 0,003 dick gegolTen, 0,036 hoch,
0,088 breit. Die Platte war zum Einlassen in die Basis
einer Statue bestimmt. Unter dem linken Rande lind
zwei Bronzeklammern, welche zur Befestigung aus dem
Olympia V.
Stein dienten, erhalten. Rechts gebrochen, im Innern
ist ein Nagelloch durchgeschlagen. Die Schrift sseht in
dünnen, scharf eingegrabenen Zügen an den Rändern
der Platte, an der Vorderseite gegen die Mitte zu be-
[No. 142]
242
das Wesen der Sache nüchtern, knapp und präzis be-
zeichnen, dem Dichter dagegen fleht der sinnlich wahr-
nehmbare äussere Hergang lebendig vor Augen und er
l'ucht ihn zu veranschaulichen. Bei diel'em Hergang aber
spielt in der That allein der Sieger eine hervortretende
Rolle, er ist es wirklich, der die Bildsäule in die Altis
schaffen und dort auf das Bathron hinausstellen lä'sst
(ανκτίΒνιτιν, vergl. Sp. 236).
Die älteste Inschrift, welche in prosaischer Fällung
eine Athletenbildsäule als Weihges'chenk des Siegers be-
zeichnet, ist die zwischen 40 und 30 v. Chr. geletzte
No. 213. Dann folgen aus der Kailerzeit 225 (49 n. Chr.)
228 (98 n. Chr.) 230. 231. 232.
3. Etwas anderes ist es, wenn das Kunstwerk nicht
als Weihgeschenk des Siegers, sondern einer anderen
Person oder Körperschaft bezeichnet wird. Dies ist
die seltenste Form der Insehrist, und namentlich in der
älteren Zeit nur eine ganz vereinzelte Ausnahme. Zu
unterscheiden sind wieder a. Dedikationen einer Stadt-
gemeinde, die dann fast immer die Heimatgemeinde
des Siegers ist. Erhalten sind von solchen Texten nur
drei Beilpiele (No. 169. 186. 224); aul'serdem werden meh-
rere von Pausanias erwähnt. Vom sechsten bis zum dritten
Jahrhundert scheint diele Art der Weihung im allgemeinen
für einen unzulälligen Eingrisf in das Recht der Eleer
gegolten zu haben (s. zu No. 144). Die Mehrzahl der
Ausnahmen erklärt sich ungezwungen daraus, dals die
dargestellten Personen zwar Olympioniken waren, das
Denkmal ihnen aber gar nicht in dieser Eigenschaft, son-
dern um anderer Verdienste willen von ihrer Vaterltadt
in Olympia errichtet wurde. Denn dals Staaten, Fürsten
und Private für Denkmäler, deren Veranlalsung mit dem
olympischen Agon gar nichts zu thun hatte, als besondere
Auszeichnung die Ausstellung in Olympia anordneten,
war etwas ganz gewöhnliches, und die Eleer legten dem
nicht die geringsten Schwierigkeiten in den Weg (vergl.
No 293.294. 296. 207. 300. 301. 303. 304. 305. 306. 307. 308.
300. 310. 31 1, um die zahlreichen Beilpiele aus derZeit nach
dem dritten vorchristlichen Jahrhundert zu übergehen.
Paus. VI, 4, 9. 14, 9. 12. 15, 2. 6fs. 16,1 tf. 5. 7). Dann war
natürlich der Umstand, dals der Geehrte früher in Olympia
geliegt hatte, kein Hindernis, vergl. Paus. VI, 3, 2: l-outw
os T7zi'7a~}.cZvTi Iv 0}.vu7riu και Νεμείωυ rjsic νπΤιρΡεν ars-
/ sxcra νικάς, το os ίττ tyo auu.cc το \ 77 αυτυ.< και rccbs
ίπι/.iyst, T*j«i iinza'j ~z H/Sictc ctvTou yyohuii'ci' ceuccTTYjTai
tjottccicc y.ui ανορα τοϊς παλεμιοις ττρατΥΐγονντα απο&αι/έϊν
υπο του — τομιου uovoaayjrrav-a οι χατα προκ?.γιτιν. Die
glänzende Kriegsthat ist gewiss der eigentliche Anläss,
doch erwähnte das Epigramm als einen weiteren Ruhmes-
titel die Olympiasiege mit. Auch Aratos, Kleinias' Sohn
von Sikyon, der bekannte achäische Staatsmann (VI, 12,5),
wurde schwerlich um seines Olympiasieges willen, den
Pausanias nur anhangsweise mit den Worten \pa-oa os
και apuari ai'rr/ops'u3"f< νικϊηυ Iv Ολυιλπια erwähnt, von den
Korinthiern durch eine Statue in Olympia geehrt. Auf
dieselbe Weise kann sich das einzige epigraphisch erhal-
tene Beispiel der Art aus älterer Zeit, das des Aristophon
von Athen (No. 169. Paus. VI, 13,11) erledigen, da wir
gar nicht willen, ob auf der Balls etwas von einem olym-
pischen Sieg gestanden hat. In einigen von Pausanias
erwähnten Fällen dagegen (Herodotos von Klazomenai
und Philinos von Kos VI, 17,2. Hermesianax von Ko-
lophon VI, 17.4) scheint man ausnahmsweise aus beson-
deren Gründen der Heimatgemeinde gestattet zu haben,
die Siegerbildsäule in ihrem Namen zu errichten, wosür
bei Herodotos die Ursache vielleicht in dem Umstand
lag, dass er der erste Olympionike aus Klazomenai war.
b. Von Privatpersonen sind es hauptsächlich die Ver-
wandten, die als Stifter der Denkmäler vorkommen; die
erhaltenen Inschriften gehören sämtlich der Zeit nach
Augustus an (Vater No. 21 5. 216. 218. Mutter 223. Bruder
227. Sohn 214). Einmal wurde die Statue eines Eleers
von einem Mitbürger gesetzt, dellen etwaige Verwandt-
schaft mit jenem wir nicht mehr bestimmen können
(No. 226), und die Siegesmale des Germanicus (No. 221)
und Tiberius (No. 222) tragen die Namen zweier Männer
aus vornehmen Familien von Elis. Pausanias berichtet
allerdings ein paar analoge Fälle aus älterer Zeit (VI, 12,1.
15,3), über deren nähere Umstände wir im Unklaren
sind. Dals übrigens auch bei diesen Privatdedikationen
die Olvmpialiege zuweilen nur beiläufig mit erwähnt
werden, während der Anlass zur Errichtung ein anderer
1 ist, zeigen No. 214. 21 5. 216.
II. Sehr seiten sind Dedikationen von anderen
Gegenständen als der eigenen Bildsäule durch olvm-
pilche Sieger. Streng genommen gehören ursprünglich
allerdings die Rolse und Gelpanne als Mittel des Kampfes
(s. oben Sp. 239) hierher; diele finden eine gewilse Ana-
logie in der Weihung eines Diskos durch einen Pentathlon-
sieger (No. 240. 241). Ferner kennen wir zwei Beilpiele,
dals Olvmpinoiken, und zwar beide Male Spartiaten,
neben der Statue eine Stele mit Verzeichnis ihrer Siege
oder sonstigen Mitteilungen ausgerichtet haben, Chionis
(Paus.VI, 13, 2) und üeinosthenes (No. 171. Paus.VI, 16,8'.
Dieser bezeichnet sich auf der erhaltenen Stele als Stifter,
von jenem behaupteten manche ebenfalls, dals er die
Tafel selbst geweiht habe, aber Pausanias verwirft diele
Anlicht und schreibt die Dedikation den Lakedaimoniern
zu. Ofsenbar beruht beides auf Vermutung, und auf
der Tafel stand nichts als das Verzeichnis.
142. Bronzetafel, 0,003 dick gegolTen, 0,036 hoch,
0,088 breit. Die Platte war zum Einlassen in die Basis
einer Statue bestimmt. Unter dem linken Rande lind
zwei Bronzeklammern, welche zur Befestigung aus dem
Olympia V.
Stein dienten, erhalten. Rechts gebrochen, im Innern
ist ein Nagelloch durchgeschlagen. Die Schrift sseht in
dünnen, scharf eingegrabenen Zügen an den Rändern
der Platte, an der Vorderseite gegen die Mitte zu be-