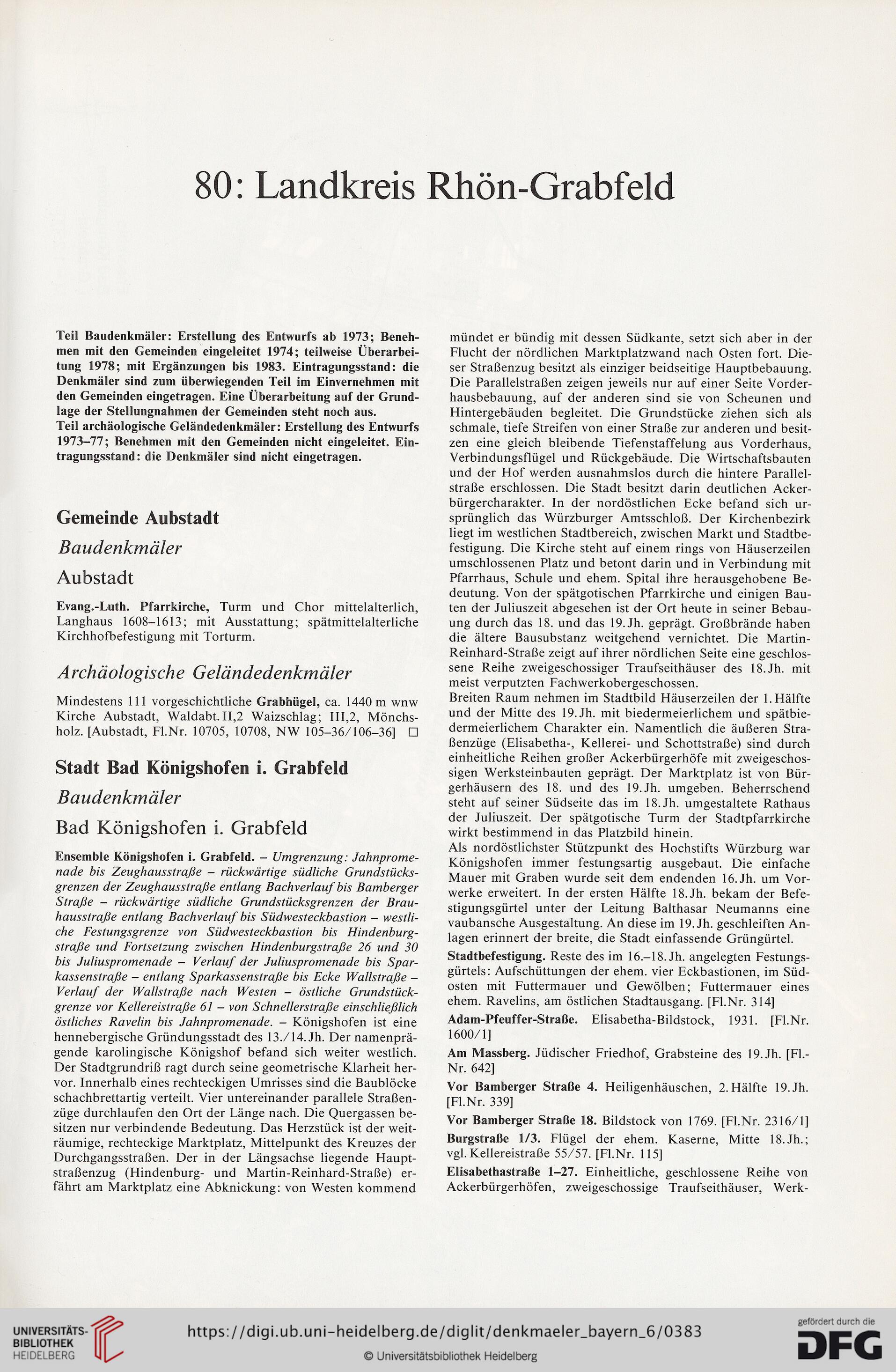80: Landkreis Rhön-Grabfeld
Teil Baudenkmäler: Erstellung des Entwurfs ab 1973; Beneh-
men mit den Gemeinden eingeleitet 1974; teilweise Überarbei-
tung 1978; mit Ergänzungen bis 1983. Eintragungsstand: die
Denkmäler sind zum überwiegenden Teil im Einvernehmen mit
den Gemeinden eingetragen. Eine Überarbeitung auf der Grund-
lage der Stellungnahmen der Gemeinden steht noch aus.
Teil archäologische Geländedenkmäler: Erstellung des Entwurfs
1973-77; Benehmen mit den Gemeinden nicht eingeleitet. Ein-
tragungsstand : die Denkmäler sind nicht eingetragen.
Gemeinde Aubstadt
Baudenkmäler
Aubstadt
Evang.-Luth. Pfarrkirche, Turm und Chor mittelalterlich,
Langhaus 1608-1613; mit Ausstattung; spätmittelalterliche
Kirchhofbefestigung mit Torturm.
Archäologische Geländedenkmäler
Mindestens 111 vorgeschichtliche Grabhügel, ca. 1440 m wnw
Kirche Aubstadt, Waldabt. 11,2 Waizschlag; III,2, Mönchs-
holz. [Aubstadt, Fl.Nr. 10705, 10708, NW 105-36/106-36]
Stadt Bad Königshofen i. Grabfeld
Baudenkmäler
Bad Königshofen i. Grabfeld
Ensemble Königshofen i. Grabfeld. - Umgrenzung: Jahnprome-
nade bis Zeughausstraße - rückwärtige südliche Grundstücks-
grenzen der Zeughausstraße entlang Bachverlauf bis Bamberger
Straße - rückwärtige südliche Grundstücksgrenzen der Brau-
hausstraße entlang Bachverlauf bis Südwesteckbastion - westli-
che Festungsgrenze von Südwesteckbastion bis Hindenburg-
straße und Fortsetzung zwischen Hindenburgstraße 26 und 30
bis Juliuspromenade - Verlauf der Juliuspromenade bis Spar-
kassenstraße - entlang Sparkassenstraße bis Ecke Wallstraße -
Verlauf der Wallstraße nach Westen - östliche Grundstück-
grenze vor Kellereistraße 61 - von Schnellerstraße einschließlich
östliches Ravelin bis Jahnpromenade. - Königshofen ist eine
hennebergische Gründungsstadt des 13./14. Jh. Der namenprä-
gende karolingische Königshof befand sich weiter westlich.
Der Stadtgrundriß ragt durch seine geometrische Klarheit her-
vor. Innerhalb eines rechteckigen Umrisses sind die Baublöcke
schachbrettartig verteilt. Vier untereinander parallele Straßen-
züge durchlaufen den Ort der Länge nach. Die Quergassen be-
sitzen nur verbindende Bedeutung. Das Herzstück ist der weit-
räumige, rechteckige Marktplatz, Mittelpunkt des Kreuzes der
Durchgangsstraßen. Der in der Längsachse liegende Haupt-
straßenzug (Hindenburg- und Martin-Reinhard-Straße) er-
fährt am Marktplatz eine Abknickung: von Westen kommend
mündet er bündig mit dessen Südkante, setzt sich aber in der
Flucht der nördlichen Marktplatzwand nach Osten fort. Die-
ser Straßenzug besitzt als einziger beidseitige Hauptbebauung.
Die Parallelstraßen zeigen jeweils nur auf einer Seite Vorder-
hausbebauung, auf der anderen sind sie von Scheunen und
Hintergebäuden begleitet. Die Grundstücke ziehen sich als
schmale, tiefe Streifen von einer Straße zur anderen und besit-
zen eine gleich bleibende Tiefenstaffelung aus Vorderhaus,
Verbindungsflügel und Rückgebäude. Die Wirtschaftsbauten
und der Hof werden ausnahmslos durch die hintere Parallel-
straße erschlossen. Die Stadt besitzt darin deutlichen Acker-
bürgercharakter. In der nordöstlichen Ecke befand sich ur-
sprünglich das Würzburger Amtsschloß. Der Kirchenbezirk
liegt im westlichen Stadtbereich, zwischen Markt und Stadtbe-
festigung. Die Kirche steht auf einem rings von Häuserzeilen
umschlossenen Platz und betont darin und in Verbindung mit
Pfarrhaus, Schule und ehern. Spital ihre herausgehobene Be-
deutung. Von der spätgotischen Pfarrkirche und einigen Bau-
ten der Juliuszeit abgesehen ist der Ort heute in seiner Bebau-
ung durch das 18. und das 19.Jh. geprägt. Großbrände haben
die ältere Bausubstanz weitgehend vernichtet. Die Martin-
Reinhard-Straße zeigt auf ihrer nördlichen Seite eine geschlos-
sene Reihe zweigeschossiger Traufseithäuser des 18. Jh. mit
meist verputzten Fachwerkobergeschossen.
Breiten Raum nehmen im Stadtbild Häuserzeilen der 1. Hälfte
und der Mitte des 19.Jh. mit biedermeierlichem und spätbie-
dermeierlichem Charakter ein. Namentlich die äußeren Stra-
ßenzüge (Elisabetha-, Kellerei- und Schottstraße) sind durch
einheitliche Reihen großer Ackerbürgerhöfe mit zweigeschos-
sigen Werksteinbauten geprägt. Der Marktplatz ist von Bür-
gerhäusern des 18. und des 19. Jh. umgeben. Beherrschend
steht auf seiner Südseite das im 18. Jh. umgestaltete Rathaus
der Juliuszeit. Der spätgotische Turm der Stadtpfarrkirche
wirkt bestimmend in das Platzbild hinein.
Als nordöstlichster Stützpunkt des Hochstifts Würzburg war
Königshofen immer festungsartig ausgebaut. Die einfache
Mauer mit Graben wurde seit dem endenden 16. Jh. um Vor-
werke erweitert. In der ersten Hälfte 18. Jh. bekam der Befe-
stigungsgürtel unter der Leitung Balthasar Neumanns eine
vaubansche Ausgestaltung. An diese im 19. Jh. geschleiften An-
lagen erinnert der breite, die Stadt einfassende Grüngürtel.
Stadtbefestigung. Reste des im 16.-18. Jh. angelegten Festungs-
gürtels: Aufschüttungen der ehern, vier Eckbastionen, im Süd-
osten mit Futtermauer und Gewölben; Futtermauer eines
ehern. Ravelins, am östlichen Stadtausgang. [Fl.Nr. 314]
Adam-Pfeuffer-Straße. Elisabetha-Bildstock, 1931. [Fl.Nr.
1600/1]
Am Massberg. Jüdischer Friedhof, Grabsteine des 19. Jh. [Fl.¬
Nr. 642]
Vor Bamberger Straße 4. Heiligenhäuschen, 2. Hälfte 19.Jh.
[Fl.Nr. 339]
Vor Bamberger Straße 18. Bildstock von 1769. [Fl.Nr. 2316/1]
Burgstraße 1/3. Flügel der ehern. Kaserne, Mitte 18.Jh.;
vgl. Kellereistraße 55/57. [Fl.Nr. 115]
Elisabethastraße 1-27. Einheitliche, geschlossene Reihe von
Ackerbürgerhöfen, zweigeschossige Traufseithäuser, Werk-
Teil Baudenkmäler: Erstellung des Entwurfs ab 1973; Beneh-
men mit den Gemeinden eingeleitet 1974; teilweise Überarbei-
tung 1978; mit Ergänzungen bis 1983. Eintragungsstand: die
Denkmäler sind zum überwiegenden Teil im Einvernehmen mit
den Gemeinden eingetragen. Eine Überarbeitung auf der Grund-
lage der Stellungnahmen der Gemeinden steht noch aus.
Teil archäologische Geländedenkmäler: Erstellung des Entwurfs
1973-77; Benehmen mit den Gemeinden nicht eingeleitet. Ein-
tragungsstand : die Denkmäler sind nicht eingetragen.
Gemeinde Aubstadt
Baudenkmäler
Aubstadt
Evang.-Luth. Pfarrkirche, Turm und Chor mittelalterlich,
Langhaus 1608-1613; mit Ausstattung; spätmittelalterliche
Kirchhofbefestigung mit Torturm.
Archäologische Geländedenkmäler
Mindestens 111 vorgeschichtliche Grabhügel, ca. 1440 m wnw
Kirche Aubstadt, Waldabt. 11,2 Waizschlag; III,2, Mönchs-
holz. [Aubstadt, Fl.Nr. 10705, 10708, NW 105-36/106-36]
Stadt Bad Königshofen i. Grabfeld
Baudenkmäler
Bad Königshofen i. Grabfeld
Ensemble Königshofen i. Grabfeld. - Umgrenzung: Jahnprome-
nade bis Zeughausstraße - rückwärtige südliche Grundstücks-
grenzen der Zeughausstraße entlang Bachverlauf bis Bamberger
Straße - rückwärtige südliche Grundstücksgrenzen der Brau-
hausstraße entlang Bachverlauf bis Südwesteckbastion - westli-
che Festungsgrenze von Südwesteckbastion bis Hindenburg-
straße und Fortsetzung zwischen Hindenburgstraße 26 und 30
bis Juliuspromenade - Verlauf der Juliuspromenade bis Spar-
kassenstraße - entlang Sparkassenstraße bis Ecke Wallstraße -
Verlauf der Wallstraße nach Westen - östliche Grundstück-
grenze vor Kellereistraße 61 - von Schnellerstraße einschließlich
östliches Ravelin bis Jahnpromenade. - Königshofen ist eine
hennebergische Gründungsstadt des 13./14. Jh. Der namenprä-
gende karolingische Königshof befand sich weiter westlich.
Der Stadtgrundriß ragt durch seine geometrische Klarheit her-
vor. Innerhalb eines rechteckigen Umrisses sind die Baublöcke
schachbrettartig verteilt. Vier untereinander parallele Straßen-
züge durchlaufen den Ort der Länge nach. Die Quergassen be-
sitzen nur verbindende Bedeutung. Das Herzstück ist der weit-
räumige, rechteckige Marktplatz, Mittelpunkt des Kreuzes der
Durchgangsstraßen. Der in der Längsachse liegende Haupt-
straßenzug (Hindenburg- und Martin-Reinhard-Straße) er-
fährt am Marktplatz eine Abknickung: von Westen kommend
mündet er bündig mit dessen Südkante, setzt sich aber in der
Flucht der nördlichen Marktplatzwand nach Osten fort. Die-
ser Straßenzug besitzt als einziger beidseitige Hauptbebauung.
Die Parallelstraßen zeigen jeweils nur auf einer Seite Vorder-
hausbebauung, auf der anderen sind sie von Scheunen und
Hintergebäuden begleitet. Die Grundstücke ziehen sich als
schmale, tiefe Streifen von einer Straße zur anderen und besit-
zen eine gleich bleibende Tiefenstaffelung aus Vorderhaus,
Verbindungsflügel und Rückgebäude. Die Wirtschaftsbauten
und der Hof werden ausnahmslos durch die hintere Parallel-
straße erschlossen. Die Stadt besitzt darin deutlichen Acker-
bürgercharakter. In der nordöstlichen Ecke befand sich ur-
sprünglich das Würzburger Amtsschloß. Der Kirchenbezirk
liegt im westlichen Stadtbereich, zwischen Markt und Stadtbe-
festigung. Die Kirche steht auf einem rings von Häuserzeilen
umschlossenen Platz und betont darin und in Verbindung mit
Pfarrhaus, Schule und ehern. Spital ihre herausgehobene Be-
deutung. Von der spätgotischen Pfarrkirche und einigen Bau-
ten der Juliuszeit abgesehen ist der Ort heute in seiner Bebau-
ung durch das 18. und das 19.Jh. geprägt. Großbrände haben
die ältere Bausubstanz weitgehend vernichtet. Die Martin-
Reinhard-Straße zeigt auf ihrer nördlichen Seite eine geschlos-
sene Reihe zweigeschossiger Traufseithäuser des 18. Jh. mit
meist verputzten Fachwerkobergeschossen.
Breiten Raum nehmen im Stadtbild Häuserzeilen der 1. Hälfte
und der Mitte des 19.Jh. mit biedermeierlichem und spätbie-
dermeierlichem Charakter ein. Namentlich die äußeren Stra-
ßenzüge (Elisabetha-, Kellerei- und Schottstraße) sind durch
einheitliche Reihen großer Ackerbürgerhöfe mit zweigeschos-
sigen Werksteinbauten geprägt. Der Marktplatz ist von Bür-
gerhäusern des 18. und des 19. Jh. umgeben. Beherrschend
steht auf seiner Südseite das im 18. Jh. umgestaltete Rathaus
der Juliuszeit. Der spätgotische Turm der Stadtpfarrkirche
wirkt bestimmend in das Platzbild hinein.
Als nordöstlichster Stützpunkt des Hochstifts Würzburg war
Königshofen immer festungsartig ausgebaut. Die einfache
Mauer mit Graben wurde seit dem endenden 16. Jh. um Vor-
werke erweitert. In der ersten Hälfte 18. Jh. bekam der Befe-
stigungsgürtel unter der Leitung Balthasar Neumanns eine
vaubansche Ausgestaltung. An diese im 19. Jh. geschleiften An-
lagen erinnert der breite, die Stadt einfassende Grüngürtel.
Stadtbefestigung. Reste des im 16.-18. Jh. angelegten Festungs-
gürtels: Aufschüttungen der ehern, vier Eckbastionen, im Süd-
osten mit Futtermauer und Gewölben; Futtermauer eines
ehern. Ravelins, am östlichen Stadtausgang. [Fl.Nr. 314]
Adam-Pfeuffer-Straße. Elisabetha-Bildstock, 1931. [Fl.Nr.
1600/1]
Am Massberg. Jüdischer Friedhof, Grabsteine des 19. Jh. [Fl.¬
Nr. 642]
Vor Bamberger Straße 4. Heiligenhäuschen, 2. Hälfte 19.Jh.
[Fl.Nr. 339]
Vor Bamberger Straße 18. Bildstock von 1769. [Fl.Nr. 2316/1]
Burgstraße 1/3. Flügel der ehern. Kaserne, Mitte 18.Jh.;
vgl. Kellereistraße 55/57. [Fl.Nr. 115]
Elisabethastraße 1-27. Einheitliche, geschlossene Reihe von
Ackerbürgerhöfen, zweigeschossige Traufseithäuser, Werk-