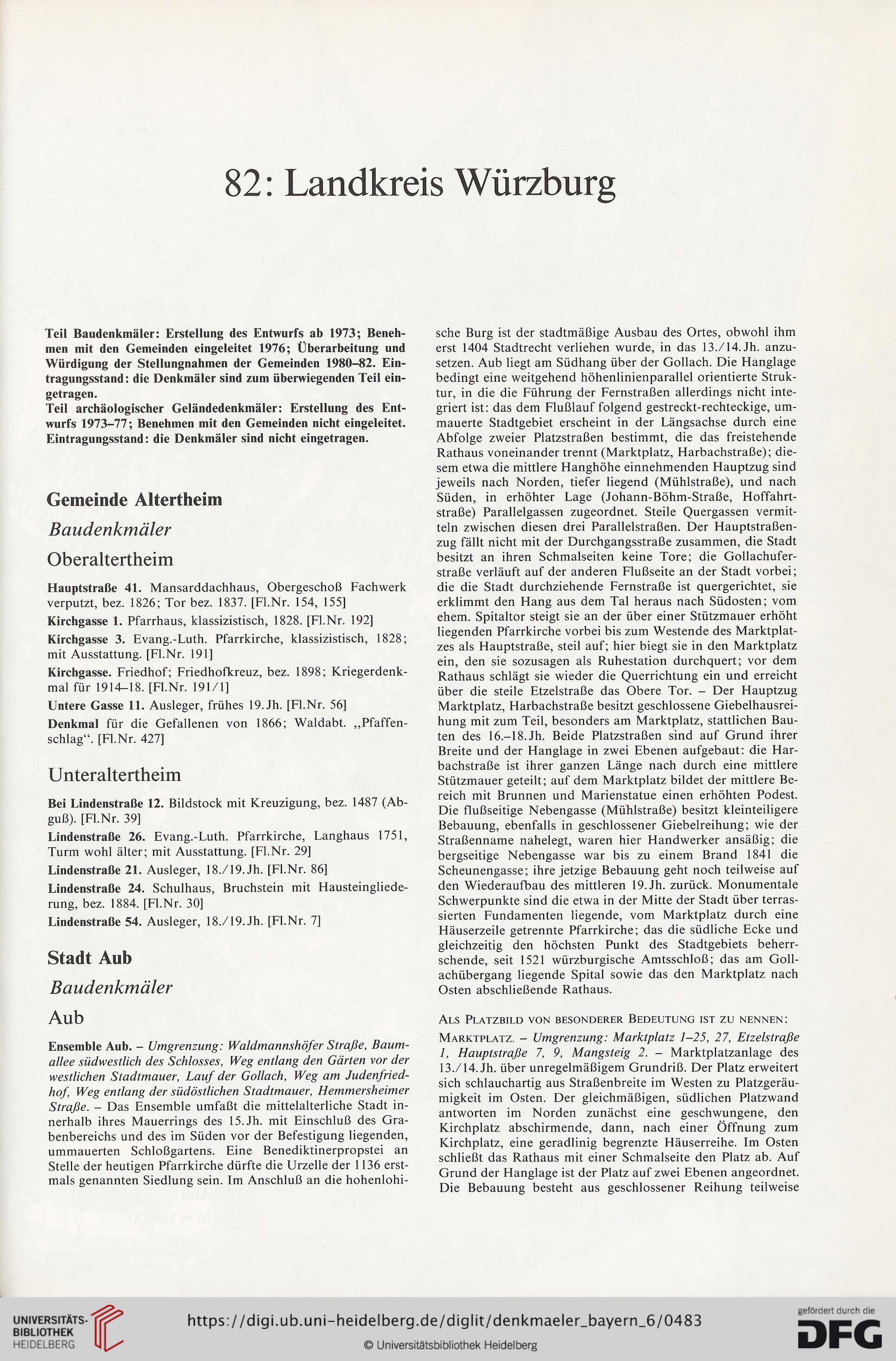82: Landkreis Würzburg
Teil Baudenkmäler: Erstellung des Entwurfs ab 1973; Beneh-
men mit den Gemeinden eingeleitet 1976; Überarbeitung und
Würdigung der Stellungnahmen der Gemeinden 1980-82. Ein-
tragungsstand : die Denkmäler sind zum überwiegenden Teil ein-
getragen.
Teil archäologischer Geländedenkmäler: Erstellung des Ent-
wurfs 1973-77; Benehmen mit den Gemeinden nicht eingeleitet.
Eintragungsstand: die Denkmäler sind nicht eingetragen.
Gemeinde Altertheim
Baudenkmäler
Oberaltertheim
Hauptstraße 41. Mansarddachhaus, Obergeschoß Fachwerk
verputzt, bez. 1826; Tor bez. 1837. [Fl.Nr. 154, 155]
Kirchgasse 1. Pfarrhaus, klassizistisch, 1828. [Fl.Nr. 192]
Kirchgasse 3. Evang.-Luth. Pfarrkirche, klassizistisch, 1828;
mit Ausstattung. [Fl. Nr. 191]
Kirchgasse. Friedhof; Friedhofkreuz, bez. 1898; Kriegerdenk-
mal für 1914-18. [Fl.Nr. 191/1]
Untere Gasse 11. Ausleger, frühes 19. Jh. [Fl.Nr. 56]
Denkmal für die Gefallenen von 1866; Waldabt. „Pfaffen-
schlag“. [Fl.Nr. 427]
Unteraltertheim
Bei Lindenstraße 12. Bildstock mit Kreuzigung, bez. 1487 (Ab-
guß). [Fl.Nr. 39]
Lindenstraße 26. Evang.-Luth. Pfarrkirche, Langhaus 1751,
Turm wohl älter; mit Ausstattung. [Fl.Nr. 29]
Lindenstraße 21. Ausleger, 18./19. Jh. [Fl.Nr. 86]
Lindenstraße 24. Schulhaus, Bruchstein mit Hausteingliede-
rung, bez. 1884. [Fl.Nr. 30]
Lindenstraße 54. Ausleger, 18./19. Jh. [Fl.Nr. 7]
Stadt Aub
Baudenkmäler
Aub
Ensemble Aub. - Umgrenzung: Waldmannshöfer Straße, Baum-
allee südwestlich des Schlosses, Weg entlang den Gärten vor der
westlichen Stadtmauer, Lauf der Gollach, Weg am Judenfried-
hof, Weg entlang der südöstlichen Stadtmauer, Hemmersheimer
Straße. - Das Ensemble umfaßt die mittelalterliche Stadt in-
nerhalb ihres Mauerrings des 15.Jh. mit Einschluß des Gra-
benbereichs und des im Süden vor der Befestigung liegenden,
ummauerten Schloßgartens. Eine Benediktinerpropstei an
Stelle der heutigen Pfarrkirche dürfte die Urzelle der 1136 erst-
mals genannten Siedlung sein. Im Anschluß an die hohenlohi-
sche Burg ist der stadtmäßige Ausbau des Ortes, obwohl ihm
erst 1404 Stadtrecht verliehen wurde, in das 13./14.Jh. anzu-
setzen. Aub liegt am Südhang über der Gollach. Die Hanglage
bedingt eine weitgehend höhenlinienparallel orientierte Struk-
tur, in die die Führung der Fernstraßen allerdings nicht inte-
griert ist: das dem Flußlauf folgend gestreckt-rechteckige, um-
mauerte Stadtgebiet erscheint in der Längsachse durch eine
Abfolge zweier Platzstraßen bestimmt, die das freistehende
Rathaus voneinander trennt (Marktplatz, Harbachstraße); die-
sem etwa die mittlere Hanghöhe einnehmenden Hauptzug sind
jeweils nach Norden, tiefer liegend (Mühlstraße), und nach
Süden, in erhöhter Lage (Johann-Böhm-Straße, Hoffahrt-
straße) Parallelgassen zugeordnet. Steile Quergassen vermit-
teln zwischen diesen drei Parallelstraßen. Der Hauptstraßen-
zug fällt nicht mit der Durchgangsstraße zusammen, die Stadt
besitzt an ihren Schmalseiten keine Tore; die Gollachufer-
straße verläuft auf der anderen Flußseite an der Stadt vorbei;
die die Stadt durchziehende Fernstraße ist quergerichtet, sie
erklimmt den Hang aus dem Tal heraus nach Südosten; vom
ehern. Spitaltor steigt sie an der über einer Stützmauer erhöht
liegenden Pfarrkirche vorbei bis zum Westende des Marktplat-
zes als Hauptstraße, steil auf; hier biegt sie in den Marktplatz
ein, den sie sozusagen als Ruhestation durchquert; vor dem
Rathaus schlägt sie wieder die Querrichtung ein und erreicht
über die steile Etzelstraße das Obere Tor. - Der Hauptzug
Marktplatz, Harbachstraße besitzt geschlossene Giebelhausrei-
hung mit zum Teil, besonders am Marktplatz, stattlichen Bau-
ten des 16.—18. Jh. Beide Platzstraßen sind auf Grund ihrer
Breite und der Hanglage in zwei Ebenen aufgebaut: die Har-
bachstraße ist ihrer ganzen Länge nach durch eine mittlere
Stützmauer geteilt; auf dem Marktplatz bildet der mittlere Be-
reich mit Brunnen und Marienstatue einen erhöhten Podest.
Die flußseitige Nebengasse (Mühlstraße) besitzt kleinteiligere
Bebauung, ebenfalls in geschlossener Giebelreihung; wie der
Straßenname nahelegt, waren hier Handwerker ansäßig; die
bergseitige Nebengasse war bis zu einem Brand 1841 die
Scheunengasse; ihre jetzige Bebauung geht noch teilweise auf
den Wiederaufbau des mittleren 19. Jh. zurück. Monumentale
Schwerpunkte sind die etwa in der Mitte der Stadt über terras-
sierten Fundamenten liegende, vom Marktplatz durch eine
Häuserzeile getrennte Pfarrkirche; das die südliche Ecke und
gleichzeitig den höchsten Punkt des Stadtgebiets beherr-
schende, seit 1521 würzburgische Amtsschloß; das am Goll-
achübergang liegende Spital sowie das den Marktplatz nach
Osten abschließende Rathaus.
Als Platzbild von besonderer Bedeutung ist zu nennen:
Marktplatz. - Umgrenzung: Marktplatz 1-25, 27, Etzelstraße
1, Hauptstraße 7, 9, Mangsteig 2. - Marktplatzanlage des
13./14. Jh. über unregelmäßigem Grundriß. Der Platz erweitert
sich schlauchartig aus Straßenbreite im Westen zu Platzgeräu-
migkeit im Osten. Der gleichmäßigen, südlichen Platzwand
antworten im Norden zunächst eine geschwungene, den
Kirchplatz abschirmende, dann, nach einer Öffnung zum
Kirchplatz, eine geradlinig begrenzte Häuserreihe. Im Osten
schließt das Rathaus mit einer Schmalseite den Platz ab. Auf
Grund der Hanglage ist der Platz auf zwei Ebenen angeordnet.
Die Bebauung besteht aus geschlossener Reihung teilweise
Teil Baudenkmäler: Erstellung des Entwurfs ab 1973; Beneh-
men mit den Gemeinden eingeleitet 1976; Überarbeitung und
Würdigung der Stellungnahmen der Gemeinden 1980-82. Ein-
tragungsstand : die Denkmäler sind zum überwiegenden Teil ein-
getragen.
Teil archäologischer Geländedenkmäler: Erstellung des Ent-
wurfs 1973-77; Benehmen mit den Gemeinden nicht eingeleitet.
Eintragungsstand: die Denkmäler sind nicht eingetragen.
Gemeinde Altertheim
Baudenkmäler
Oberaltertheim
Hauptstraße 41. Mansarddachhaus, Obergeschoß Fachwerk
verputzt, bez. 1826; Tor bez. 1837. [Fl.Nr. 154, 155]
Kirchgasse 1. Pfarrhaus, klassizistisch, 1828. [Fl.Nr. 192]
Kirchgasse 3. Evang.-Luth. Pfarrkirche, klassizistisch, 1828;
mit Ausstattung. [Fl. Nr. 191]
Kirchgasse. Friedhof; Friedhofkreuz, bez. 1898; Kriegerdenk-
mal für 1914-18. [Fl.Nr. 191/1]
Untere Gasse 11. Ausleger, frühes 19. Jh. [Fl.Nr. 56]
Denkmal für die Gefallenen von 1866; Waldabt. „Pfaffen-
schlag“. [Fl.Nr. 427]
Unteraltertheim
Bei Lindenstraße 12. Bildstock mit Kreuzigung, bez. 1487 (Ab-
guß). [Fl.Nr. 39]
Lindenstraße 26. Evang.-Luth. Pfarrkirche, Langhaus 1751,
Turm wohl älter; mit Ausstattung. [Fl.Nr. 29]
Lindenstraße 21. Ausleger, 18./19. Jh. [Fl.Nr. 86]
Lindenstraße 24. Schulhaus, Bruchstein mit Hausteingliede-
rung, bez. 1884. [Fl.Nr. 30]
Lindenstraße 54. Ausleger, 18./19. Jh. [Fl.Nr. 7]
Stadt Aub
Baudenkmäler
Aub
Ensemble Aub. - Umgrenzung: Waldmannshöfer Straße, Baum-
allee südwestlich des Schlosses, Weg entlang den Gärten vor der
westlichen Stadtmauer, Lauf der Gollach, Weg am Judenfried-
hof, Weg entlang der südöstlichen Stadtmauer, Hemmersheimer
Straße. - Das Ensemble umfaßt die mittelalterliche Stadt in-
nerhalb ihres Mauerrings des 15.Jh. mit Einschluß des Gra-
benbereichs und des im Süden vor der Befestigung liegenden,
ummauerten Schloßgartens. Eine Benediktinerpropstei an
Stelle der heutigen Pfarrkirche dürfte die Urzelle der 1136 erst-
mals genannten Siedlung sein. Im Anschluß an die hohenlohi-
sche Burg ist der stadtmäßige Ausbau des Ortes, obwohl ihm
erst 1404 Stadtrecht verliehen wurde, in das 13./14.Jh. anzu-
setzen. Aub liegt am Südhang über der Gollach. Die Hanglage
bedingt eine weitgehend höhenlinienparallel orientierte Struk-
tur, in die die Führung der Fernstraßen allerdings nicht inte-
griert ist: das dem Flußlauf folgend gestreckt-rechteckige, um-
mauerte Stadtgebiet erscheint in der Längsachse durch eine
Abfolge zweier Platzstraßen bestimmt, die das freistehende
Rathaus voneinander trennt (Marktplatz, Harbachstraße); die-
sem etwa die mittlere Hanghöhe einnehmenden Hauptzug sind
jeweils nach Norden, tiefer liegend (Mühlstraße), und nach
Süden, in erhöhter Lage (Johann-Böhm-Straße, Hoffahrt-
straße) Parallelgassen zugeordnet. Steile Quergassen vermit-
teln zwischen diesen drei Parallelstraßen. Der Hauptstraßen-
zug fällt nicht mit der Durchgangsstraße zusammen, die Stadt
besitzt an ihren Schmalseiten keine Tore; die Gollachufer-
straße verläuft auf der anderen Flußseite an der Stadt vorbei;
die die Stadt durchziehende Fernstraße ist quergerichtet, sie
erklimmt den Hang aus dem Tal heraus nach Südosten; vom
ehern. Spitaltor steigt sie an der über einer Stützmauer erhöht
liegenden Pfarrkirche vorbei bis zum Westende des Marktplat-
zes als Hauptstraße, steil auf; hier biegt sie in den Marktplatz
ein, den sie sozusagen als Ruhestation durchquert; vor dem
Rathaus schlägt sie wieder die Querrichtung ein und erreicht
über die steile Etzelstraße das Obere Tor. - Der Hauptzug
Marktplatz, Harbachstraße besitzt geschlossene Giebelhausrei-
hung mit zum Teil, besonders am Marktplatz, stattlichen Bau-
ten des 16.—18. Jh. Beide Platzstraßen sind auf Grund ihrer
Breite und der Hanglage in zwei Ebenen aufgebaut: die Har-
bachstraße ist ihrer ganzen Länge nach durch eine mittlere
Stützmauer geteilt; auf dem Marktplatz bildet der mittlere Be-
reich mit Brunnen und Marienstatue einen erhöhten Podest.
Die flußseitige Nebengasse (Mühlstraße) besitzt kleinteiligere
Bebauung, ebenfalls in geschlossener Giebelreihung; wie der
Straßenname nahelegt, waren hier Handwerker ansäßig; die
bergseitige Nebengasse war bis zu einem Brand 1841 die
Scheunengasse; ihre jetzige Bebauung geht noch teilweise auf
den Wiederaufbau des mittleren 19. Jh. zurück. Monumentale
Schwerpunkte sind die etwa in der Mitte der Stadt über terras-
sierten Fundamenten liegende, vom Marktplatz durch eine
Häuserzeile getrennte Pfarrkirche; das die südliche Ecke und
gleichzeitig den höchsten Punkt des Stadtgebiets beherr-
schende, seit 1521 würzburgische Amtsschloß; das am Goll-
achübergang liegende Spital sowie das den Marktplatz nach
Osten abschließende Rathaus.
Als Platzbild von besonderer Bedeutung ist zu nennen:
Marktplatz. - Umgrenzung: Marktplatz 1-25, 27, Etzelstraße
1, Hauptstraße 7, 9, Mangsteig 2. - Marktplatzanlage des
13./14. Jh. über unregelmäßigem Grundriß. Der Platz erweitert
sich schlauchartig aus Straßenbreite im Westen zu Platzgeräu-
migkeit im Osten. Der gleichmäßigen, südlichen Platzwand
antworten im Norden zunächst eine geschwungene, den
Kirchplatz abschirmende, dann, nach einer Öffnung zum
Kirchplatz, eine geradlinig begrenzte Häuserreihe. Im Osten
schließt das Rathaus mit einer Schmalseite den Platz ab. Auf
Grund der Hanglage ist der Platz auf zwei Ebenen angeordnet.
Die Bebauung besteht aus geschlossener Reihung teilweise