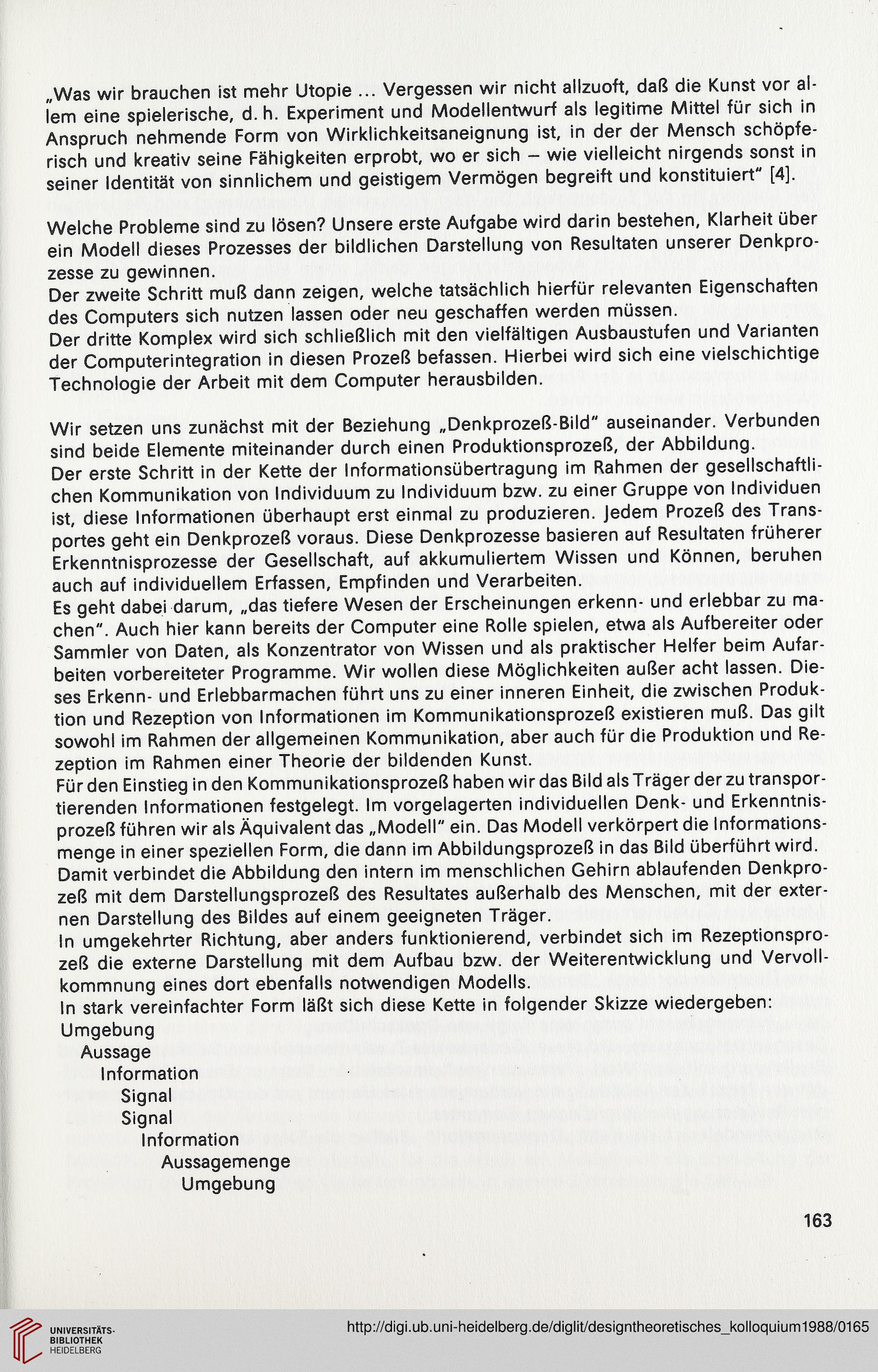„Was wir brauchen ist mehr Utopie ... Vergessen wir nicht allzuoft, daß die Kunst vor al-
lem eine spielerische, d. h. Experiment und Modellentwurf als legitime Mittel für sich in
Anspruch nehmende Form von Wirklichkeitsaneignung ist, in der der Mensch schöpfe-
risch und kreativ seine Fähigkeiten erprobt, wo er sich - wie vielleicht nirgends sonst in
seiner Identität von sinnlichem und geistigem Vermögen begreift und konstituiert" [4],
Welche Probleme sind zu lösen? Unsere erste Aufgabe wird darin bestehen, Klarheit über
ein Modell dieses Prozesses der bildlichen Darstellung von Resultaten unserer Denkpro-
zesse zu gewinnen.
Der zweite Schritt muß dann zeigen, welche tatsächlich hierfür relevanten Eigenschaften
des Computers sich nutzen lassen oder neu geschaffen werden müssen.
Der dritte Komplex wird sich schließlich mit den vielfältigen Ausbaustufen und Varianten
der Computerintegration in diesen Prozeß befassen. Hierbei wird sich eine vielschichtige
Technologie der Arbeit mit dem Computer herausbilden.
Wir setzen uns zunächst mit der Beziehung „Denkprozeß-Bild" auseinander. Verbunden
sind beide Elemente miteinander durch einen Produktionsprozeß, der Abbildung.
Der erste Schritt in der Kette der Informationsübertragung im Rahmen der gesellschaftli-
chen Kommunikation von Individuum zu Individuum bzw. zu einer Gruppe von Individuen
ist, diese Informationen überhaupt erst einmal zu produzieren. Jedem Prozeß des Trans-
portes geht ein Denkprozeß voraus. Diese Denkprozesse basieren auf Resultaten früherer
Erkenntnisprozesse der Gesellschaft, auf akkumuliertem Wissen und Können, beruhen
auch auf individuellem Erfassen, Empfinden und Verarbeiten.
Es geht dabei darum, „das tiefere Wesen der Erscheinungen erkenn- und erlebbar zu ma-
chen". Auch hier kann bereits der Computer eine Rolle spielen, etwa als Aufbereiter oder
Sammler von Daten, als Konzentrator von Wissen und als praktischer Helfer beim Aufar-
beiten vorbereiteter Programme. Wir wollen diese Möglichkeiten außer acht lassen. Die-
ses Erkenn- und Erlebbarmachen führt uns zu einer inneren Einheit, die zwischen Produk-
tion und Rezeption von Informationen im Kommunikationsprozeß existieren muß. Das gilt
sowohl im Rahmen der allgemeinen Kommunikation, aber auch für die Produktion und Re-
zeption im Rahmen einer Theorie der bildenden Kunst.
Für den Einstieg in den Kommunikationsprozeß haben wir das Bild alsTräger derzu transpor-
tierenden Informationen festgelegt. Im vorgelagerten individuellen Denk- und Erkenntnis-
prozeß führen wir als Äquivalent das „Modell" ein. Das Modell verkörpert die Informations-
menge in einer speziellen Form, die dann im Abbildungsprozeß in das Bild überführt wird.
Damit verbindet die Abbildung den intern im menschlichen Gehirn ablaufenden Denkpro-
zeß mit dem Darstellungsprozeß des Resultates außerhalb des Menschen, mit der exter-
nen Darstellung des Bildes auf einem geeigneten Träger.
In umgekehrter Richtung, aber anders funktionierend, verbindet sich im Rezeptionspro-
zeß die externe Darstellung mit dem Aufbau bzw. der Weiterentwicklung und Vervoll-
kommnung eines dort ebenfalls notwendigen Modells.
In stark vereinfachter Form läßt sich diese Kette in folgender Skizze wiedergeben:
Umgebung
Aussage
Information
Signal
Signal
Information
Aussagemenge
Umgebung
163
lem eine spielerische, d. h. Experiment und Modellentwurf als legitime Mittel für sich in
Anspruch nehmende Form von Wirklichkeitsaneignung ist, in der der Mensch schöpfe-
risch und kreativ seine Fähigkeiten erprobt, wo er sich - wie vielleicht nirgends sonst in
seiner Identität von sinnlichem und geistigem Vermögen begreift und konstituiert" [4],
Welche Probleme sind zu lösen? Unsere erste Aufgabe wird darin bestehen, Klarheit über
ein Modell dieses Prozesses der bildlichen Darstellung von Resultaten unserer Denkpro-
zesse zu gewinnen.
Der zweite Schritt muß dann zeigen, welche tatsächlich hierfür relevanten Eigenschaften
des Computers sich nutzen lassen oder neu geschaffen werden müssen.
Der dritte Komplex wird sich schließlich mit den vielfältigen Ausbaustufen und Varianten
der Computerintegration in diesen Prozeß befassen. Hierbei wird sich eine vielschichtige
Technologie der Arbeit mit dem Computer herausbilden.
Wir setzen uns zunächst mit der Beziehung „Denkprozeß-Bild" auseinander. Verbunden
sind beide Elemente miteinander durch einen Produktionsprozeß, der Abbildung.
Der erste Schritt in der Kette der Informationsübertragung im Rahmen der gesellschaftli-
chen Kommunikation von Individuum zu Individuum bzw. zu einer Gruppe von Individuen
ist, diese Informationen überhaupt erst einmal zu produzieren. Jedem Prozeß des Trans-
portes geht ein Denkprozeß voraus. Diese Denkprozesse basieren auf Resultaten früherer
Erkenntnisprozesse der Gesellschaft, auf akkumuliertem Wissen und Können, beruhen
auch auf individuellem Erfassen, Empfinden und Verarbeiten.
Es geht dabei darum, „das tiefere Wesen der Erscheinungen erkenn- und erlebbar zu ma-
chen". Auch hier kann bereits der Computer eine Rolle spielen, etwa als Aufbereiter oder
Sammler von Daten, als Konzentrator von Wissen und als praktischer Helfer beim Aufar-
beiten vorbereiteter Programme. Wir wollen diese Möglichkeiten außer acht lassen. Die-
ses Erkenn- und Erlebbarmachen führt uns zu einer inneren Einheit, die zwischen Produk-
tion und Rezeption von Informationen im Kommunikationsprozeß existieren muß. Das gilt
sowohl im Rahmen der allgemeinen Kommunikation, aber auch für die Produktion und Re-
zeption im Rahmen einer Theorie der bildenden Kunst.
Für den Einstieg in den Kommunikationsprozeß haben wir das Bild alsTräger derzu transpor-
tierenden Informationen festgelegt. Im vorgelagerten individuellen Denk- und Erkenntnis-
prozeß führen wir als Äquivalent das „Modell" ein. Das Modell verkörpert die Informations-
menge in einer speziellen Form, die dann im Abbildungsprozeß in das Bild überführt wird.
Damit verbindet die Abbildung den intern im menschlichen Gehirn ablaufenden Denkpro-
zeß mit dem Darstellungsprozeß des Resultates außerhalb des Menschen, mit der exter-
nen Darstellung des Bildes auf einem geeigneten Träger.
In umgekehrter Richtung, aber anders funktionierend, verbindet sich im Rezeptionspro-
zeß die externe Darstellung mit dem Aufbau bzw. der Weiterentwicklung und Vervoll-
kommnung eines dort ebenfalls notwendigen Modells.
In stark vereinfachter Form läßt sich diese Kette in folgender Skizze wiedergeben:
Umgebung
Aussage
Information
Signal
Signal
Information
Aussagemenge
Umgebung
163