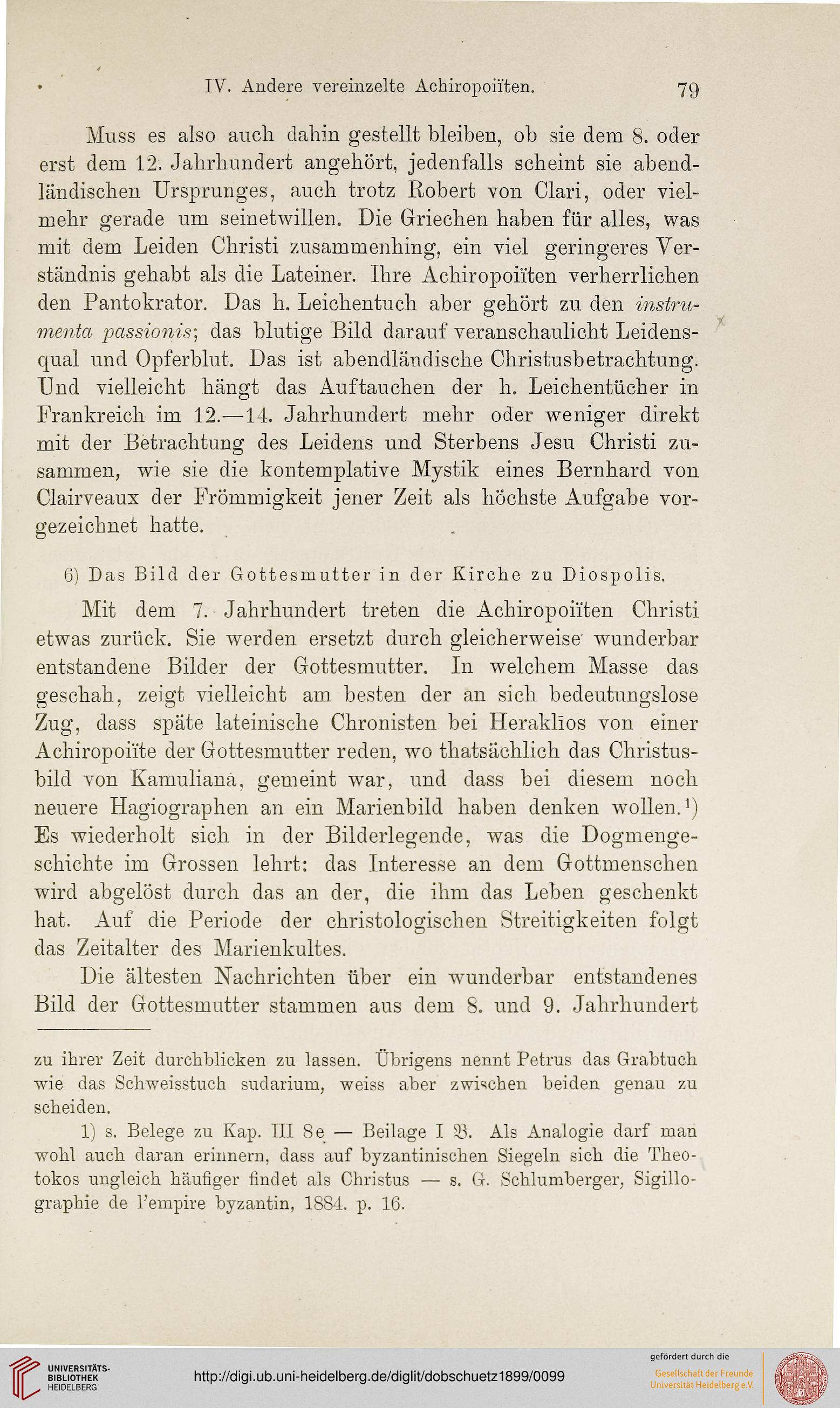IV. Andere vereinzelte Achiropoü'ten.
79
Muss es also auch dahin gestellt bleiben, ob sie dem 8. oder
erst dem 12. Jahrhundert angehört, jedenfalls scheint sie abend-
ländischen Ursprunges, auch trotz Robert von Clari, oder viel-
mehr gerade um seinetwillen. Die Griechen haben für alles, was
mit dem Leiden Christi zusammenhing, ein viel geringeres Ver-
ständnis gehabt als die Lateiner. Ihre Achiropoi'iten verherrlichen
den Pantokrator. Das h. Leichentuch aber gehört zu den instru-
menta passionis; das blutige Bild darauf veranschaulicht Leidens-
qual und Opferblut. Das ist abendländische Christusbetrachtung.
Und vielleicht hängt das Auftauchen der h. Leichentücher in
Frankreich im 12.·—14. Jahrhundert mehr oder weniger direkt
mit der Betrachtung des Leidens und Sterbens Jesu Christi zu-
sammen, wie sie die kontemplative Mystik eines Bernhard von
Clairveaux der Frömmigkeit jener Zeit als höchste Aufgabe vor-
gezeicbnet hatte.
6) Das Bild der Gottesmutter in der Kirche zu Diospolis.
Mit dem 7. Jahrhundert treten die Achiropoi'iten Christi
etwas zurück. Sie werden ersetzt durch gleicherweise wunderbar
entstandene Bilder der Gottesmutter. In welchem Masse das
geschah, zeigt vielleicht am besten der an sich bedeutungslose
Zug, dass späte lateinische Chronisten bei Heraklios von einer
Achiropoi'ite der Gottesmutter reden, wo thatsächlich das Christus-
bild von Kamulianä, gemeint war, und dass bei diesem noch
neuere Hagiographen an ein Marienbild haben denken wollen.1)
Es wiederholt sich in der Bilderlegende, was die Dogmenge-
schichte im Grossen lehrt: das Interesse an dem Gottmenschen
wird abgelöst durch das an der, die ihm das Leben geschenkt
hat. Auf die Periode der christologischen Streitigkeiten folgt
das Zeitalter des Marienkultes.
Die ältesten Nachrichten über ein wunderbar entstandenes
Bild der Gottesmutter stammen aus dem 8. und 9. Jahrhundert
zu ihrer Zeit durchblicken zu lassen. Übrigens nennt Petrus das Grabtuch
wie das Schweisstuch sudarium, weiss aber zwischen beiden genau zu
scheiden.
1) s. Belege zu Kap. III 8e — Beilage I 53. Als Analogie darf man
wohl auch daran erinnern, dass auf byzantinischen Siegeln sich die Theo-
tokos ungleich häufiger findet als Christus — B. G. Schlumberger, Sigillo-
graphie de l'empire byzantin, 18S4. p. 16.
79
Muss es also auch dahin gestellt bleiben, ob sie dem 8. oder
erst dem 12. Jahrhundert angehört, jedenfalls scheint sie abend-
ländischen Ursprunges, auch trotz Robert von Clari, oder viel-
mehr gerade um seinetwillen. Die Griechen haben für alles, was
mit dem Leiden Christi zusammenhing, ein viel geringeres Ver-
ständnis gehabt als die Lateiner. Ihre Achiropoi'iten verherrlichen
den Pantokrator. Das h. Leichentuch aber gehört zu den instru-
menta passionis; das blutige Bild darauf veranschaulicht Leidens-
qual und Opferblut. Das ist abendländische Christusbetrachtung.
Und vielleicht hängt das Auftauchen der h. Leichentücher in
Frankreich im 12.·—14. Jahrhundert mehr oder weniger direkt
mit der Betrachtung des Leidens und Sterbens Jesu Christi zu-
sammen, wie sie die kontemplative Mystik eines Bernhard von
Clairveaux der Frömmigkeit jener Zeit als höchste Aufgabe vor-
gezeicbnet hatte.
6) Das Bild der Gottesmutter in der Kirche zu Diospolis.
Mit dem 7. Jahrhundert treten die Achiropoi'iten Christi
etwas zurück. Sie werden ersetzt durch gleicherweise wunderbar
entstandene Bilder der Gottesmutter. In welchem Masse das
geschah, zeigt vielleicht am besten der an sich bedeutungslose
Zug, dass späte lateinische Chronisten bei Heraklios von einer
Achiropoi'ite der Gottesmutter reden, wo thatsächlich das Christus-
bild von Kamulianä, gemeint war, und dass bei diesem noch
neuere Hagiographen an ein Marienbild haben denken wollen.1)
Es wiederholt sich in der Bilderlegende, was die Dogmenge-
schichte im Grossen lehrt: das Interesse an dem Gottmenschen
wird abgelöst durch das an der, die ihm das Leben geschenkt
hat. Auf die Periode der christologischen Streitigkeiten folgt
das Zeitalter des Marienkultes.
Die ältesten Nachrichten über ein wunderbar entstandenes
Bild der Gottesmutter stammen aus dem 8. und 9. Jahrhundert
zu ihrer Zeit durchblicken zu lassen. Übrigens nennt Petrus das Grabtuch
wie das Schweisstuch sudarium, weiss aber zwischen beiden genau zu
scheiden.
1) s. Belege zu Kap. III 8e — Beilage I 53. Als Analogie darf man
wohl auch daran erinnern, dass auf byzantinischen Siegeln sich die Theo-
tokos ungleich häufiger findet als Christus — B. G. Schlumberger, Sigillo-
graphie de l'empire byzantin, 18S4. p. 16.