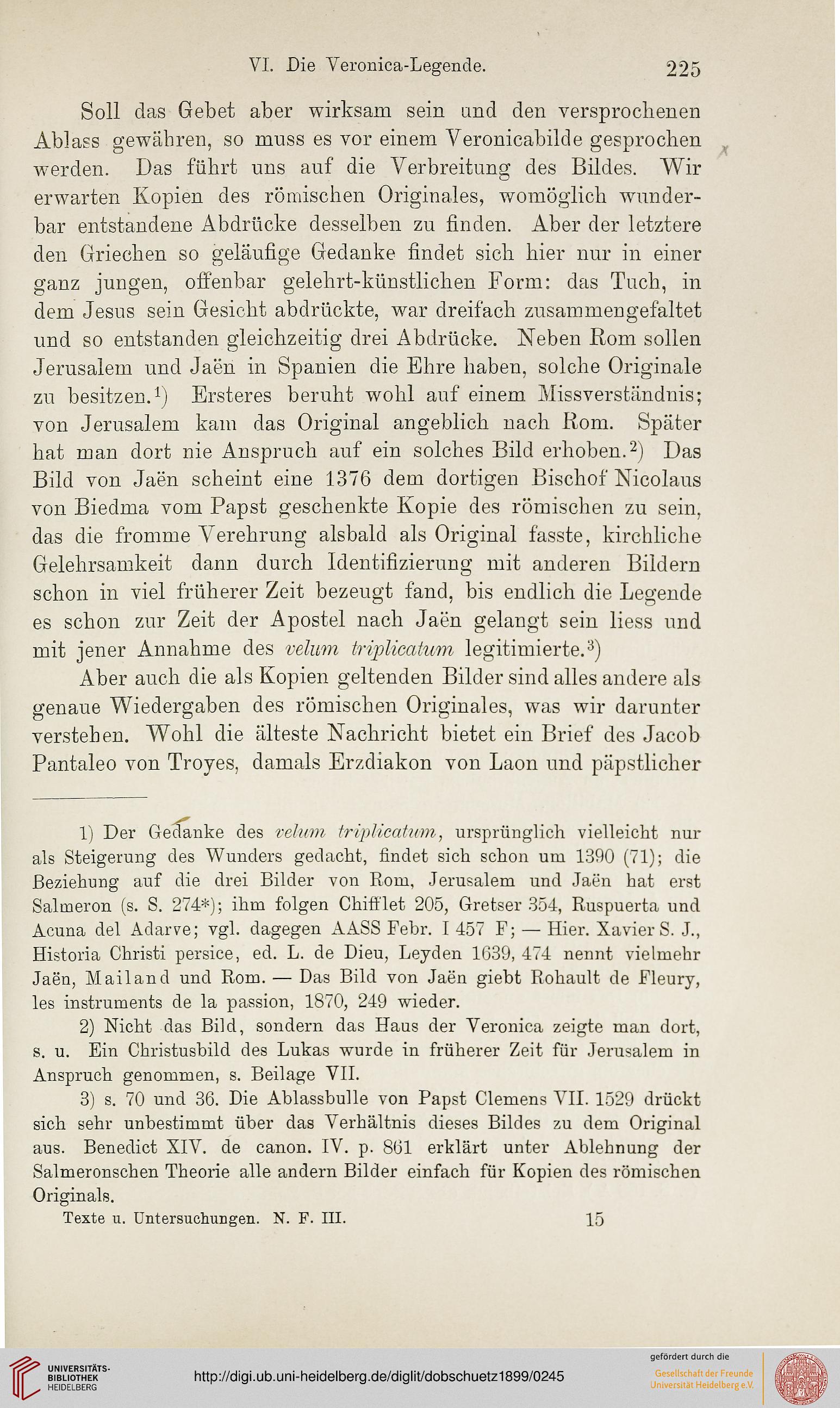VI. Die Veronica-Legende.
225
Soll das Gebet aber wirksam sein and den versprochenen
Ablass gewähren, so muss es vor einem Veronicabilde gesprochen
werden. Das führt uns auf die Verbreitung des Bildes. Wir
erwarten Kopien des römischen Originales, womöglich wunder-
bar entstandene Abdrücke desselben zu finden. Aber der letztere
den Griechen so geläufige Gedanke findet sich hier nur in einer
ganz jungen, offenbar gelehrt-künstlichen Form: das Tuch, in
dem Jesus sein Gesicht abdrückte, war dreifach zusammengefaltet
und so entstanden gleichzeitig drei Abdrücke. Neben Rom sollen
Jerusalem und Jaen in Spanien die Ehre haben, solche Originale
zu besitzen.1) Ersteres beruht wohl auf einem Missverständnis;
von Jerusalem kam das Original angeblich nach Rom. Später
hat man dort nie Anspruch auf ein solches Bild erhoben.2) Das
Bild von Jaen scheint eine 1376 dem dortigen Bischof Nicolaus
von Biedma vom Papst geschenkte Kopie des römischen zu sein,
das die fromme Verehrung alsbald als Original fasste, kirchliche
Gelehrsamkeit dann durch Identifizierung mit anderen Bildern
schon in viel früherer Zeit bezeugt fand, bis endlich die Legende
es schon zur Zeit der Apostel nach Jaen gelangt sein liess und
mit jener Annahme des velum triplicatum legitimierte.3)
Aber auch die als Kopien geltenden Bilder sind alles andere als
genaue Wiedergaben des römischen Originales, was wir darunter
verstehen. Wohl die älteste Nachricht bietet ein Brief des Jacob
Pantaleo von Troyes, damals Erzdiakon von Laon und päpstlicher
1) Der Geiianke des velum triplicatum, ursprünglich vielleicht nur
als Steigerung des Wunders gedacht, findet sich schon um 1390 (71); die
Beziehung auf die drei Bilder von Rom, Jerusalem und Jaen hat erst
Salineron (s. S. 274*); ihm folgen Chifflet 205, Gretser 354, Ruspuerta und
Acuna del Adarve; vgl. dagegen AASS Febr. I 457 F; — Hier. XavierS. J.,
Historia Christi persice, ed. L. de Dieu, Leyden 1G39, 474 nennt vielmehr
Jaen, Mailand und Rom. — Das Bild von Jaen giebt Rohault de Fleury,
les Instruments de la passion, 1870, 249 wieder.
2) Nicht das Bild, sondern das Haus der Veronica zeigte man dort,
s. u. Ein Christusbild des Lukas wurde in früherer Zeit für Jerusalem in
Anspruch genommen, s. Beilage VII.
3) s. 70 und 36. Die Ablassbulle von Papst Clemens VII. 1529 drückt
sich sehr unbestimmt über das Verhältnis dieses Bildes zu dem Original
aus. Benedict XIV. de canon. IV. p. 861 erklärt unter Ablehnung der
Salmeronschen Theorie alle andern Bilder einfach für Kopien des römischen
Originals.
Texte u. Untersuchungen. N. F. III. 15
225
Soll das Gebet aber wirksam sein and den versprochenen
Ablass gewähren, so muss es vor einem Veronicabilde gesprochen
werden. Das führt uns auf die Verbreitung des Bildes. Wir
erwarten Kopien des römischen Originales, womöglich wunder-
bar entstandene Abdrücke desselben zu finden. Aber der letztere
den Griechen so geläufige Gedanke findet sich hier nur in einer
ganz jungen, offenbar gelehrt-künstlichen Form: das Tuch, in
dem Jesus sein Gesicht abdrückte, war dreifach zusammengefaltet
und so entstanden gleichzeitig drei Abdrücke. Neben Rom sollen
Jerusalem und Jaen in Spanien die Ehre haben, solche Originale
zu besitzen.1) Ersteres beruht wohl auf einem Missverständnis;
von Jerusalem kam das Original angeblich nach Rom. Später
hat man dort nie Anspruch auf ein solches Bild erhoben.2) Das
Bild von Jaen scheint eine 1376 dem dortigen Bischof Nicolaus
von Biedma vom Papst geschenkte Kopie des römischen zu sein,
das die fromme Verehrung alsbald als Original fasste, kirchliche
Gelehrsamkeit dann durch Identifizierung mit anderen Bildern
schon in viel früherer Zeit bezeugt fand, bis endlich die Legende
es schon zur Zeit der Apostel nach Jaen gelangt sein liess und
mit jener Annahme des velum triplicatum legitimierte.3)
Aber auch die als Kopien geltenden Bilder sind alles andere als
genaue Wiedergaben des römischen Originales, was wir darunter
verstehen. Wohl die älteste Nachricht bietet ein Brief des Jacob
Pantaleo von Troyes, damals Erzdiakon von Laon und päpstlicher
1) Der Geiianke des velum triplicatum, ursprünglich vielleicht nur
als Steigerung des Wunders gedacht, findet sich schon um 1390 (71); die
Beziehung auf die drei Bilder von Rom, Jerusalem und Jaen hat erst
Salineron (s. S. 274*); ihm folgen Chifflet 205, Gretser 354, Ruspuerta und
Acuna del Adarve; vgl. dagegen AASS Febr. I 457 F; — Hier. XavierS. J.,
Historia Christi persice, ed. L. de Dieu, Leyden 1G39, 474 nennt vielmehr
Jaen, Mailand und Rom. — Das Bild von Jaen giebt Rohault de Fleury,
les Instruments de la passion, 1870, 249 wieder.
2) Nicht das Bild, sondern das Haus der Veronica zeigte man dort,
s. u. Ein Christusbild des Lukas wurde in früherer Zeit für Jerusalem in
Anspruch genommen, s. Beilage VII.
3) s. 70 und 36. Die Ablassbulle von Papst Clemens VII. 1529 drückt
sich sehr unbestimmt über das Verhältnis dieses Bildes zu dem Original
aus. Benedict XIV. de canon. IV. p. 861 erklärt unter Ablehnung der
Salmeronschen Theorie alle andern Bilder einfach für Kopien des römischen
Originals.
Texte u. Untersuchungen. N. F. III. 15