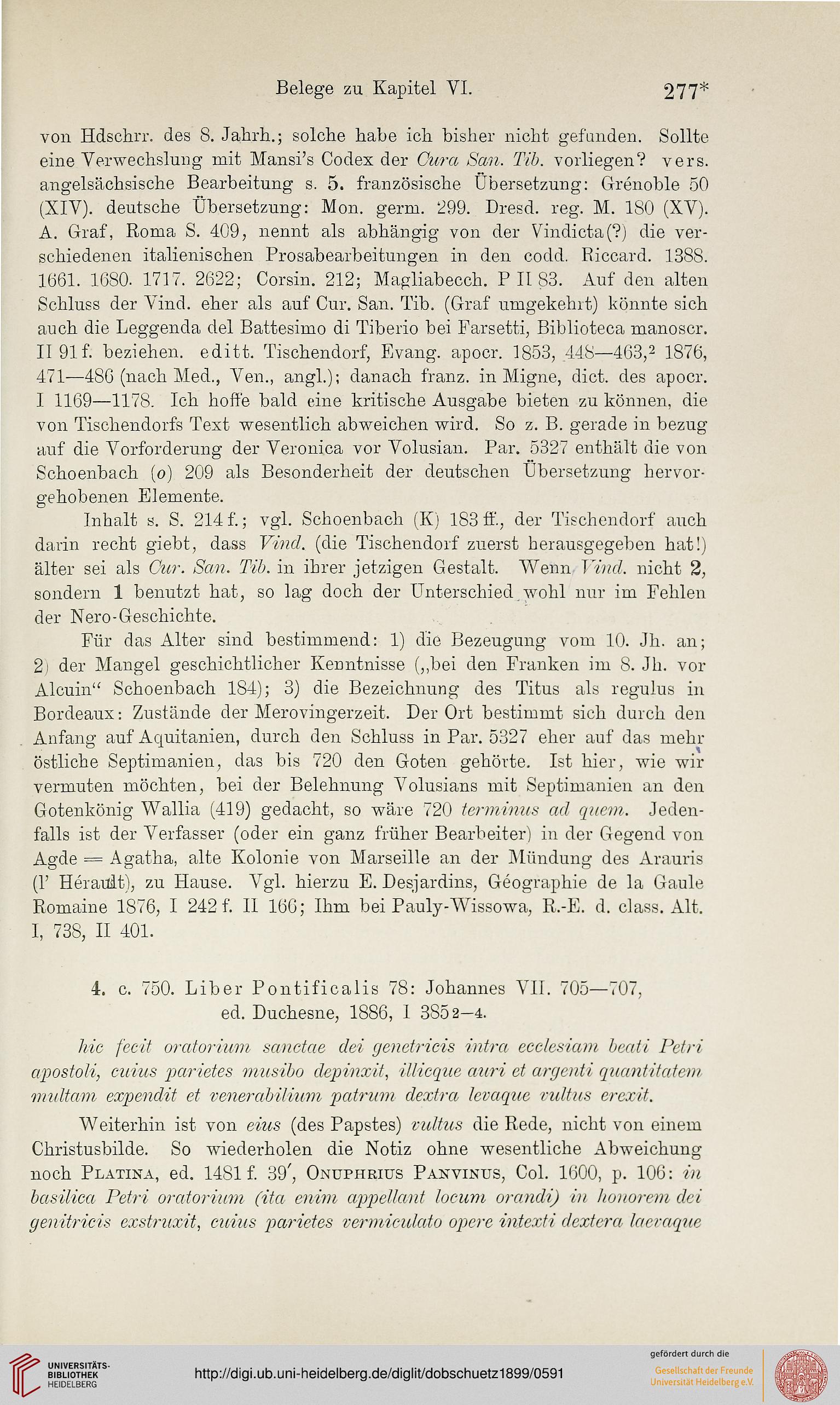Belege zu Kapitel VI.
277*
von Hdschrr. des 8. Jahrh.; solche habe ich bisher nicht gefunden. Sollte
eine Verwechslung mit Mansi's Codex der Cura San. Tib. vorliegen? vers.
angelsächsische Bearbeitung s. δ. französische Obersetzung: Grenoble 50
(XIV). deutsche Übersetzung: Mon. gerni. 299. Dresd. reg. M. ISO (XV).
A. Graf, Roma S. 409, nennt als abhängig von der Vindicta(?) die ver-
schiedenen italienischen Prosabearbeitungen in den codd. Riccard. 1388.
1661. 1680. 1717. 2622; Corsin. 212; Magliabecch. Ρ II 83. Auf den alten
Schluss der Vind. eher als auf Cur. San. Tib. (Graf umgekehrt) könnte sich
auch die Leggenda del Battesimo di Tiberio bei Farsetti, Biblioteca manoscr.
II 91 f. beziehen, editt. Tischendorf, Evang. apocr. 1853, 448—463,2 1876,
471—486 (nach Med., Ven., angl.); danach franz. in Migne, dict. des apocr.
1 1169—1178. Ich hoffe bald eine kritische Ausgabe bieten zu können, die
von Tischendorfs Text wesentlich abweichen wird. So ζ. B. gerade in bezug
auf die Vorforderung der Veronica vor Volusian. Par. 5327 enthält die von
Schoenbach (o) 209 als Besonderheit der deutschen Ubersetzung hervor-
gehobenen Elemente.
Inhalt s. S. 214f.; vgl. Schoenbach (K) 183 ff., der Tischendorf auch
darin recht giebt, dass Vind. (die Tischendorf zuerst herausgegeben hat!)
älter sei als Cur. San. Tili, in ihrer jetzigen Gestalt. Wenn Vind. nicht 2,
sondern 1 benutzt hat, so lag doch der Unterschied wohl nur im Fehlen
der Nero-Geschichte.
Für das Alter sind bestimmend: 1) die Bezeugung vom 10. Jh. an;
2 der Mangel geschichtlicher Kenntnisse (,,bei den Franken im S. Jh. vor
Alcuin" Schoenbach 184); 3) die Bezeichnung des Titus als regulus in
Bordeaux: Zustände der Merovingerzeit. Der Ort bestimmt sich durch den
Anfang auf Aquitanien, durch den Schluss in Par. 5327 eher auf das mehr
östliche Septimanien, das bis 720 den Goten gehörte. Ist hier, wie wir
vermuten möchten, bei der Belehnung Volusians mit Septimanien an den
Gotenkönig Wallia (419) gedacht, so wäre 720 terminus ad quem. Jeden-
falls ist der Verfasser (oder ein ganz früher Bearbeiter) in der Gegend von
Agde = Agatha, alte Kolonie von Marseille an der Mündung des Arauris
(Γ Herauit), zu Hause. Vgl. hierzu E. Desjardins, Geographie de la Gaule
Romaine 1876, I 242 f. II 166; Ihm bei Pauly-Wissowa, R.-E. d. class. Alt.
I, 73S, II 401.
4. c. 750. Liber Pontificalis 78: Johannes VII. 705—707,
ed. Duchesne, 1886, 1 3852-4.
hie fecit Oratorium sanetae dei genetricis intra ecclesiam beati Petri
apostoli, caius parietes musibo depinxit, illicque auri et argenti quantitatem
multam expendit et venerabilium patrum dextra levaque vultus erexit.
Weiterhin ist von eius (des Papstes) vultus die Rede, nicht von einem
Christusbilde. So wiederholen die Notiz ohne wesentliche Abweichung
noch Plätina, ed. 1481 f. 39', Onuphriüs Pajstvinus, Col. 1600, p. 106: in
basilica Petri Oratorium (ita enim appellant locuni orandi) in honorem dei
genitricis exstruxit, cuius parietes vermiculato opcre intexti dextcra laevaque
277*
von Hdschrr. des 8. Jahrh.; solche habe ich bisher nicht gefunden. Sollte
eine Verwechslung mit Mansi's Codex der Cura San. Tib. vorliegen? vers.
angelsächsische Bearbeitung s. δ. französische Obersetzung: Grenoble 50
(XIV). deutsche Übersetzung: Mon. gerni. 299. Dresd. reg. M. ISO (XV).
A. Graf, Roma S. 409, nennt als abhängig von der Vindicta(?) die ver-
schiedenen italienischen Prosabearbeitungen in den codd. Riccard. 1388.
1661. 1680. 1717. 2622; Corsin. 212; Magliabecch. Ρ II 83. Auf den alten
Schluss der Vind. eher als auf Cur. San. Tib. (Graf umgekehrt) könnte sich
auch die Leggenda del Battesimo di Tiberio bei Farsetti, Biblioteca manoscr.
II 91 f. beziehen, editt. Tischendorf, Evang. apocr. 1853, 448—463,2 1876,
471—486 (nach Med., Ven., angl.); danach franz. in Migne, dict. des apocr.
1 1169—1178. Ich hoffe bald eine kritische Ausgabe bieten zu können, die
von Tischendorfs Text wesentlich abweichen wird. So ζ. B. gerade in bezug
auf die Vorforderung der Veronica vor Volusian. Par. 5327 enthält die von
Schoenbach (o) 209 als Besonderheit der deutschen Ubersetzung hervor-
gehobenen Elemente.
Inhalt s. S. 214f.; vgl. Schoenbach (K) 183 ff., der Tischendorf auch
darin recht giebt, dass Vind. (die Tischendorf zuerst herausgegeben hat!)
älter sei als Cur. San. Tili, in ihrer jetzigen Gestalt. Wenn Vind. nicht 2,
sondern 1 benutzt hat, so lag doch der Unterschied wohl nur im Fehlen
der Nero-Geschichte.
Für das Alter sind bestimmend: 1) die Bezeugung vom 10. Jh. an;
2 der Mangel geschichtlicher Kenntnisse (,,bei den Franken im S. Jh. vor
Alcuin" Schoenbach 184); 3) die Bezeichnung des Titus als regulus in
Bordeaux: Zustände der Merovingerzeit. Der Ort bestimmt sich durch den
Anfang auf Aquitanien, durch den Schluss in Par. 5327 eher auf das mehr
östliche Septimanien, das bis 720 den Goten gehörte. Ist hier, wie wir
vermuten möchten, bei der Belehnung Volusians mit Septimanien an den
Gotenkönig Wallia (419) gedacht, so wäre 720 terminus ad quem. Jeden-
falls ist der Verfasser (oder ein ganz früher Bearbeiter) in der Gegend von
Agde = Agatha, alte Kolonie von Marseille an der Mündung des Arauris
(Γ Herauit), zu Hause. Vgl. hierzu E. Desjardins, Geographie de la Gaule
Romaine 1876, I 242 f. II 166; Ihm bei Pauly-Wissowa, R.-E. d. class. Alt.
I, 73S, II 401.
4. c. 750. Liber Pontificalis 78: Johannes VII. 705—707,
ed. Duchesne, 1886, 1 3852-4.
hie fecit Oratorium sanetae dei genetricis intra ecclesiam beati Petri
apostoli, caius parietes musibo depinxit, illicque auri et argenti quantitatem
multam expendit et venerabilium patrum dextra levaque vultus erexit.
Weiterhin ist von eius (des Papstes) vultus die Rede, nicht von einem
Christusbilde. So wiederholen die Notiz ohne wesentliche Abweichung
noch Plätina, ed. 1481 f. 39', Onuphriüs Pajstvinus, Col. 1600, p. 106: in
basilica Petri Oratorium (ita enim appellant locuni orandi) in honorem dei
genitricis exstruxit, cuius parietes vermiculato opcre intexti dextcra laevaque