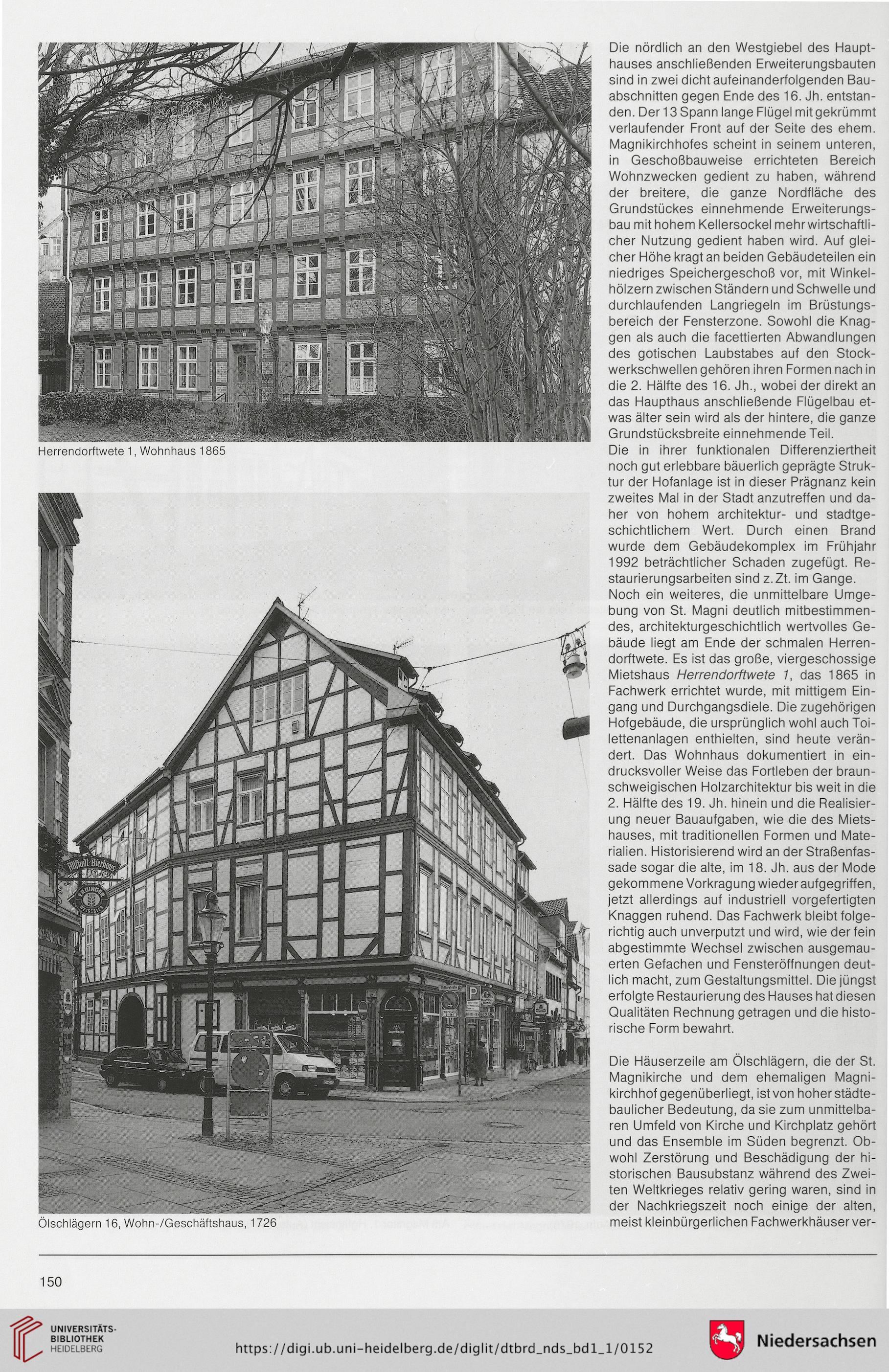Herrendorftwete 1, Wohnhaus 1865
Ölschlägern 16, Wohn-/Geschäftshaus, 1726
Die nördlich an den Westgiebel des Haupt-
hauses anschließenden Erweiterungsbauten
sind in zwei dicht aufeinanderfolgenden Bau-
abschnitten gegen Ende des 16. Jh. entstan-
den. Der 13 Spann lange Flügel mit gekrümmt
verlaufender Front auf der Seite des ehern.
Magnikirchhofes scheint in seinem unteren,
in Geschoßbauweise errichteten Bereich
Wohnzwecken gedient zu haben, während
der breitere, die ganze Nordfläche des
Grundstückes einnehmende Erweiterungs-
bau mit hohem Kellersockel mehr wirtschaftli-
cher Nutzung gedient haben wird. Auf glei-
cher Höhe kragt an beiden Gebäudeteilen ein
niedriges Speichergeschoß vor, mit Winkel-
hölzern zwischen Ständern und Schwelle und
durchlaufenden Langriegeln im Brüstungs-
bereich der Fensterzone. Sowohl die Knag-
gen als auch die facettierten Abwandlungen
des gotischen Laubstabes auf den Stock-
werkschwellen gehören ihren Formen nach in
die 2. Hälfte des 16. Jh., wobei der direkt an
das Haupthaus anschließende Flügelbau et-
was älter sein wird als der hintere, die ganze
Grundstücksbreite einnehmende Teil.
Die in ihrer funktionalen Differenziertheit
noch gut erlebbare bäuerlich geprägte Struk-
tur der Hofanlage ist in dieser Prägnanz kein
zweites Mal in der Stadt anzutreffen und da-
her von hohem architektur- und stadtge-
schichtlichem Wert. Durch einen Brand
wurde dem Gebäudekomplex im Frühjahr
1992 beträchtlicher Schaden zugefügt. Re-
staurierungsarbeiten sind z.Zt. im Gange.
Noch ein weiteres, die unmittelbare Umge-
bung von St. Magni deutlich mitbestimmen-
des, architekturgeschichtlich wertvolles Ge-
bäude liegt am Ende der schmalen Herren-
dorftwete. Es ist das große, viergeschossige
Mietshaus Herrendorftwete 1, das 1865 in
Fachwerk errichtet wurde, mit mittigem Ein-
gang und Durchgangsdiele. Die zugehörigen
Hofgebäude, die ursprünglich wohl auch Toi-
lettenanlagen enthielten, sind heute verän-
dert. Das Wohnhaus dokumentiert in ein-
drucksvoller Weise das Fortleben der braun-
schweigischen Holzarchitektur bis weit in die
2. Hälfte des 19. Jh. hinein und die Realisier-
ung neuer Bauaufgaben, wie die des Miets-
hauses, mit traditionellen Formen und Mate-
rialien. Historisierend wird an der Straßenfas-
sade sogar die alte, im 18. Jh. aus der Mode
gekommene Vorkragung wieder aufgegriffen,
jetzt allerdings auf industriell vorgefertigten
Knaggen ruhend. Das Fachwerk bleibt folge-
richtig auch unverputzt und wird, wie der fein
abgestimmte Wechsel zwischen ausgemau-
erten Gefachen und Fensteröffnungen deut-
lich macht, zum Gestaltungsmittel. Die jüngst
erfolgte Restaurierung des Hauses hat diesen
Qualitäten Rechnung getragen und die histo-
rische Form bewahrt.
Die Häuserzeile am Ölschlägern, die der St.
Magnikirche und dem ehemaligen Magni-
kirchhof gegenüberliegt, ist von hoher städte-
baulicher Bedeutung, da sie zum unmittelba-
ren Umfeld von Kirche und Kirchplatz gehört
und das Ensemble im Süden begrenzt. Ob-
wohl Zerstörung und Beschädigung der hi-
storischen Bausubstanz während des Zwei-
ten Weltkrieges relativ gering waren, sind in
der Nachkriegszeit noch einige der alten,
meist kleinbürgerlichen Fachwerkhäuser ver-
150
Ölschlägern 16, Wohn-/Geschäftshaus, 1726
Die nördlich an den Westgiebel des Haupt-
hauses anschließenden Erweiterungsbauten
sind in zwei dicht aufeinanderfolgenden Bau-
abschnitten gegen Ende des 16. Jh. entstan-
den. Der 13 Spann lange Flügel mit gekrümmt
verlaufender Front auf der Seite des ehern.
Magnikirchhofes scheint in seinem unteren,
in Geschoßbauweise errichteten Bereich
Wohnzwecken gedient zu haben, während
der breitere, die ganze Nordfläche des
Grundstückes einnehmende Erweiterungs-
bau mit hohem Kellersockel mehr wirtschaftli-
cher Nutzung gedient haben wird. Auf glei-
cher Höhe kragt an beiden Gebäudeteilen ein
niedriges Speichergeschoß vor, mit Winkel-
hölzern zwischen Ständern und Schwelle und
durchlaufenden Langriegeln im Brüstungs-
bereich der Fensterzone. Sowohl die Knag-
gen als auch die facettierten Abwandlungen
des gotischen Laubstabes auf den Stock-
werkschwellen gehören ihren Formen nach in
die 2. Hälfte des 16. Jh., wobei der direkt an
das Haupthaus anschließende Flügelbau et-
was älter sein wird als der hintere, die ganze
Grundstücksbreite einnehmende Teil.
Die in ihrer funktionalen Differenziertheit
noch gut erlebbare bäuerlich geprägte Struk-
tur der Hofanlage ist in dieser Prägnanz kein
zweites Mal in der Stadt anzutreffen und da-
her von hohem architektur- und stadtge-
schichtlichem Wert. Durch einen Brand
wurde dem Gebäudekomplex im Frühjahr
1992 beträchtlicher Schaden zugefügt. Re-
staurierungsarbeiten sind z.Zt. im Gange.
Noch ein weiteres, die unmittelbare Umge-
bung von St. Magni deutlich mitbestimmen-
des, architekturgeschichtlich wertvolles Ge-
bäude liegt am Ende der schmalen Herren-
dorftwete. Es ist das große, viergeschossige
Mietshaus Herrendorftwete 1, das 1865 in
Fachwerk errichtet wurde, mit mittigem Ein-
gang und Durchgangsdiele. Die zugehörigen
Hofgebäude, die ursprünglich wohl auch Toi-
lettenanlagen enthielten, sind heute verän-
dert. Das Wohnhaus dokumentiert in ein-
drucksvoller Weise das Fortleben der braun-
schweigischen Holzarchitektur bis weit in die
2. Hälfte des 19. Jh. hinein und die Realisier-
ung neuer Bauaufgaben, wie die des Miets-
hauses, mit traditionellen Formen und Mate-
rialien. Historisierend wird an der Straßenfas-
sade sogar die alte, im 18. Jh. aus der Mode
gekommene Vorkragung wieder aufgegriffen,
jetzt allerdings auf industriell vorgefertigten
Knaggen ruhend. Das Fachwerk bleibt folge-
richtig auch unverputzt und wird, wie der fein
abgestimmte Wechsel zwischen ausgemau-
erten Gefachen und Fensteröffnungen deut-
lich macht, zum Gestaltungsmittel. Die jüngst
erfolgte Restaurierung des Hauses hat diesen
Qualitäten Rechnung getragen und die histo-
rische Form bewahrt.
Die Häuserzeile am Ölschlägern, die der St.
Magnikirche und dem ehemaligen Magni-
kirchhof gegenüberliegt, ist von hoher städte-
baulicher Bedeutung, da sie zum unmittelba-
ren Umfeld von Kirche und Kirchplatz gehört
und das Ensemble im Süden begrenzt. Ob-
wohl Zerstörung und Beschädigung der hi-
storischen Bausubstanz während des Zwei-
ten Weltkrieges relativ gering waren, sind in
der Nachkriegszeit noch einige der alten,
meist kleinbürgerlichen Fachwerkhäuser ver-
150