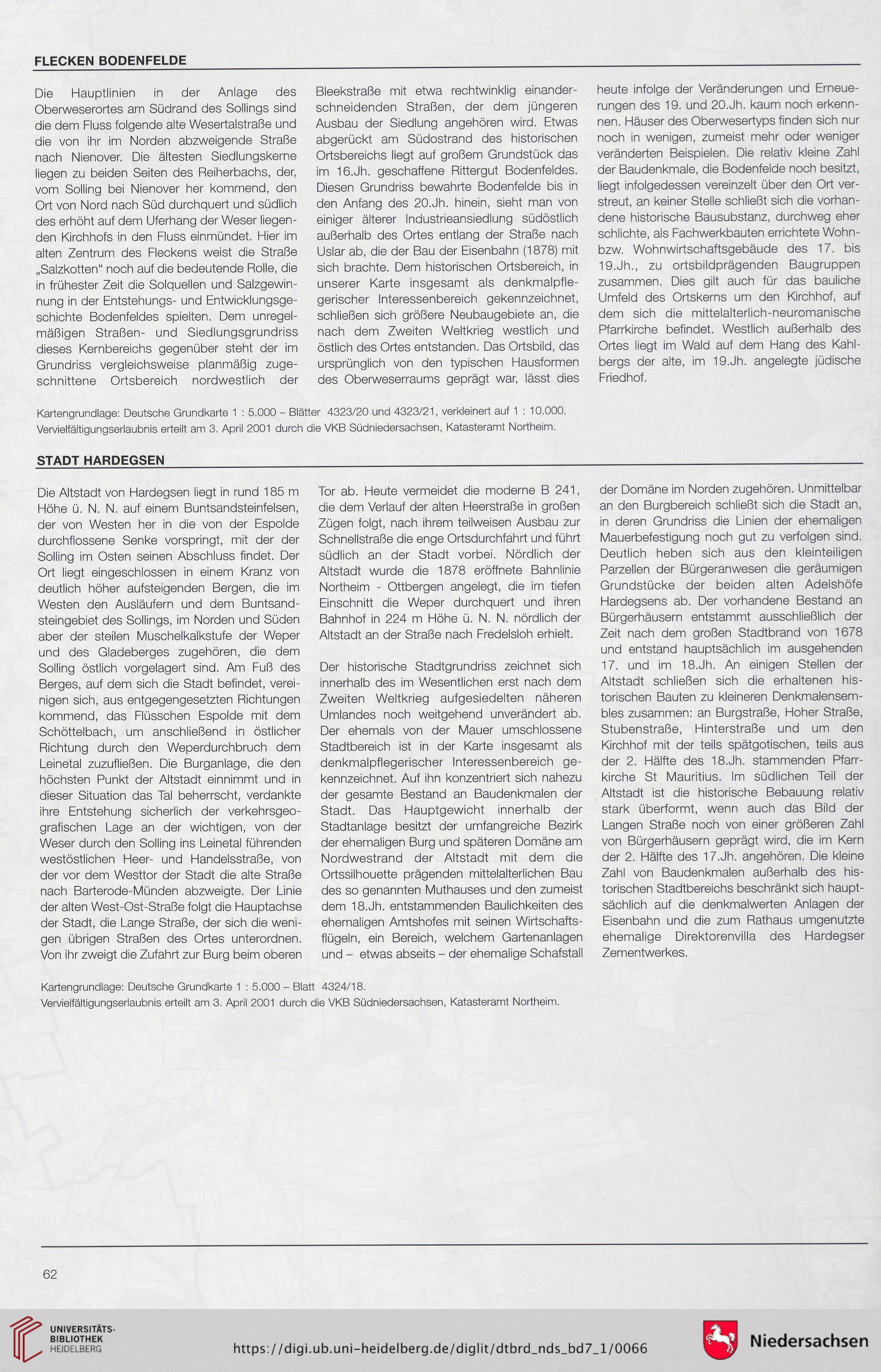FLECKEN BODENFELDE
Die Hauptlinien in der Anlage des
Oberweserortes am Südrand des Sollings sind
die dem Fluss folgende alte Wesertalstraße und
die von ihr im Norden abzweigende Straße
nach Nienover. Die ältesten Siedlungskerne
liegen zu beiden Seiten des Reiherbachs, der,
vom Solling bei Nienover her kommend, den
Ort von Nord nach Süd durchquert und südlich
des erhöht auf dem Uferhang der Weser liegen-
den Kirchhofs in den Fluss einmündet. Hier im
alten Zentrum des Fleckens weist die Straße
„Salzkotten“ noch auf die bedeutende Rolle, die
in frühester Zeit die Solquellen und Salzgewin-
nung in der Entstehungs- und Entwicklungsge-
schichte Bodenfeldes spielten. Dem unregel-
mäßigen Straßen- und Siedlungsgrundriss
dieses Kernbereichs gegenüber steht der im
Grundriss vergleichsweise planmäßig zuge-
schnittene Ortsbereich nordwestlich der
Bleekstraße mit etwa rechtwinklig einander-
schneidenden Straßen, der dem jüngeren
Ausbau der Siedlung angehören wird. Etwas
abgerückt am Südostrand des historischen
Ortsbereichs liegt auf großem Grundstück das
im 16.Jh. geschaffene Rittergut Bodenfeldes.
Diesen Grundriss bewahrte Bodenfelde bis in
den Anfang des 20.Jh. hinein, sieht man von
einiger älterer Industrieansiedlung südöstlich
außerhalb des Ortes entlang der Straße nach
Uslar ab, die der Bau der Eisenbahn (1878) mit
sich brachte. Dem historischen Ortsbereich, in
unserer Karte insgesamt als denkmalpfle-
gerischer Interessenbereich gekennzeichnet,
schließen sich größere Neubaugebiete an, die
nach dem Zweiten Weltkrieg westlich und
östlich des Ortes entstanden. Das Ortsbild, das
ursprünglich von den typischen Hausformen
des Oberweserraums geprägt war, lässt dies
heute infolge der Veränderungen und Erneue-
rungen des 19. und 20.Jh. kaum noch erkenn-
nen. Häuser des Oberwesertyps finden sich nur
noch in wenigen, zumeist mehr oder weniger
veränderten Beispielen. Die relativ kleine Zahl
der Baudenkmale, die Bodenfelde noch besitzt,
liegt infolgedessen vereinzelt über den Ort ver-
streut, an keiner Stelle schließt sich die vorhan-
dene historische Bausubstanz, durchweg eher
schlichte, als Fachwerkbauten errichtete Wohn-
bzw. Wohnwirtschaftsgebäude des 17. bis
19.Jh., zu ortsbildprägenden Baugruppen
zusammen. Dies gilt auch für das bauliche
Umfeld des Ortskerns um den Kirchhof, auf
dem sich die mittelalterlich-neuromanische
Pfarrkirche befindet. Westlich außerhalb des
Ortes liegt im Wald auf dem Hang des Kahl-
bergs der alte, im 19.Jh. angelegte jüdische
Friedhof.
Kartengrundlage: Deutsche Grundkarte 1 : 5.000 - Blätter 4323/20 und 4323/21, verkleinert auf 1 : 10.000.
Vervielfältigungserlaubnis erteilt am 3. April 2001 durch die VKB Südniedersachsen, Katasteramt Northeim.
STADT HARDEGSEN
Die Altstadt von Hardegsen liegt in rund 185 m
Höhe ü. N. N. auf einem Buntsandsteinfelsen,
der von Westen her in die von der Espolde
durchflossene Senke vorspringt, mit der der
Solling im Osten seinen Abschluss findet. Der
Ort liegt eingeschlossen in einem Kranz von
deutlich höher aufsteigenden Bergen, die im
Westen den Ausläufern und dem Buntsand-
steingebiet des Sollings, im Norden und Süden
aber der steilen Muschelkalkstufe der Weper
und des Gladeberges zugehören, die dem
Solling östlich vorgelagert sind. Am Fuß des
Berges, auf dem sich die Stadt befindet, verei-
nigen sich, aus entgegengesetzten Richtungen
kommend, das Flüsschen Espolde mit dem
Schöttelbach, um anschließend in östlicher
Richtung durch den Weperdurchbruch dem
Leinetal zuzufließen. Die Burganlage, die den
höchsten Punkt der Altstadt einnimmt und in
dieser Situation das Tal beherrscht, verdankte
ihre Entstehung sicherlich der verkehrsgeo-
grafischen Lage an der wichtigen, von der
Weser durch den Solling ins Leinetal führenden
westöstlichen Heer- und Handelsstraße, von
der vor dem Westtor der Stadt die alte Straße
nach Barterode-Münden abzweigte. Der Linie
der alten West-Ost-Straße folgt die Hauptachse
der Stadt, die Lange Straße, der sich die weni-
gen übrigen Straßen des Ortes unterordnen.
Von ihr zweigt die Zufahrt zur Burg beim oberen
Tor ab. Heute vermeidet die moderne B 241,
die dem Verlauf der alten Heerstraße in großen
Zügen folgt, nach ihrem teilweisen Ausbau zur
Schnellstraße die enge Ortsdurchfahrt und führt
südlich an der Stadt vorbei. Nördlich der
Altstadt wurde die 1878 eröffnete Bahnlinie
Northeim - Ottbergen angelegt, die im tiefen
Einschnitt die Weper durchquert und ihren
Bahnhof in 224 m Höhe ü. N. N. nördlich der
Altstadt an der Straße nach Fredelsloh erhielt.
Der historische Stadtgrundriss zeichnet sich
innerhalb des im Wesentlichen erst nach dem
Zweiten Weltkrieg aufgesiedelten näheren
Umlandes noch weitgehend unverändert ab.
Der ehemals von der Mauer umschlossene
Stadtbereich ist in der Karte insgesamt als
denkmalpflegerischer Interessenbereich ge-
kennzeichnet. Auf ihn konzentriert sich nahezu
der gesamte Bestand an Baudenkmalen der
Stadt. Das Hauptgewicht innerhalb der
Stadtanlage besitzt der umfangreiche Bezirk
der ehemaligen Burg und späteren Domäne am
Nordwestrand der Altstadt mit dem die
Ortssilhouette prägenden mittelalterlichen Bau
des so genannten Muthauses und den zumeist
dem 18.Jh. entstammenden Baulichkeiten des
ehemaligen Amtshofes mit seinen Wirtschafts-
flügeln, ein Bereich, welchem Gartenanlagen
und - etwas abseits - der ehemalige Schafstall
der Domäne im Norden zugehören. Unmittelbar
an den Burgbereich schließt sich die Stadt an,
in deren Grundriss die Linien der ehemaligen
Mauerbefestigung noch gut zu verfolgen sind.
Deutlich heben sich aus den kleinteiligen
Parzellen der Bürgeranwesen die geräumigen
Grundstücke der beiden alten Adelshöfe
Hardegsens ab. Der vorhandene Bestand an
Bürgerhäusern entstammt ausschließlich der
Zeit nach dem großen Stadtbrand von 1678
und entstand hauptsächlich im ausgehenden
17. und im 18.Jh. An einigen Stellen der
Altstadt schließen sich die erhaltenen his-
torischen Bauten zu kleineren Denkmalensem-
bles zusammen: an Burgstraße, Hoher Straße,
Stubenstraße, Hinterstraße und um den
Kirchhof mit der teils spätgotischen, teils aus
der 2. Hälfte des 18.Jh. stammenden Pfarr-
kirche St Mauritius. Im südlichen Teil der
Altstadt ist die historische Bebauung relativ
stark überformt, wenn auch das Bild der
Langen Straße noch von einer größeren Zahl
von Bürgerhäusern geprägt wird, die im Kern
der 2. Hälfte des 17.Jh. angehören. Die kleine
Zahl von Baudenkmalen außerhalb des his-
torischen Stadtbereichs beschränkt sich haupt-
sächlich auf die denkmalwerten Anlagen der
Eisenbahn und die zum Rathaus umgenutzte
ehemalige Direktorenvilla des Hardegser
Zementwerkes.
Kartengrundlage: Deutsche Grundkarte 1 : 5.000 - Blatt 4324/18.
Vervielfältigungserlaubnis erteilt am 3. April 2001 durch die VKB Südniedersachsen, Katasteramt Northeim.
62
Die Hauptlinien in der Anlage des
Oberweserortes am Südrand des Sollings sind
die dem Fluss folgende alte Wesertalstraße und
die von ihr im Norden abzweigende Straße
nach Nienover. Die ältesten Siedlungskerne
liegen zu beiden Seiten des Reiherbachs, der,
vom Solling bei Nienover her kommend, den
Ort von Nord nach Süd durchquert und südlich
des erhöht auf dem Uferhang der Weser liegen-
den Kirchhofs in den Fluss einmündet. Hier im
alten Zentrum des Fleckens weist die Straße
„Salzkotten“ noch auf die bedeutende Rolle, die
in frühester Zeit die Solquellen und Salzgewin-
nung in der Entstehungs- und Entwicklungsge-
schichte Bodenfeldes spielten. Dem unregel-
mäßigen Straßen- und Siedlungsgrundriss
dieses Kernbereichs gegenüber steht der im
Grundriss vergleichsweise planmäßig zuge-
schnittene Ortsbereich nordwestlich der
Bleekstraße mit etwa rechtwinklig einander-
schneidenden Straßen, der dem jüngeren
Ausbau der Siedlung angehören wird. Etwas
abgerückt am Südostrand des historischen
Ortsbereichs liegt auf großem Grundstück das
im 16.Jh. geschaffene Rittergut Bodenfeldes.
Diesen Grundriss bewahrte Bodenfelde bis in
den Anfang des 20.Jh. hinein, sieht man von
einiger älterer Industrieansiedlung südöstlich
außerhalb des Ortes entlang der Straße nach
Uslar ab, die der Bau der Eisenbahn (1878) mit
sich brachte. Dem historischen Ortsbereich, in
unserer Karte insgesamt als denkmalpfle-
gerischer Interessenbereich gekennzeichnet,
schließen sich größere Neubaugebiete an, die
nach dem Zweiten Weltkrieg westlich und
östlich des Ortes entstanden. Das Ortsbild, das
ursprünglich von den typischen Hausformen
des Oberweserraums geprägt war, lässt dies
heute infolge der Veränderungen und Erneue-
rungen des 19. und 20.Jh. kaum noch erkenn-
nen. Häuser des Oberwesertyps finden sich nur
noch in wenigen, zumeist mehr oder weniger
veränderten Beispielen. Die relativ kleine Zahl
der Baudenkmale, die Bodenfelde noch besitzt,
liegt infolgedessen vereinzelt über den Ort ver-
streut, an keiner Stelle schließt sich die vorhan-
dene historische Bausubstanz, durchweg eher
schlichte, als Fachwerkbauten errichtete Wohn-
bzw. Wohnwirtschaftsgebäude des 17. bis
19.Jh., zu ortsbildprägenden Baugruppen
zusammen. Dies gilt auch für das bauliche
Umfeld des Ortskerns um den Kirchhof, auf
dem sich die mittelalterlich-neuromanische
Pfarrkirche befindet. Westlich außerhalb des
Ortes liegt im Wald auf dem Hang des Kahl-
bergs der alte, im 19.Jh. angelegte jüdische
Friedhof.
Kartengrundlage: Deutsche Grundkarte 1 : 5.000 - Blätter 4323/20 und 4323/21, verkleinert auf 1 : 10.000.
Vervielfältigungserlaubnis erteilt am 3. April 2001 durch die VKB Südniedersachsen, Katasteramt Northeim.
STADT HARDEGSEN
Die Altstadt von Hardegsen liegt in rund 185 m
Höhe ü. N. N. auf einem Buntsandsteinfelsen,
der von Westen her in die von der Espolde
durchflossene Senke vorspringt, mit der der
Solling im Osten seinen Abschluss findet. Der
Ort liegt eingeschlossen in einem Kranz von
deutlich höher aufsteigenden Bergen, die im
Westen den Ausläufern und dem Buntsand-
steingebiet des Sollings, im Norden und Süden
aber der steilen Muschelkalkstufe der Weper
und des Gladeberges zugehören, die dem
Solling östlich vorgelagert sind. Am Fuß des
Berges, auf dem sich die Stadt befindet, verei-
nigen sich, aus entgegengesetzten Richtungen
kommend, das Flüsschen Espolde mit dem
Schöttelbach, um anschließend in östlicher
Richtung durch den Weperdurchbruch dem
Leinetal zuzufließen. Die Burganlage, die den
höchsten Punkt der Altstadt einnimmt und in
dieser Situation das Tal beherrscht, verdankte
ihre Entstehung sicherlich der verkehrsgeo-
grafischen Lage an der wichtigen, von der
Weser durch den Solling ins Leinetal führenden
westöstlichen Heer- und Handelsstraße, von
der vor dem Westtor der Stadt die alte Straße
nach Barterode-Münden abzweigte. Der Linie
der alten West-Ost-Straße folgt die Hauptachse
der Stadt, die Lange Straße, der sich die weni-
gen übrigen Straßen des Ortes unterordnen.
Von ihr zweigt die Zufahrt zur Burg beim oberen
Tor ab. Heute vermeidet die moderne B 241,
die dem Verlauf der alten Heerstraße in großen
Zügen folgt, nach ihrem teilweisen Ausbau zur
Schnellstraße die enge Ortsdurchfahrt und führt
südlich an der Stadt vorbei. Nördlich der
Altstadt wurde die 1878 eröffnete Bahnlinie
Northeim - Ottbergen angelegt, die im tiefen
Einschnitt die Weper durchquert und ihren
Bahnhof in 224 m Höhe ü. N. N. nördlich der
Altstadt an der Straße nach Fredelsloh erhielt.
Der historische Stadtgrundriss zeichnet sich
innerhalb des im Wesentlichen erst nach dem
Zweiten Weltkrieg aufgesiedelten näheren
Umlandes noch weitgehend unverändert ab.
Der ehemals von der Mauer umschlossene
Stadtbereich ist in der Karte insgesamt als
denkmalpflegerischer Interessenbereich ge-
kennzeichnet. Auf ihn konzentriert sich nahezu
der gesamte Bestand an Baudenkmalen der
Stadt. Das Hauptgewicht innerhalb der
Stadtanlage besitzt der umfangreiche Bezirk
der ehemaligen Burg und späteren Domäne am
Nordwestrand der Altstadt mit dem die
Ortssilhouette prägenden mittelalterlichen Bau
des so genannten Muthauses und den zumeist
dem 18.Jh. entstammenden Baulichkeiten des
ehemaligen Amtshofes mit seinen Wirtschafts-
flügeln, ein Bereich, welchem Gartenanlagen
und - etwas abseits - der ehemalige Schafstall
der Domäne im Norden zugehören. Unmittelbar
an den Burgbereich schließt sich die Stadt an,
in deren Grundriss die Linien der ehemaligen
Mauerbefestigung noch gut zu verfolgen sind.
Deutlich heben sich aus den kleinteiligen
Parzellen der Bürgeranwesen die geräumigen
Grundstücke der beiden alten Adelshöfe
Hardegsens ab. Der vorhandene Bestand an
Bürgerhäusern entstammt ausschließlich der
Zeit nach dem großen Stadtbrand von 1678
und entstand hauptsächlich im ausgehenden
17. und im 18.Jh. An einigen Stellen der
Altstadt schließen sich die erhaltenen his-
torischen Bauten zu kleineren Denkmalensem-
bles zusammen: an Burgstraße, Hoher Straße,
Stubenstraße, Hinterstraße und um den
Kirchhof mit der teils spätgotischen, teils aus
der 2. Hälfte des 18.Jh. stammenden Pfarr-
kirche St Mauritius. Im südlichen Teil der
Altstadt ist die historische Bebauung relativ
stark überformt, wenn auch das Bild der
Langen Straße noch von einer größeren Zahl
von Bürgerhäusern geprägt wird, die im Kern
der 2. Hälfte des 17.Jh. angehören. Die kleine
Zahl von Baudenkmalen außerhalb des his-
torischen Stadtbereichs beschränkt sich haupt-
sächlich auf die denkmalwerten Anlagen der
Eisenbahn und die zum Rathaus umgenutzte
ehemalige Direktorenvilla des Hardegser
Zementwerkes.
Kartengrundlage: Deutsche Grundkarte 1 : 5.000 - Blatt 4324/18.
Vervielfältigungserlaubnis erteilt am 3. April 2001 durch die VKB Südniedersachsen, Katasteramt Northeim.
62