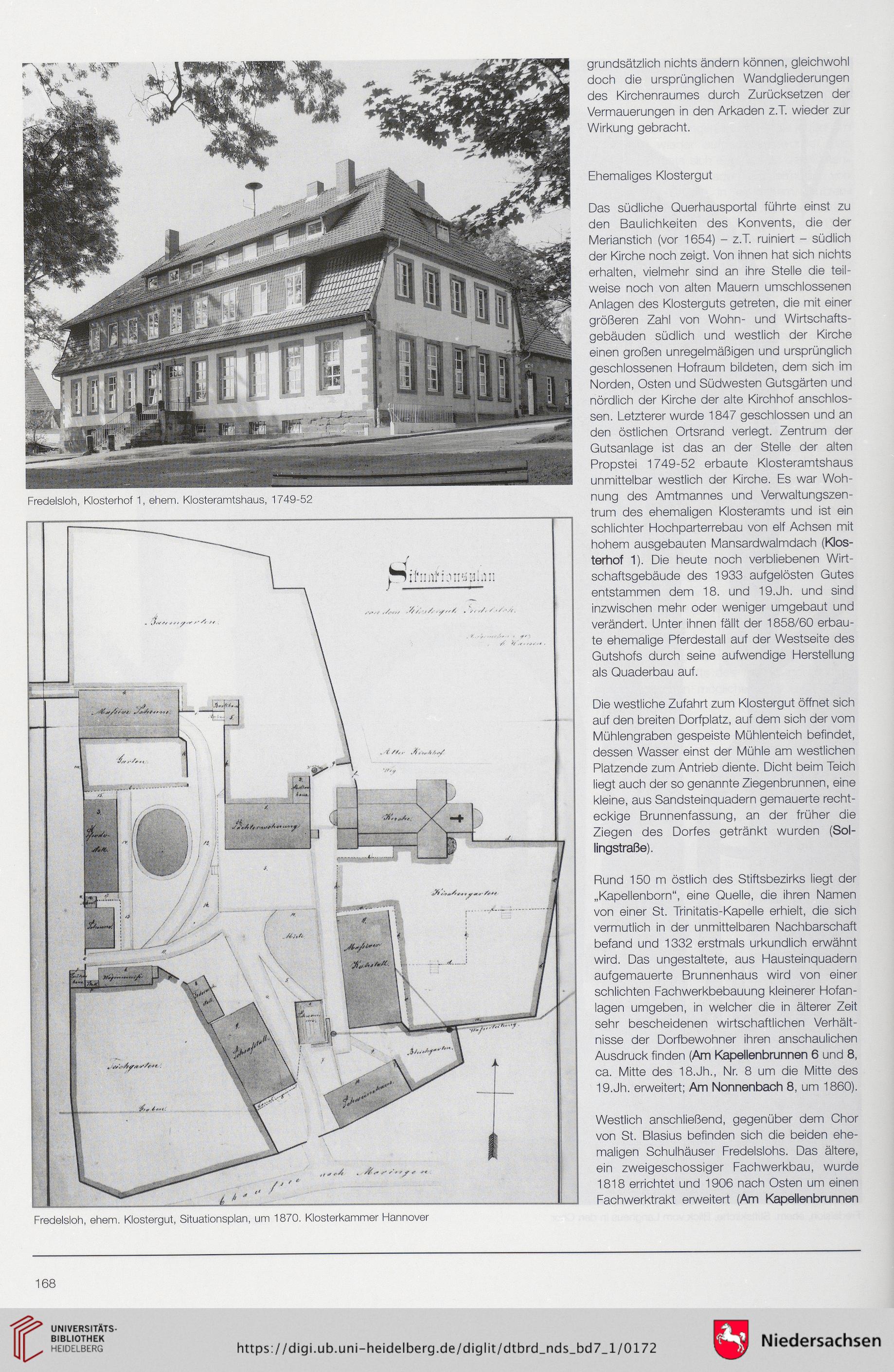Fredelsloh, Klosterhof 1, ehern. Klosteramtshaus, 1749-52
Fredelsloh, ehern. Klostergut, Situationsplan, um 1870. Klosterkammer Hannover
grundsätzlich nichts ändern können, gleichwohl
doch die ursprünglichen Wandgliederungen
des Kirchenraumes durch Zurücksetzen der
Vermauerungen in den Arkaden z.T. wieder zur
Wirkung gebracht.
Ehemaliges Klostergut
Das südliche Querhausportal führte einst zu
den Baulichkeiten des Konvents, die der
Merianstich (vor 1654) - z.T. ruiniert - südlich
der Kirche noch zeigt. Von ihnen hat sich nichts
erhalten, vielmehr sind an ihre Stelle die teil-
weise noch von alten Mauern umschlossenen
Anlagen des Klosterguts getreten, die mit einer
größeren Zahl von Wohn- und Wirtschafts-
gebäuden südlich und westlich der Kirche
einen großen unregelmäßigen und ursprünglich
geschlossenen Hofraum bildeten, dem sich im
Norden, Osten und Südwesten Gutsgärten und
nördlich der Kirche der alte Kirchhof anschios-
sen. Letzterer wurde 1847 geschlossen und an
den östlichen Ortsrand verlegt. Zentrum der
Gutsanlage ist das an der Stelle der alten
Propstei 1749-52 erbaute Klosteramtshaus
unmittelbar westlich der Kirche. Es war Woh-
nung des Amtmannes und Verwaltungszen-
trum des ehemaligen Klosteramts und ist ein
schlichter Hochparterrebau von elf Achsen mit
hohem ausgebauten Mansardwalmdach (Klos-
terhof 1). Die heute noch verbliebenen Wirt-
schaftsgebäude des 1933 aufgelösten Gutes
entstammen dem 18. und 19.Jh. und sind
inzwischen mehr oder weniger umgebaut und
verändert. Unter ihnen fällt der 1858/60 erbau-
te ehemalige Pferdestall auf der Westseite des
Gutshofs durch seine aufwendige Herstellung
als Quaderbau auf.
Die westliche Zufahrt zum Klostergut öffnet sich
auf den breiten Dorf platz, auf dem sich der vom
Mühlengraben gespeiste Mühlenteich befindet,
dessen Wasser einst der Mühle am westlichen
Platzende zum Antrieb diente. Dicht beim Teich
liegt auch der so genannte Ziegenbrunnen, eine
kleine, aus Sandsteinquadern gemauerte recht-
eckige Brunnenfassung, an der früher die
Ziegen des Dorfes getränkt wurden (Sol-
lingstraße).
Rund 150 m östlich des Stiftsbezirks liegt der
„Kapellenborn“, eine Quelle, die ihren Namen
von einer St. Trinitatis-Kapelle erhielt, die sich
vermutlich in der unmittelbaren Nachbarschaft
befand und 1332 erstmals urkundlich erwähnt
wird. Das ungestaltete, aus Hausteinquadern
aufgemauerte Brunnenhaus wird von einer
schlichten Fachwerkbebauung kleinerer Hofan-
lagen umgeben, in welcher die in älterer Zeit
sehr bescheidenen wirtschaftlichen Verhält-
nisse der Dorfbewohner ihren anschaulichen
Ausdruck finden (Am Kapellenbrunnen 6 und 8,
ca. Mitte des 18.Jh., Nr. 8 um die Mitte des
19.Jh. erweitert; Am Nonnenbach 8, um 1860).
Westlich anschließend, gegenüber dem Chor
von St. Blasius befinden sich die beiden ehe-
maligen Schulhäuser Fredelslohs. Das ältere,
ein zweigeschossiger Fachwerkbau, wurde
1818 errichtet und 1906 nach Osten um einen
Fachwerktrakt erweitert (Am Kapellenbrunnen
168
Fredelsloh, ehern. Klostergut, Situationsplan, um 1870. Klosterkammer Hannover
grundsätzlich nichts ändern können, gleichwohl
doch die ursprünglichen Wandgliederungen
des Kirchenraumes durch Zurücksetzen der
Vermauerungen in den Arkaden z.T. wieder zur
Wirkung gebracht.
Ehemaliges Klostergut
Das südliche Querhausportal führte einst zu
den Baulichkeiten des Konvents, die der
Merianstich (vor 1654) - z.T. ruiniert - südlich
der Kirche noch zeigt. Von ihnen hat sich nichts
erhalten, vielmehr sind an ihre Stelle die teil-
weise noch von alten Mauern umschlossenen
Anlagen des Klosterguts getreten, die mit einer
größeren Zahl von Wohn- und Wirtschafts-
gebäuden südlich und westlich der Kirche
einen großen unregelmäßigen und ursprünglich
geschlossenen Hofraum bildeten, dem sich im
Norden, Osten und Südwesten Gutsgärten und
nördlich der Kirche der alte Kirchhof anschios-
sen. Letzterer wurde 1847 geschlossen und an
den östlichen Ortsrand verlegt. Zentrum der
Gutsanlage ist das an der Stelle der alten
Propstei 1749-52 erbaute Klosteramtshaus
unmittelbar westlich der Kirche. Es war Woh-
nung des Amtmannes und Verwaltungszen-
trum des ehemaligen Klosteramts und ist ein
schlichter Hochparterrebau von elf Achsen mit
hohem ausgebauten Mansardwalmdach (Klos-
terhof 1). Die heute noch verbliebenen Wirt-
schaftsgebäude des 1933 aufgelösten Gutes
entstammen dem 18. und 19.Jh. und sind
inzwischen mehr oder weniger umgebaut und
verändert. Unter ihnen fällt der 1858/60 erbau-
te ehemalige Pferdestall auf der Westseite des
Gutshofs durch seine aufwendige Herstellung
als Quaderbau auf.
Die westliche Zufahrt zum Klostergut öffnet sich
auf den breiten Dorf platz, auf dem sich der vom
Mühlengraben gespeiste Mühlenteich befindet,
dessen Wasser einst der Mühle am westlichen
Platzende zum Antrieb diente. Dicht beim Teich
liegt auch der so genannte Ziegenbrunnen, eine
kleine, aus Sandsteinquadern gemauerte recht-
eckige Brunnenfassung, an der früher die
Ziegen des Dorfes getränkt wurden (Sol-
lingstraße).
Rund 150 m östlich des Stiftsbezirks liegt der
„Kapellenborn“, eine Quelle, die ihren Namen
von einer St. Trinitatis-Kapelle erhielt, die sich
vermutlich in der unmittelbaren Nachbarschaft
befand und 1332 erstmals urkundlich erwähnt
wird. Das ungestaltete, aus Hausteinquadern
aufgemauerte Brunnenhaus wird von einer
schlichten Fachwerkbebauung kleinerer Hofan-
lagen umgeben, in welcher die in älterer Zeit
sehr bescheidenen wirtschaftlichen Verhält-
nisse der Dorfbewohner ihren anschaulichen
Ausdruck finden (Am Kapellenbrunnen 6 und 8,
ca. Mitte des 18.Jh., Nr. 8 um die Mitte des
19.Jh. erweitert; Am Nonnenbach 8, um 1860).
Westlich anschließend, gegenüber dem Chor
von St. Blasius befinden sich die beiden ehe-
maligen Schulhäuser Fredelslohs. Das ältere,
ein zweigeschossiger Fachwerkbau, wurde
1818 errichtet und 1906 nach Osten um einen
Fachwerktrakt erweitert (Am Kapellenbrunnen
168