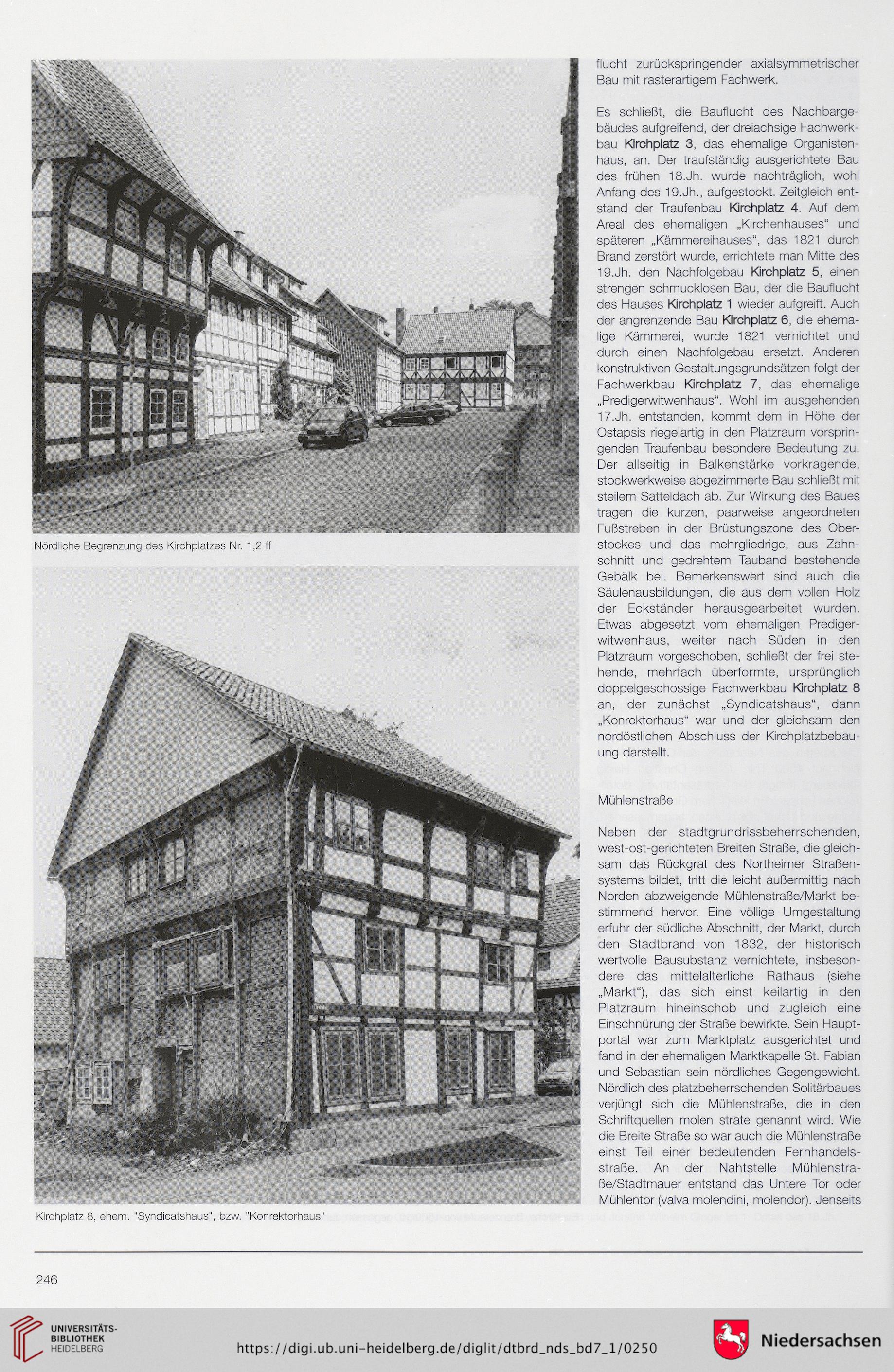Nördliche Begrenzung des Kirchplatzes Nr. 1,2 ff
Kirchplatz 8, ehern. "Syndicatshaus", bzw. "Konrektorhaus"
flucht zurückspringender axialsymmetrischer
Bau mit rasterartigem Fachwerk.
Es schließt, die Bauflucht des Nachbarge-
bäudes aufgreifend, der dreiachsige Fachwerk-
bau Kirchplatz 3, das ehemalige Organisten-
haus, an. Der traufständig ausgerichtete Bau
des frühen 18.Jh. wurde nachträglich, wohl
Anfang des 19.Jh., aufgestockt. Zeitgleich ent-
stand der Traufenbau Kirchplatz 4. Auf dem
Areal des ehemaligen „Kirchenhauses“ und
späteren „Kämmereihauses“, das 1821 durch
Brand zerstört wurde, errichtete man Mitte des
19.Jh. den Nachfolgebau Kirchplatz 5, einen
strengen schmucklosen Bau, der die Bauflucht
des Hauses Kirchplatz 1 wieder aufgreift. Auch
der angrenzende Bau Kirchplatz 6, die ehema-
lige Kämmerei, wurde 1821 vernichtet und
durch einen Nachfolgebau ersetzt. Anderen
konstruktiven Gestaltungsgrundsätzen folgt der
Fachwerkbau Kirchplatz 7, das ehemalige
„Predigerwitwenhaus“. Wohl im ausgehenden
17.Jh. entstanden, kommt dem in Höhe der
Ostapsis riegelartig in den Platzraum vorsprin-
genden Traufenbau besondere Bedeutung zu.
Der allseitig in Balkenstärke vorkragende,
stockwerkweise abgezimmerte Bau schließt mit
steilem Satteldach ab. Zur Wirkung des Baues
tragen die kurzen, paarweise angeordneten
Fußstreben in der Brüstungszone des Ober-
stockes und das mehrgliedrige, aus Zahn-
schnitt und gedrehtem Tauband bestehende
Gebälk bei. Bemerkenswert sind auch die
Säulenausbildungen, die aus dem vollen Holz
der Eckständer herausgearbeitet wurden.
Etwas abgesetzt vom ehemaligen Prediger-
witwenhaus, weiter nach Süden in den
Platzraum vorgeschoben, schließt der frei ste-
hende, mehrfach überformte, ursprünglich
doppelgeschossige Fachwerkbau Kirchplatz 8
an, der zunächst „Syndicatshaus“, dann
„Konrektorhaus“ war und der gleichsam den
nordöstlichen Abschluss der Kirchplatzbebau-
ung darstellt.
Mühlenstraße
Neben der stadtgrundrissbeherrschenden,
west-ost-gerichteten Breiten Straße, die gleich-
sam das Rückgrat des Northeimer Straßen-
systems bildet, tritt die leicht außermittig nach
Norden abzweigende Mühlenstraße/Markt be-
stimmend hervor. Eine völlige Umgestaltung
erfuhr der südliche Abschnitt, der Markt, durch
den Stadtbrand von 1832, der historisch
wertvolle Bausubstanz vernichtete, insbeson-
dere das mittelalterliche Rathaus (siehe
„Markt“), das sich einst keilartig in den
Platzraum hineinschob und zugleich eine
Einschnürung der Straße bewirkte. Sein Haupt-
portal war zum Marktplatz ausgerichtet und
fand in der ehemaligen Marktkapelle St. Fabian
und Sebastian sein nördliches Gegengewicht.
Nördlich des platzbeherrschenden Solitärbaues
verjüngt sich die Mühlenstraße, die in den
Schriftquellen molen strate genannt wird. Wie
die Breite Straße so war auch die Mühlenstraße
einst Teil einer bedeutenden Fernhandels-
straße. An der Nahtstelle Mühlenstra-
ße/Stadtmauer entstand das Untere Tor oder
Mühlentor (valva molendini, molendor). Jenseits
246
Kirchplatz 8, ehern. "Syndicatshaus", bzw. "Konrektorhaus"
flucht zurückspringender axialsymmetrischer
Bau mit rasterartigem Fachwerk.
Es schließt, die Bauflucht des Nachbarge-
bäudes aufgreifend, der dreiachsige Fachwerk-
bau Kirchplatz 3, das ehemalige Organisten-
haus, an. Der traufständig ausgerichtete Bau
des frühen 18.Jh. wurde nachträglich, wohl
Anfang des 19.Jh., aufgestockt. Zeitgleich ent-
stand der Traufenbau Kirchplatz 4. Auf dem
Areal des ehemaligen „Kirchenhauses“ und
späteren „Kämmereihauses“, das 1821 durch
Brand zerstört wurde, errichtete man Mitte des
19.Jh. den Nachfolgebau Kirchplatz 5, einen
strengen schmucklosen Bau, der die Bauflucht
des Hauses Kirchplatz 1 wieder aufgreift. Auch
der angrenzende Bau Kirchplatz 6, die ehema-
lige Kämmerei, wurde 1821 vernichtet und
durch einen Nachfolgebau ersetzt. Anderen
konstruktiven Gestaltungsgrundsätzen folgt der
Fachwerkbau Kirchplatz 7, das ehemalige
„Predigerwitwenhaus“. Wohl im ausgehenden
17.Jh. entstanden, kommt dem in Höhe der
Ostapsis riegelartig in den Platzraum vorsprin-
genden Traufenbau besondere Bedeutung zu.
Der allseitig in Balkenstärke vorkragende,
stockwerkweise abgezimmerte Bau schließt mit
steilem Satteldach ab. Zur Wirkung des Baues
tragen die kurzen, paarweise angeordneten
Fußstreben in der Brüstungszone des Ober-
stockes und das mehrgliedrige, aus Zahn-
schnitt und gedrehtem Tauband bestehende
Gebälk bei. Bemerkenswert sind auch die
Säulenausbildungen, die aus dem vollen Holz
der Eckständer herausgearbeitet wurden.
Etwas abgesetzt vom ehemaligen Prediger-
witwenhaus, weiter nach Süden in den
Platzraum vorgeschoben, schließt der frei ste-
hende, mehrfach überformte, ursprünglich
doppelgeschossige Fachwerkbau Kirchplatz 8
an, der zunächst „Syndicatshaus“, dann
„Konrektorhaus“ war und der gleichsam den
nordöstlichen Abschluss der Kirchplatzbebau-
ung darstellt.
Mühlenstraße
Neben der stadtgrundrissbeherrschenden,
west-ost-gerichteten Breiten Straße, die gleich-
sam das Rückgrat des Northeimer Straßen-
systems bildet, tritt die leicht außermittig nach
Norden abzweigende Mühlenstraße/Markt be-
stimmend hervor. Eine völlige Umgestaltung
erfuhr der südliche Abschnitt, der Markt, durch
den Stadtbrand von 1832, der historisch
wertvolle Bausubstanz vernichtete, insbeson-
dere das mittelalterliche Rathaus (siehe
„Markt“), das sich einst keilartig in den
Platzraum hineinschob und zugleich eine
Einschnürung der Straße bewirkte. Sein Haupt-
portal war zum Marktplatz ausgerichtet und
fand in der ehemaligen Marktkapelle St. Fabian
und Sebastian sein nördliches Gegengewicht.
Nördlich des platzbeherrschenden Solitärbaues
verjüngt sich die Mühlenstraße, die in den
Schriftquellen molen strate genannt wird. Wie
die Breite Straße so war auch die Mühlenstraße
einst Teil einer bedeutenden Fernhandels-
straße. An der Nahtstelle Mühlenstra-
ße/Stadtmauer entstand das Untere Tor oder
Mühlentor (valva molendini, molendor). Jenseits
246