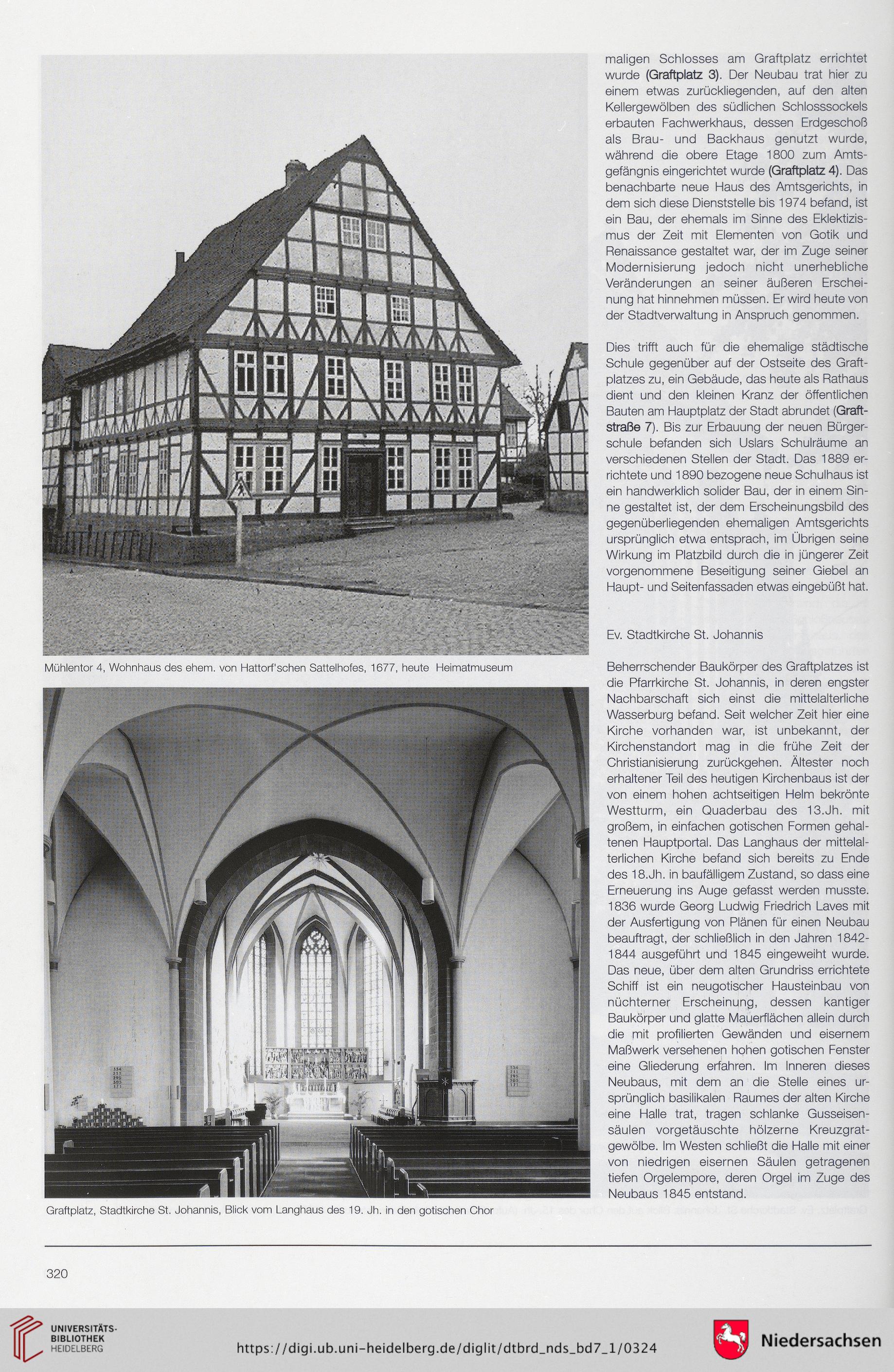Mühlentor 4, Wohnhaus des ehern, von Hattorf'schen Sattelhofes, 1677, heute Heimatmuseum
Graftplatz, Stadtkirche St. Johannis, Blick vom Langhaus des 19. Jh. in den gotischen Chor
maligen Schlosses am Graftplatz errichtet
wurde (Graftplatz 3). Der Neubau trat hier zu
einem etwas zurückliegenden, auf den alten
Kellergewölben des südlichen Schlosssockels
erbauten Fachwerkhaus, dessen Erdgeschoß
als Brau- und Backhaus genutzt wurde,
während die obere Etage 1800 zum Amts-
gefängnis eingerichtet wurde (Graftplatz 4). Das
benachbarte neue Haus des Amtsgerichts, in
dem sich diese Dienststelle bis 1974 befand, ist
ein Bau, der ehemals im Sinne des Eklektizis-
mus der Zeit mit Elementen von Gotik und
Renaissance gestaltet war, der im Zuge seiner
Modernisierung jedoch nicht unerhebliche
Veränderungen an seiner äußeren Erschei-
nung hat hinnehmen müssen. Er wird heute von
der Stadtverwaltung in Anspruch genommen.
Dies trifft auch für die ehemalige städtische
Schule gegenüber auf der Ostseite des Graft-
platzes zu, ein Gebäude, das heute als Rathaus
dient und den kleinen Kranz der öffentlichen
Bauten am Hauptplatz der Stadt abrundet (Graft-
straße 7). Bis zur Erbauung der neuen Bürger-
schule befanden sich Uslars Schulräume an
verschiedenen Stellen der Stadt, Das 1889 er-
richtete und 1890 bezogene neue Schulhaus ist
ein handwerklich solider Bau, der in einem Sin-
ne gestaltet ist, der dem Erscheinungsbild des
gegenüberliegenden ehemaligen Amtsgerichts
ursprünglich etwa entsprach, im Übrigen seine
Wirkung im Platzbild durch die in jüngerer Zeit
vorgenommene Beseitigung seiner Giebel an
Haupt- und Seitenfassaden etwas eingebüßt hat.
Ev. Stadtkirche St. Johannis
Beherrschender Baukörper des Graftplatzes ist
die Pfarrkirche St. Johannis, in deren engster
Nachbarschaft sich einst die mittelalterliche
Wasserburg befand. Seit welcher Zeit hier eine
Kirche vorhanden war, ist unbekannt, der
Kirchenstandort mag in die frühe Zeit der
Christianisierung zurückgehen. Ältester noch
erhaltener Teil des heutigen Kirchenbaus ist der
von einem hohen achtseitigen Helm bekrönte
Westturm, ein Quaderbau des 13.Jh. mit
großem, in einfachen gotischen Formen gehal-
tenen Hauptportal. Das Langhaus der mittelal-
terlichen Kirche befand sich bereits zu Ende
des 18.Jh. in baufälligem Zustand, so dass eine
Erneuerung ins Auge gefasst werden musste.
1836 wurde Georg Ludwig Friedrich Laves mit
der Ausfertigung von Plänen für einen Neubau
beauftragt, der schließlich in den Jahren 1842-
1844 ausgeführt und 1845 eingeweiht wurde.
Das neue, über dem alten Grundriss errichtete
Schiff ist ein neugotischer Hausteinbau von
nüchterner Erscheinung, dessen kantiger
Baukörper und glatte Mauerflächen allein durch
die mit profilierten Gewänden und eisernem
Maßwerk versehenen hohen gotischen Fenster
eine Gliederung erfahren. Im Inneren dieses
Neubaus, mit dem an die Stelle eines ur-
sprünglich basilikalen Raumes der alten Kirche
eine Halle trat, tragen schlanke Gusseisen-
säulen vorgetäuschte hölzerne Kreuzgrat-
gewölbe. Im Westen schließt die Halle mit einer
von niedrigen eisernen Säulen getragenen
tiefen Orgelempore, deren Orgel im Zuge des
Neubaus 1845 entstand.
320
Graftplatz, Stadtkirche St. Johannis, Blick vom Langhaus des 19. Jh. in den gotischen Chor
maligen Schlosses am Graftplatz errichtet
wurde (Graftplatz 3). Der Neubau trat hier zu
einem etwas zurückliegenden, auf den alten
Kellergewölben des südlichen Schlosssockels
erbauten Fachwerkhaus, dessen Erdgeschoß
als Brau- und Backhaus genutzt wurde,
während die obere Etage 1800 zum Amts-
gefängnis eingerichtet wurde (Graftplatz 4). Das
benachbarte neue Haus des Amtsgerichts, in
dem sich diese Dienststelle bis 1974 befand, ist
ein Bau, der ehemals im Sinne des Eklektizis-
mus der Zeit mit Elementen von Gotik und
Renaissance gestaltet war, der im Zuge seiner
Modernisierung jedoch nicht unerhebliche
Veränderungen an seiner äußeren Erschei-
nung hat hinnehmen müssen. Er wird heute von
der Stadtverwaltung in Anspruch genommen.
Dies trifft auch für die ehemalige städtische
Schule gegenüber auf der Ostseite des Graft-
platzes zu, ein Gebäude, das heute als Rathaus
dient und den kleinen Kranz der öffentlichen
Bauten am Hauptplatz der Stadt abrundet (Graft-
straße 7). Bis zur Erbauung der neuen Bürger-
schule befanden sich Uslars Schulräume an
verschiedenen Stellen der Stadt, Das 1889 er-
richtete und 1890 bezogene neue Schulhaus ist
ein handwerklich solider Bau, der in einem Sin-
ne gestaltet ist, der dem Erscheinungsbild des
gegenüberliegenden ehemaligen Amtsgerichts
ursprünglich etwa entsprach, im Übrigen seine
Wirkung im Platzbild durch die in jüngerer Zeit
vorgenommene Beseitigung seiner Giebel an
Haupt- und Seitenfassaden etwas eingebüßt hat.
Ev. Stadtkirche St. Johannis
Beherrschender Baukörper des Graftplatzes ist
die Pfarrkirche St. Johannis, in deren engster
Nachbarschaft sich einst die mittelalterliche
Wasserburg befand. Seit welcher Zeit hier eine
Kirche vorhanden war, ist unbekannt, der
Kirchenstandort mag in die frühe Zeit der
Christianisierung zurückgehen. Ältester noch
erhaltener Teil des heutigen Kirchenbaus ist der
von einem hohen achtseitigen Helm bekrönte
Westturm, ein Quaderbau des 13.Jh. mit
großem, in einfachen gotischen Formen gehal-
tenen Hauptportal. Das Langhaus der mittelal-
terlichen Kirche befand sich bereits zu Ende
des 18.Jh. in baufälligem Zustand, so dass eine
Erneuerung ins Auge gefasst werden musste.
1836 wurde Georg Ludwig Friedrich Laves mit
der Ausfertigung von Plänen für einen Neubau
beauftragt, der schließlich in den Jahren 1842-
1844 ausgeführt und 1845 eingeweiht wurde.
Das neue, über dem alten Grundriss errichtete
Schiff ist ein neugotischer Hausteinbau von
nüchterner Erscheinung, dessen kantiger
Baukörper und glatte Mauerflächen allein durch
die mit profilierten Gewänden und eisernem
Maßwerk versehenen hohen gotischen Fenster
eine Gliederung erfahren. Im Inneren dieses
Neubaus, mit dem an die Stelle eines ur-
sprünglich basilikalen Raumes der alten Kirche
eine Halle trat, tragen schlanke Gusseisen-
säulen vorgetäuschte hölzerne Kreuzgrat-
gewölbe. Im Westen schließt die Halle mit einer
von niedrigen eisernen Säulen getragenen
tiefen Orgelempore, deren Orgel im Zuge des
Neubaus 1845 entstand.
320