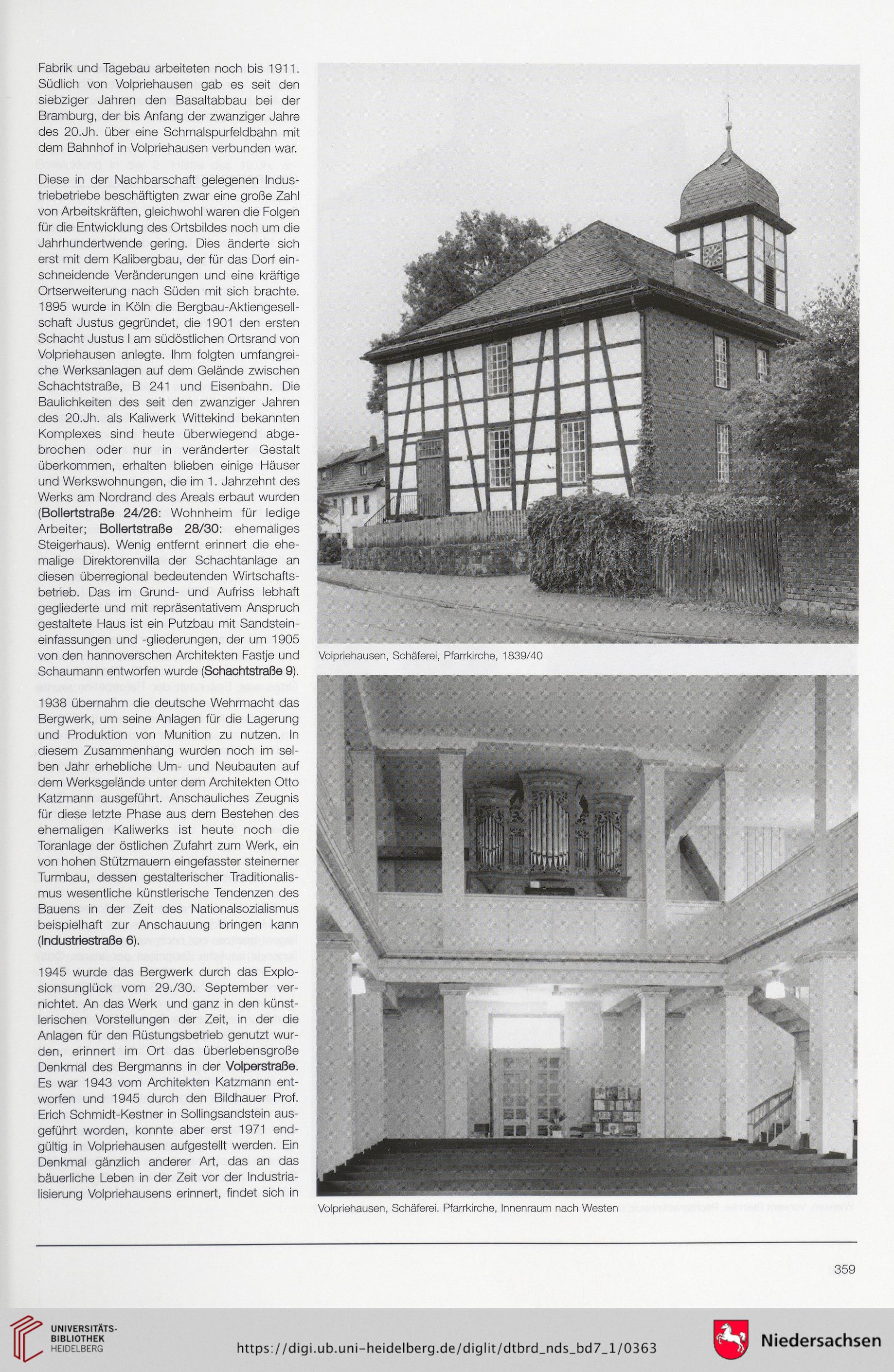Fabrik und Tagebau arbeiteten noch bis 1911.
Südlich von Volpriehausen gab es seit den
siebziger Jahren den Basaltabbau bei der
Bramburg, der bis Anfang der zwanziger Jahre
des 2O.Jh. über eine Schmalspurfeldbahn mit
dem Bahnhof in Volpriehausen verbunden war.
Diese in der Nachbarschaft gelegenen Indus-
triebetriebe beschäftigten zwar eine große Zahl
von Arbeitskräften, gleichwohl waren die Folgen
für die Entwicklung des Ortsbildes noch um die
Jahrhundertwende gering. Dies änderte sich
erst mit dem Kalibergbau, der für das Dorf ein-
schneidende Veränderungen und eine kräftige
Ortserweiterung nach Süden mit sich brachte.
1895 wurde in Köln die Bergbau-Aktiengesell-
schaft Justus gegründet, die 1901 den ersten
Schacht Justus I am südöstlichen Ortsrand von
Volpriehausen anlegte. Ihm folgten umfangrei-
che Werksanlagen auf dem Gelände zwischen
Schachtstraße, B 241 und Eisenbahn. Die
Baulichkeiten des seit den zwanziger Jahren
des 20.Jh. als Kaliwerk Wittekind bekannten
Komplexes sind heute überwiegend abge-
brochen oder nur in veränderter Gestalt
überkommen, erhalten blieben einige Häuser
und Werkswohnungen, die im 1. Jahrzehnt des
Werks am Nordrand des Areals erbaut wurden
(Bollertstraße 24/26: Wohnheim für ledige
Arbeiter; Bollertstraße 28/30: ehemaliges
Steigerhaus). Wenig entfernt erinnert die ehe-
malige Direktorenvilla der Schachtanlage an
diesen überregional bedeutenden Wirtschafts-
betrieb. Das im Grund- und Aufriss lebhaft
gegliederte und mit repräsentativem Anspruch
gestaltete Haus ist ein Putzbau mit Sandstein-
einfassungen und -gliederungen, der um 1905
von den hannoverschen Architekten Fastje und
Schaumann entworfen wurde (Schachtstraße 9).
1938 übernahm die deutsche Wehrmacht das
Bergwerk, um seine Anlagen für die Lagerung
und Produktion von Munition zu nutzen. In
diesem Zusammenhang wurden noch im sel-
ben Jahr erhebliche Um- und Neubauten auf
dem Werksgelände unter dem Architekten Otto
Katzmann ausgeführt. Anschauliches Zeugnis
für diese letzte Phase aus dem Bestehen des
ehemaligen Kaliwerks ist heute noch die
Toranlage der östlichen Zufahrt zum Werk, ein
von hohen Stützmauern eingefasster steinerner
Turmbau, dessen gestalterischer Traditionalis-
mus wesentliche künstlerische Tendenzen des
Bauens in der Zeit des Nationalsozialismus
beispielhaft zur Anschauung bringen kann
(Industriestraße 6).
1945 wurde das Bergwerk durch das Explo-
sionsunglück vom 29./30. September ver-
nichtet. An das Werk und ganz in den künst-
lerischen Vorstellungen der Zeit, in der die
Anlagen für den Rüstungsbetrieb genutzt wur-
den, erinnert im Ort das überlebensgroße
Denkmal des Bergmanns in der Volperstraße.
Es war 1943 vom Architekten Katzmann ent-
worfen und 1945 durch den Bildhauer Prof.
Erich Schmidt-Kestner in Sollingsandstein aus-
geführt worden, konnte aber erst 1971 end-
gültig in Volpriehausen aufgestellt werden. Ein
Denkmal gänzlich anderer Art, das an das
bäuerliche Leben in der Zeit vor der Industria-
lisierung Volpriehausens erinnert, findet sich in
Volpriehausen, Schäferei, Pfarrkirche, 1839/40
Volpriehausen, Schäferei. Pfarrkirche, Innenraum nach Westen
359
Südlich von Volpriehausen gab es seit den
siebziger Jahren den Basaltabbau bei der
Bramburg, der bis Anfang der zwanziger Jahre
des 2O.Jh. über eine Schmalspurfeldbahn mit
dem Bahnhof in Volpriehausen verbunden war.
Diese in der Nachbarschaft gelegenen Indus-
triebetriebe beschäftigten zwar eine große Zahl
von Arbeitskräften, gleichwohl waren die Folgen
für die Entwicklung des Ortsbildes noch um die
Jahrhundertwende gering. Dies änderte sich
erst mit dem Kalibergbau, der für das Dorf ein-
schneidende Veränderungen und eine kräftige
Ortserweiterung nach Süden mit sich brachte.
1895 wurde in Köln die Bergbau-Aktiengesell-
schaft Justus gegründet, die 1901 den ersten
Schacht Justus I am südöstlichen Ortsrand von
Volpriehausen anlegte. Ihm folgten umfangrei-
che Werksanlagen auf dem Gelände zwischen
Schachtstraße, B 241 und Eisenbahn. Die
Baulichkeiten des seit den zwanziger Jahren
des 20.Jh. als Kaliwerk Wittekind bekannten
Komplexes sind heute überwiegend abge-
brochen oder nur in veränderter Gestalt
überkommen, erhalten blieben einige Häuser
und Werkswohnungen, die im 1. Jahrzehnt des
Werks am Nordrand des Areals erbaut wurden
(Bollertstraße 24/26: Wohnheim für ledige
Arbeiter; Bollertstraße 28/30: ehemaliges
Steigerhaus). Wenig entfernt erinnert die ehe-
malige Direktorenvilla der Schachtanlage an
diesen überregional bedeutenden Wirtschafts-
betrieb. Das im Grund- und Aufriss lebhaft
gegliederte und mit repräsentativem Anspruch
gestaltete Haus ist ein Putzbau mit Sandstein-
einfassungen und -gliederungen, der um 1905
von den hannoverschen Architekten Fastje und
Schaumann entworfen wurde (Schachtstraße 9).
1938 übernahm die deutsche Wehrmacht das
Bergwerk, um seine Anlagen für die Lagerung
und Produktion von Munition zu nutzen. In
diesem Zusammenhang wurden noch im sel-
ben Jahr erhebliche Um- und Neubauten auf
dem Werksgelände unter dem Architekten Otto
Katzmann ausgeführt. Anschauliches Zeugnis
für diese letzte Phase aus dem Bestehen des
ehemaligen Kaliwerks ist heute noch die
Toranlage der östlichen Zufahrt zum Werk, ein
von hohen Stützmauern eingefasster steinerner
Turmbau, dessen gestalterischer Traditionalis-
mus wesentliche künstlerische Tendenzen des
Bauens in der Zeit des Nationalsozialismus
beispielhaft zur Anschauung bringen kann
(Industriestraße 6).
1945 wurde das Bergwerk durch das Explo-
sionsunglück vom 29./30. September ver-
nichtet. An das Werk und ganz in den künst-
lerischen Vorstellungen der Zeit, in der die
Anlagen für den Rüstungsbetrieb genutzt wur-
den, erinnert im Ort das überlebensgroße
Denkmal des Bergmanns in der Volperstraße.
Es war 1943 vom Architekten Katzmann ent-
worfen und 1945 durch den Bildhauer Prof.
Erich Schmidt-Kestner in Sollingsandstein aus-
geführt worden, konnte aber erst 1971 end-
gültig in Volpriehausen aufgestellt werden. Ein
Denkmal gänzlich anderer Art, das an das
bäuerliche Leben in der Zeit vor der Industria-
lisierung Volpriehausens erinnert, findet sich in
Volpriehausen, Schäferei, Pfarrkirche, 1839/40
Volpriehausen, Schäferei. Pfarrkirche, Innenraum nach Westen
359