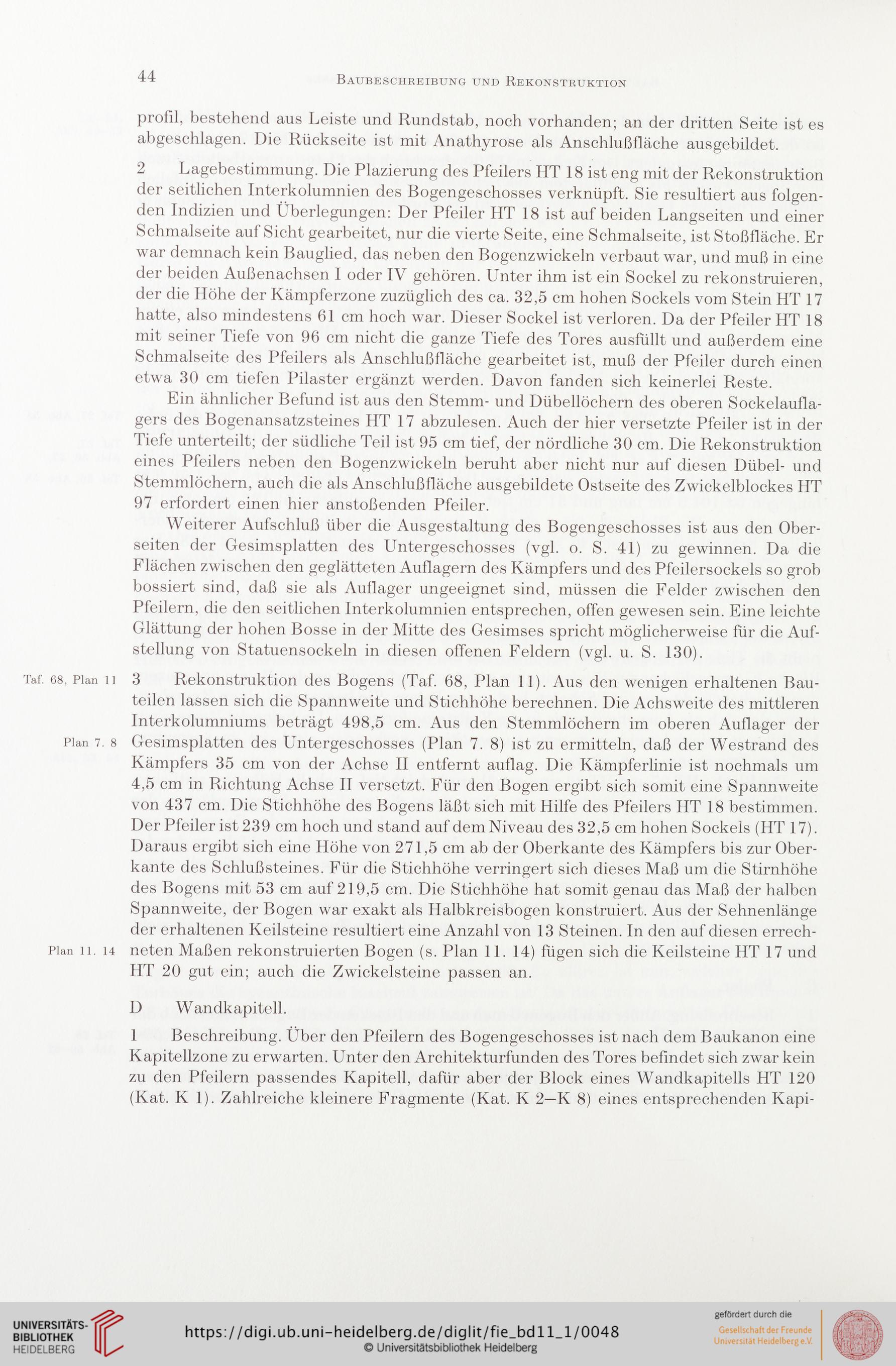44
Baubeschreibung und Rekonstruktion
profil, bestehend aus Leiste und Rundstab, noch vorhanden; an der dritten Seite ist es
abgeschlagen. Die Rückseite ist mit Anathyrose als Anschlußfläche ausgebildet.
2 Lagebestimmung. Die Plazierung des Pfeilers HT 18 ist eng mit der Rekonstruktion
der seitlichen Interkolumnien des Bogengeschosses verknüpft. Sie resultiert aus folgen-
den Indizien und Überlegungen: Der Pfeiler HT 18 ist auf beiden Langseiten und einer
Schmalseite auf Sicht gearbeitet, nur die vierte Seite, eine Schmalseite, ist Stoßfläche. Er
war demnach kein Bauglied, das neben den Bogenzwickeln verbaut war, und muß in eine
der beiden Außenachsen I oder IV gehören. Unter ihm ist ein Sockel zu rekonstruieren,
der die Höhe der Kämpferzone zuzüglich des ca. 32,5 cm hohen Sockels vom Stein HT 17
hatte, also mindestens 61 cm hoch war. Dieser Sockel ist verloren. Da der Pfeiler HT 18
mit seiner Tiefe von 96 cm nicht die ganze Tiefe des Tores ausfüllt und außerdem eine
Schmalseite des Pfeilers als Anschlußfläche gearbeitet ist, muß der Pfeiler durch einen
etwa 30 cm tiefen Pilaster ergänzt werden. Davon fanden sich keinerlei Reste.
Ein ähnlicher Befund ist aus den Stemm- und Dübellöchern des oberen Sockelaufla-
gers des Bogenansatzsteines HT 17 abzulesen. Auch der hier versetzte Pfeiler ist in der
Tiefe unterteilt; der südliche Teil ist 95 cm tief, der nördliche 30 cm. Die Rekonstruktion
eines Pfeilers neben den Bogenzwickeln beruht aber nicht nur auf diesen Dübel- und
Stemmlöchern, auch die als Anschlußfläche ausgebildete Ostseite des Zwickelblockes HT
97 erfordert einen hier anstoßenden Pfeiler.
Weiterer Aufschluß über die Ausgestaltung des Bogengeschosses ist aus den Ober-
seiten der Gesimsplatten des Untergeschosses (vgl. o. S. 41) zu gewinnen. Da die
Flächen zwischen den geglätteten Auflagern des Kämpfers und des Pfeilersockels so grob
bossiert sind, daß sie als Auflager ungeeignet sind, müssen die Felder zwischen den
Pfeilern, die den seitlichen Interkolumnien entsprechen, offen gewesen sein. Eine leichte
Glättung der hohen Bosse in der Mitte des Gesimses spricht möglicherweise für die Auf-
stellung von Statuensockeln in diesen offenen Feldern (vgl. u. S. 130).
Taf. 68, Plan 11
Plan 7. 8
Plan 11. 14
3 Rekonstruktion des Bogens (Taf. 68, Plan 11). Aus den wenigen erhaltenen Bau-
teilen lassen sich die Spannweite und Stichhöhe berechnen. Die Achsweite des mittleren
Interkolumniums beträgt 498,5 cm. Aus den Stemmlöchern im oberen Auflager der
Gesimsplatten des Untergeschosses (Plan 7. 8) ist zu ermitteln, daß der Westrand des
Kämpfers 35 cm von der Achse II entfernt auflag. Die Kämpferlinie ist nochmals um
4,5 cm in Richtung Achse II versetzt. Für den Bogen ergibt sich somit eine Spannweite
von 437 cm. Die Stichhöhe des Bogens läßt sich mit Hilfe des Pfeilers HT 18 bestimmen.
Der Pfeiler ist 239 cm hoch und stand auf dem Niveau des 32,5 cm hohen Sockels (HT 17).
Daraus ergibt sich eine Höhe von 271,5 cm ab der Oberkante des Kämpfers bis zur Ober-
kante des Schlußsteines. Für die Stichhöhe verringert sich dieses Maß um die Stirnhöhe
des Bogens mit 53 cm auf 219,5 cm. Die Stichhöhe hat somit genau das Maß der halben
Spannweite, der Bogen war exakt als Halbkreisbogen konstruiert. Aus der Sehnenlänge
der erhaltenen Keilsteine resultiert eine Anzahl von 13 Steinen. In den auf diesen errech-
neten Maßen rekonstruierten Bogen (s. Plan 11. 14) fügen sich die Keilsteine HT 17 und
HT 20 gut ein; auch die Zwickelsteine passen an.
D Wandkapitell.
1 Beschreibung. Über den Pfeilern des Bogengeschosses ist nach dem Baukanon eine
Kapitellzone zu erwarten. Unter den Architekturfunden des Tores befindet sich zwar kein
zu den Pfeilern passendes Kapitell, dafür aber der Block eines Wandkapitells HT 120
(Kat. Kl). Zahlreiche kleinere Fragmente (Kat. K 2—K 8) eines entsprechenden Kapi-
Baubeschreibung und Rekonstruktion
profil, bestehend aus Leiste und Rundstab, noch vorhanden; an der dritten Seite ist es
abgeschlagen. Die Rückseite ist mit Anathyrose als Anschlußfläche ausgebildet.
2 Lagebestimmung. Die Plazierung des Pfeilers HT 18 ist eng mit der Rekonstruktion
der seitlichen Interkolumnien des Bogengeschosses verknüpft. Sie resultiert aus folgen-
den Indizien und Überlegungen: Der Pfeiler HT 18 ist auf beiden Langseiten und einer
Schmalseite auf Sicht gearbeitet, nur die vierte Seite, eine Schmalseite, ist Stoßfläche. Er
war demnach kein Bauglied, das neben den Bogenzwickeln verbaut war, und muß in eine
der beiden Außenachsen I oder IV gehören. Unter ihm ist ein Sockel zu rekonstruieren,
der die Höhe der Kämpferzone zuzüglich des ca. 32,5 cm hohen Sockels vom Stein HT 17
hatte, also mindestens 61 cm hoch war. Dieser Sockel ist verloren. Da der Pfeiler HT 18
mit seiner Tiefe von 96 cm nicht die ganze Tiefe des Tores ausfüllt und außerdem eine
Schmalseite des Pfeilers als Anschlußfläche gearbeitet ist, muß der Pfeiler durch einen
etwa 30 cm tiefen Pilaster ergänzt werden. Davon fanden sich keinerlei Reste.
Ein ähnlicher Befund ist aus den Stemm- und Dübellöchern des oberen Sockelaufla-
gers des Bogenansatzsteines HT 17 abzulesen. Auch der hier versetzte Pfeiler ist in der
Tiefe unterteilt; der südliche Teil ist 95 cm tief, der nördliche 30 cm. Die Rekonstruktion
eines Pfeilers neben den Bogenzwickeln beruht aber nicht nur auf diesen Dübel- und
Stemmlöchern, auch die als Anschlußfläche ausgebildete Ostseite des Zwickelblockes HT
97 erfordert einen hier anstoßenden Pfeiler.
Weiterer Aufschluß über die Ausgestaltung des Bogengeschosses ist aus den Ober-
seiten der Gesimsplatten des Untergeschosses (vgl. o. S. 41) zu gewinnen. Da die
Flächen zwischen den geglätteten Auflagern des Kämpfers und des Pfeilersockels so grob
bossiert sind, daß sie als Auflager ungeeignet sind, müssen die Felder zwischen den
Pfeilern, die den seitlichen Interkolumnien entsprechen, offen gewesen sein. Eine leichte
Glättung der hohen Bosse in der Mitte des Gesimses spricht möglicherweise für die Auf-
stellung von Statuensockeln in diesen offenen Feldern (vgl. u. S. 130).
Taf. 68, Plan 11
Plan 7. 8
Plan 11. 14
3 Rekonstruktion des Bogens (Taf. 68, Plan 11). Aus den wenigen erhaltenen Bau-
teilen lassen sich die Spannweite und Stichhöhe berechnen. Die Achsweite des mittleren
Interkolumniums beträgt 498,5 cm. Aus den Stemmlöchern im oberen Auflager der
Gesimsplatten des Untergeschosses (Plan 7. 8) ist zu ermitteln, daß der Westrand des
Kämpfers 35 cm von der Achse II entfernt auflag. Die Kämpferlinie ist nochmals um
4,5 cm in Richtung Achse II versetzt. Für den Bogen ergibt sich somit eine Spannweite
von 437 cm. Die Stichhöhe des Bogens läßt sich mit Hilfe des Pfeilers HT 18 bestimmen.
Der Pfeiler ist 239 cm hoch und stand auf dem Niveau des 32,5 cm hohen Sockels (HT 17).
Daraus ergibt sich eine Höhe von 271,5 cm ab der Oberkante des Kämpfers bis zur Ober-
kante des Schlußsteines. Für die Stichhöhe verringert sich dieses Maß um die Stirnhöhe
des Bogens mit 53 cm auf 219,5 cm. Die Stichhöhe hat somit genau das Maß der halben
Spannweite, der Bogen war exakt als Halbkreisbogen konstruiert. Aus der Sehnenlänge
der erhaltenen Keilsteine resultiert eine Anzahl von 13 Steinen. In den auf diesen errech-
neten Maßen rekonstruierten Bogen (s. Plan 11. 14) fügen sich die Keilsteine HT 17 und
HT 20 gut ein; auch die Zwickelsteine passen an.
D Wandkapitell.
1 Beschreibung. Über den Pfeilern des Bogengeschosses ist nach dem Baukanon eine
Kapitellzone zu erwarten. Unter den Architekturfunden des Tores befindet sich zwar kein
zu den Pfeilern passendes Kapitell, dafür aber der Block eines Wandkapitells HT 120
(Kat. Kl). Zahlreiche kleinere Fragmente (Kat. K 2—K 8) eines entsprechenden Kapi-