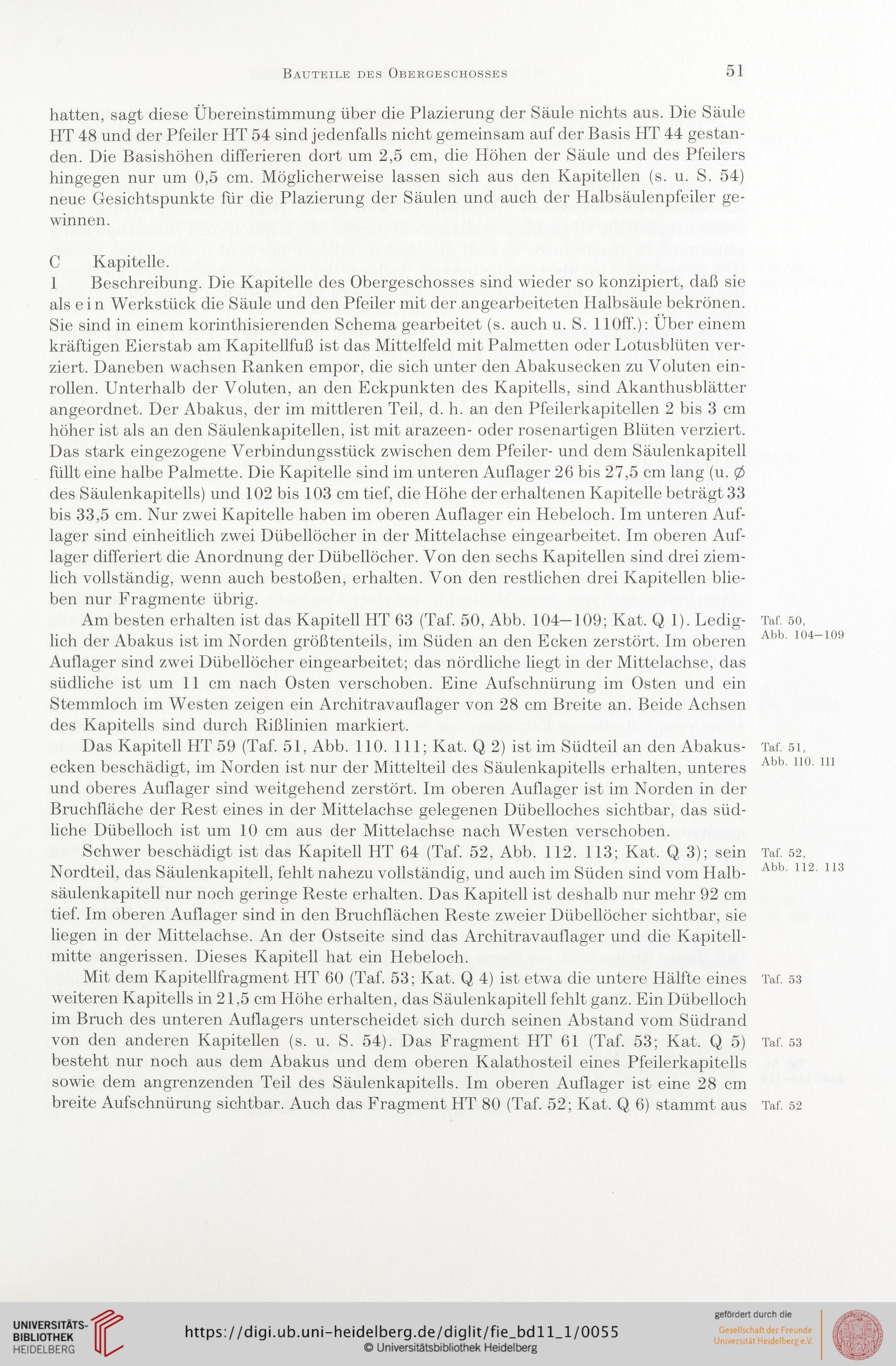Bauteile des Obergeschosses
51
hatten, sagt diese Übereinstimmung über die Plazierung der Säule nichts aus. Die Säule
HT 48 und der Pfeiler HT 54 sind jedenfalls nicht gemeinsam auf der Basis HT 44 gestan-
den. Die Basishöhen differieren dort um 2,5 cm, die Höhen der Säule und des Pfeilers
hingegen nur um 0,5 cm. Möglicherweise lassen sich aus den Kapitellen (s. u. S. 54)
neue Gesichtspunkte für die Plazierung der Säulen und auch der Halbsäulenpfeiler ge-
winnen.
C Kapitelle.
1 Beschreibung. Die Kapitelle des Obergeschosses sind wieder so konzipiert, daß sie
als e i n Werkstück die Säule und den Pfeiler mit der angearbeiteten Halbsäule bekrönen.
Sie sind in einem korinthisierenden Schema gearbeitet (s. auch u. S. llOff.): Über einem
kräftigen Eierstab am Kapitellfuß ist das Mittelfeld mit Palmetten oder Lotusblüten ver-
ziert. Daneben wachsen Ranken empor, die sich unter den Abakusecken zu Voluten ein-
rollen. Unterhalb der Voluten, an den Eckpunkten des Kapitells, sind Akanthusblätter
angeordnet. Der Abakus, der im mittleren Teil, d. h. an den Pfeilerkapitellen 2 bis 3 cm
höher ist als an den Säulenkapitellen, ist mit arazeen- oder rosenartigen Blüten verziert.
Das stark eingezogene Verbindungsstück zwischen dem Pfeiler- und dem Säulenkapitell
füllt eine halbe Palmette. Die Kapitelle sind im unteren Auflager 26 bis 27,5 cm lang (u. 0
des Säulenkapitells) und 102 bis 103 cm tief, die Höhe der erhaltenen Kapitelle beträgt 33
bis 33,5 cm. Nur zwei Kapitelle haben im oberen Auflager ein Hebeloch. Im unteren Auf-
lager sind einheitlich zwei Dübellöcher in der Mittelachse eingearbeitet. Im oberen Auf-
lager differiert die Anordnung der Dübellöcher. Von den sechs Kapitellen sind drei ziem-
lich vollständig, wenn auch bestoßen, erhalten. Von den restlichen drei Kapitellen blie-
ben nur Fragmente übrig.
Am besten erhalten ist das Kapitell HT 63 (Taf. 50, Abb. 104—109; Kat. Ql). Ledig-
lich der Abakus ist im Norden größtenteils, im Süden an den Ecken zerstört. Im oberen
Auflager sind zwei Dübellöcher eingearbeitet; das nördliche liegt in der Mittelachse, das
südliche ist um 11 cm nach Osten verschoben. Eine Aufschnürung im Osten und ein
Stemmloch im Westen zeigen ein Architravauflager von 28 cm Breite an. Beide Achsen
des Kapitells sind durch Rißlinien markiert.
Das Kapitell HT 59 (Taf. 51, Abb. 110. 111; Kat. Q 2) ist im Südteil an den Abakus-
ecken beschädigt, im Norden ist nur der Mittelteil des Säulenkapitells erhalten, unteres
und oberes Auflager sind weitgehend zerstört. Im oberen Auflager ist im Norden in der
Bruchfläche der Rest eines in der Mittelachse gelegenen Dübelloches sichtbar, das süd-
liche Dübelloch ist um 10 cm aus der Mittelachse nach Westen verschoben.
Schwer beschädigt ist das Kapitell HT 64 (Taf. 52, Abb. 112. 113; Kat. Q 3); sein
Nordteil, das Säulenkapitell, fehlt nahezu vollständig, und auch im Süden sind vom Halb-
säulenkapitell nur noch geringe Reste erhalten. Das Kapitell ist deshalb nur mehr 92 cm
tief. Im oberen Auflager sind in den Bruchflächen Reste zweier Dübellöcher sichtbar, sie
liegen in der Mittelachse. An der Ostseite sind das Architravauflager und die Kapitell-
mitte angerissen. Dieses Kapitell hat ein Hebeloch.
Mit dem Kapitellfragment HT 60 (Taf. 53; Kat. Q 4) ist etwa die untere Hälfte eines
weiteren Kapitells in 21,5 cm Höhe erhalten, das Säulenkapitell fehlt ganz. Ein Dübelloch
im Bruch des unteren Auflagers unterscheidet sich durch seinen Abstand vom Südrand
von den anderen Kapitellen (s. u. S. 54). Das Fragment HT 61 (Taf. 53; Kat. Q 5)
besteht nur noch aus dem Abakus und dem oberen Kalathosteil eines Pfeilerkapitells
sowie dem angrenzenden Teil des Säulenkapitells. Im oberen Auflager ist eine 28 cm
breite Aufschnürung sichtbar. Auch das Fragment HT 80 (Taf. 52; Kat. Q 6) stammt aus
Taf. 50,
Abb. 104-109
Taf. 51,
Abb. 110. 111
Taf. 52,
Abb. 112. 113
Taf. 53
Taf. 53
Taf. 52
51
hatten, sagt diese Übereinstimmung über die Plazierung der Säule nichts aus. Die Säule
HT 48 und der Pfeiler HT 54 sind jedenfalls nicht gemeinsam auf der Basis HT 44 gestan-
den. Die Basishöhen differieren dort um 2,5 cm, die Höhen der Säule und des Pfeilers
hingegen nur um 0,5 cm. Möglicherweise lassen sich aus den Kapitellen (s. u. S. 54)
neue Gesichtspunkte für die Plazierung der Säulen und auch der Halbsäulenpfeiler ge-
winnen.
C Kapitelle.
1 Beschreibung. Die Kapitelle des Obergeschosses sind wieder so konzipiert, daß sie
als e i n Werkstück die Säule und den Pfeiler mit der angearbeiteten Halbsäule bekrönen.
Sie sind in einem korinthisierenden Schema gearbeitet (s. auch u. S. llOff.): Über einem
kräftigen Eierstab am Kapitellfuß ist das Mittelfeld mit Palmetten oder Lotusblüten ver-
ziert. Daneben wachsen Ranken empor, die sich unter den Abakusecken zu Voluten ein-
rollen. Unterhalb der Voluten, an den Eckpunkten des Kapitells, sind Akanthusblätter
angeordnet. Der Abakus, der im mittleren Teil, d. h. an den Pfeilerkapitellen 2 bis 3 cm
höher ist als an den Säulenkapitellen, ist mit arazeen- oder rosenartigen Blüten verziert.
Das stark eingezogene Verbindungsstück zwischen dem Pfeiler- und dem Säulenkapitell
füllt eine halbe Palmette. Die Kapitelle sind im unteren Auflager 26 bis 27,5 cm lang (u. 0
des Säulenkapitells) und 102 bis 103 cm tief, die Höhe der erhaltenen Kapitelle beträgt 33
bis 33,5 cm. Nur zwei Kapitelle haben im oberen Auflager ein Hebeloch. Im unteren Auf-
lager sind einheitlich zwei Dübellöcher in der Mittelachse eingearbeitet. Im oberen Auf-
lager differiert die Anordnung der Dübellöcher. Von den sechs Kapitellen sind drei ziem-
lich vollständig, wenn auch bestoßen, erhalten. Von den restlichen drei Kapitellen blie-
ben nur Fragmente übrig.
Am besten erhalten ist das Kapitell HT 63 (Taf. 50, Abb. 104—109; Kat. Ql). Ledig-
lich der Abakus ist im Norden größtenteils, im Süden an den Ecken zerstört. Im oberen
Auflager sind zwei Dübellöcher eingearbeitet; das nördliche liegt in der Mittelachse, das
südliche ist um 11 cm nach Osten verschoben. Eine Aufschnürung im Osten und ein
Stemmloch im Westen zeigen ein Architravauflager von 28 cm Breite an. Beide Achsen
des Kapitells sind durch Rißlinien markiert.
Das Kapitell HT 59 (Taf. 51, Abb. 110. 111; Kat. Q 2) ist im Südteil an den Abakus-
ecken beschädigt, im Norden ist nur der Mittelteil des Säulenkapitells erhalten, unteres
und oberes Auflager sind weitgehend zerstört. Im oberen Auflager ist im Norden in der
Bruchfläche der Rest eines in der Mittelachse gelegenen Dübelloches sichtbar, das süd-
liche Dübelloch ist um 10 cm aus der Mittelachse nach Westen verschoben.
Schwer beschädigt ist das Kapitell HT 64 (Taf. 52, Abb. 112. 113; Kat. Q 3); sein
Nordteil, das Säulenkapitell, fehlt nahezu vollständig, und auch im Süden sind vom Halb-
säulenkapitell nur noch geringe Reste erhalten. Das Kapitell ist deshalb nur mehr 92 cm
tief. Im oberen Auflager sind in den Bruchflächen Reste zweier Dübellöcher sichtbar, sie
liegen in der Mittelachse. An der Ostseite sind das Architravauflager und die Kapitell-
mitte angerissen. Dieses Kapitell hat ein Hebeloch.
Mit dem Kapitellfragment HT 60 (Taf. 53; Kat. Q 4) ist etwa die untere Hälfte eines
weiteren Kapitells in 21,5 cm Höhe erhalten, das Säulenkapitell fehlt ganz. Ein Dübelloch
im Bruch des unteren Auflagers unterscheidet sich durch seinen Abstand vom Südrand
von den anderen Kapitellen (s. u. S. 54). Das Fragment HT 61 (Taf. 53; Kat. Q 5)
besteht nur noch aus dem Abakus und dem oberen Kalathosteil eines Pfeilerkapitells
sowie dem angrenzenden Teil des Säulenkapitells. Im oberen Auflager ist eine 28 cm
breite Aufschnürung sichtbar. Auch das Fragment HT 80 (Taf. 52; Kat. Q 6) stammt aus
Taf. 50,
Abb. 104-109
Taf. 51,
Abb. 110. 111
Taf. 52,
Abb. 112. 113
Taf. 53
Taf. 53
Taf. 52