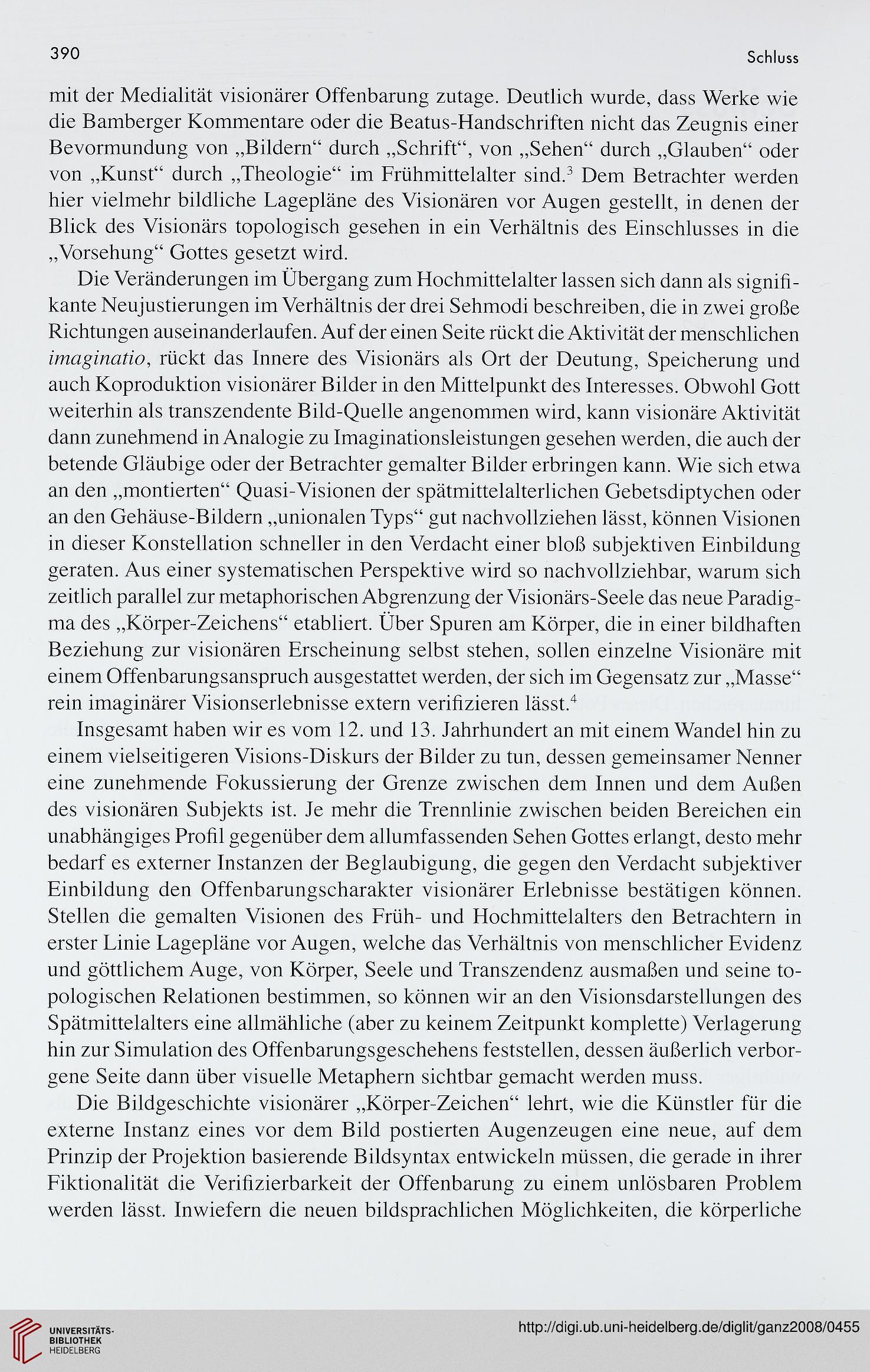390
Schluss
mit der Medialität visionärer Offenbarung zutage. Deutlich wurde, dass Werke wie
die Bamberger Kommentare oder die Beatus-Handschriften nicht das Zeugnis einer
Bevormundung von „Bildern" durch „Schrift", von „Sehen" durch „Glauben" oder
von „Kunst" durch „Theologie" im Frühmittelalter sind.3 Dem Betrachter werden
hier vielmehr bildliche Lagepläne des Visionären vor Augen gestellt, in denen der
Blick des Visionärs topologisch gesehen in ein Verhältnis des Einschlusses in die
„Vorsehung" Gottes gesetzt wird.
Die Veränderungen im Übergang zum Hochmittelalter lassen sich dann als signifi-
kante Neujustierungen im Verhältnis der drei Sehmodi beschreiben, die in zwei große
Richtungen auseinanderlaufen. Auf der einen Seite rückt die Aktivität der menschlichen
imaginatio, rückt das Innere des Visionärs als Ort der Deutung, Speicherung und
auch Koproduktion visionärer Bilder in den Mittelpunkt des Interesses. Obwohl Gott
weiterhin als transzendente Bild-Quelle angenommen wird, kann visionäre Aktivität
dann zunehmend in Analogie zu Imaginationsleistungen gesehen werden, die auch der
betende Gläubige oder der Betrachter gemalter Bilder erbringen kann. Wie sich etwa
an den „montierten" Quasi-Visionen der spätmittelalterlichen Gebetsdiptychen oder
an den Gehäuse-Bildern „unionalen Typs" gut nachvollziehen lässt, können Visionen
in dieser Konstellation schneller in den Verdacht einer bloß subjektiven Einbildung
geraten. Aus einer systematischen Perspektive wird so nachvollziehbar, warum sich
zeitlich parallel zur metaphorischen Abgrenzung der Visionärs-Seele das neue Paradig-
ma des „Körper-Zeichens" etabliert. Über Spuren am Körper, die in einer bildhaften
Beziehung zur visionären Erscheinung selbst stehen, sollen einzelne Visionäre mit
einem Offenbarungsanspruch ausgestattet werden, der sich im Gegensatz zur „Masse"
rein imaginärer Visionserlebnisse extern verifizieren lässt.4
Insgesamt haben wir es vom 12. und 13. Jahrhundert an mit einem Wandel hin zu
einem vielseitigeren Visions-Diskurs der Bilder zu tun, dessen gemeinsamer Nenner
eine zunehmende Fokussierung der Grenze zwischen dem Innen und dem Außen
des visionären Subjekts ist. Je mehr die Trennlinie zwischen beiden Bereichen ein
unabhängiges Profil gegenüber dem allumfassenden Sehen Gottes erlangt, desto mehr
bedarf es externer Instanzen der Beglaubigung, die gegen den Verdacht subjektiver
Einbildung den Offenbarungscharakter visionärer Erlebnisse bestätigen können.
Stellen die gemalten Visionen des Früh- und Hochmittelalters den Betrachtern in
erster Linie Lagepläne vor Augen, welche das Verhältnis von menschlicher Evidenz
und göttlichem Auge, von Körper, Seele und Transzendenz ausmaßen und seine to-
pologischen Relationen bestimmen, so können wir an den Visionsdarstellungen des
Spätmittelalters eine allmähliche (aber zu keinem Zeitpunkt komplette) Verlagerung
hin zur Simulation des Offenbarungsgeschehens feststellen, dessen äußerlich verbor-
gene Seite dann über visuelle Metaphern sichtbar gemacht werden muss.
Die Bildgeschichte visionärer „Körper-Zeichen" lehrt, wie die Künstler für die
externe Instanz eines vor dem Bild postierten Augenzeugen eine neue, auf dem
Prinzip der Projektion basierende Bildsyntax entwickeln müssen, die gerade in ihrer
Fiktionalität die Verifizierbarkeit der Offenbarung zu einem unlösbaren Problem
werden lässt. Inwiefern die neuen bildsprachlichen Möglichkeiten, die körperliche
Schluss
mit der Medialität visionärer Offenbarung zutage. Deutlich wurde, dass Werke wie
die Bamberger Kommentare oder die Beatus-Handschriften nicht das Zeugnis einer
Bevormundung von „Bildern" durch „Schrift", von „Sehen" durch „Glauben" oder
von „Kunst" durch „Theologie" im Frühmittelalter sind.3 Dem Betrachter werden
hier vielmehr bildliche Lagepläne des Visionären vor Augen gestellt, in denen der
Blick des Visionärs topologisch gesehen in ein Verhältnis des Einschlusses in die
„Vorsehung" Gottes gesetzt wird.
Die Veränderungen im Übergang zum Hochmittelalter lassen sich dann als signifi-
kante Neujustierungen im Verhältnis der drei Sehmodi beschreiben, die in zwei große
Richtungen auseinanderlaufen. Auf der einen Seite rückt die Aktivität der menschlichen
imaginatio, rückt das Innere des Visionärs als Ort der Deutung, Speicherung und
auch Koproduktion visionärer Bilder in den Mittelpunkt des Interesses. Obwohl Gott
weiterhin als transzendente Bild-Quelle angenommen wird, kann visionäre Aktivität
dann zunehmend in Analogie zu Imaginationsleistungen gesehen werden, die auch der
betende Gläubige oder der Betrachter gemalter Bilder erbringen kann. Wie sich etwa
an den „montierten" Quasi-Visionen der spätmittelalterlichen Gebetsdiptychen oder
an den Gehäuse-Bildern „unionalen Typs" gut nachvollziehen lässt, können Visionen
in dieser Konstellation schneller in den Verdacht einer bloß subjektiven Einbildung
geraten. Aus einer systematischen Perspektive wird so nachvollziehbar, warum sich
zeitlich parallel zur metaphorischen Abgrenzung der Visionärs-Seele das neue Paradig-
ma des „Körper-Zeichens" etabliert. Über Spuren am Körper, die in einer bildhaften
Beziehung zur visionären Erscheinung selbst stehen, sollen einzelne Visionäre mit
einem Offenbarungsanspruch ausgestattet werden, der sich im Gegensatz zur „Masse"
rein imaginärer Visionserlebnisse extern verifizieren lässt.4
Insgesamt haben wir es vom 12. und 13. Jahrhundert an mit einem Wandel hin zu
einem vielseitigeren Visions-Diskurs der Bilder zu tun, dessen gemeinsamer Nenner
eine zunehmende Fokussierung der Grenze zwischen dem Innen und dem Außen
des visionären Subjekts ist. Je mehr die Trennlinie zwischen beiden Bereichen ein
unabhängiges Profil gegenüber dem allumfassenden Sehen Gottes erlangt, desto mehr
bedarf es externer Instanzen der Beglaubigung, die gegen den Verdacht subjektiver
Einbildung den Offenbarungscharakter visionärer Erlebnisse bestätigen können.
Stellen die gemalten Visionen des Früh- und Hochmittelalters den Betrachtern in
erster Linie Lagepläne vor Augen, welche das Verhältnis von menschlicher Evidenz
und göttlichem Auge, von Körper, Seele und Transzendenz ausmaßen und seine to-
pologischen Relationen bestimmen, so können wir an den Visionsdarstellungen des
Spätmittelalters eine allmähliche (aber zu keinem Zeitpunkt komplette) Verlagerung
hin zur Simulation des Offenbarungsgeschehens feststellen, dessen äußerlich verbor-
gene Seite dann über visuelle Metaphern sichtbar gemacht werden muss.
Die Bildgeschichte visionärer „Körper-Zeichen" lehrt, wie die Künstler für die
externe Instanz eines vor dem Bild postierten Augenzeugen eine neue, auf dem
Prinzip der Projektion basierende Bildsyntax entwickeln müssen, die gerade in ihrer
Fiktionalität die Verifizierbarkeit der Offenbarung zu einem unlösbaren Problem
werden lässt. Inwiefern die neuen bildsprachlichen Möglichkeiten, die körperliche