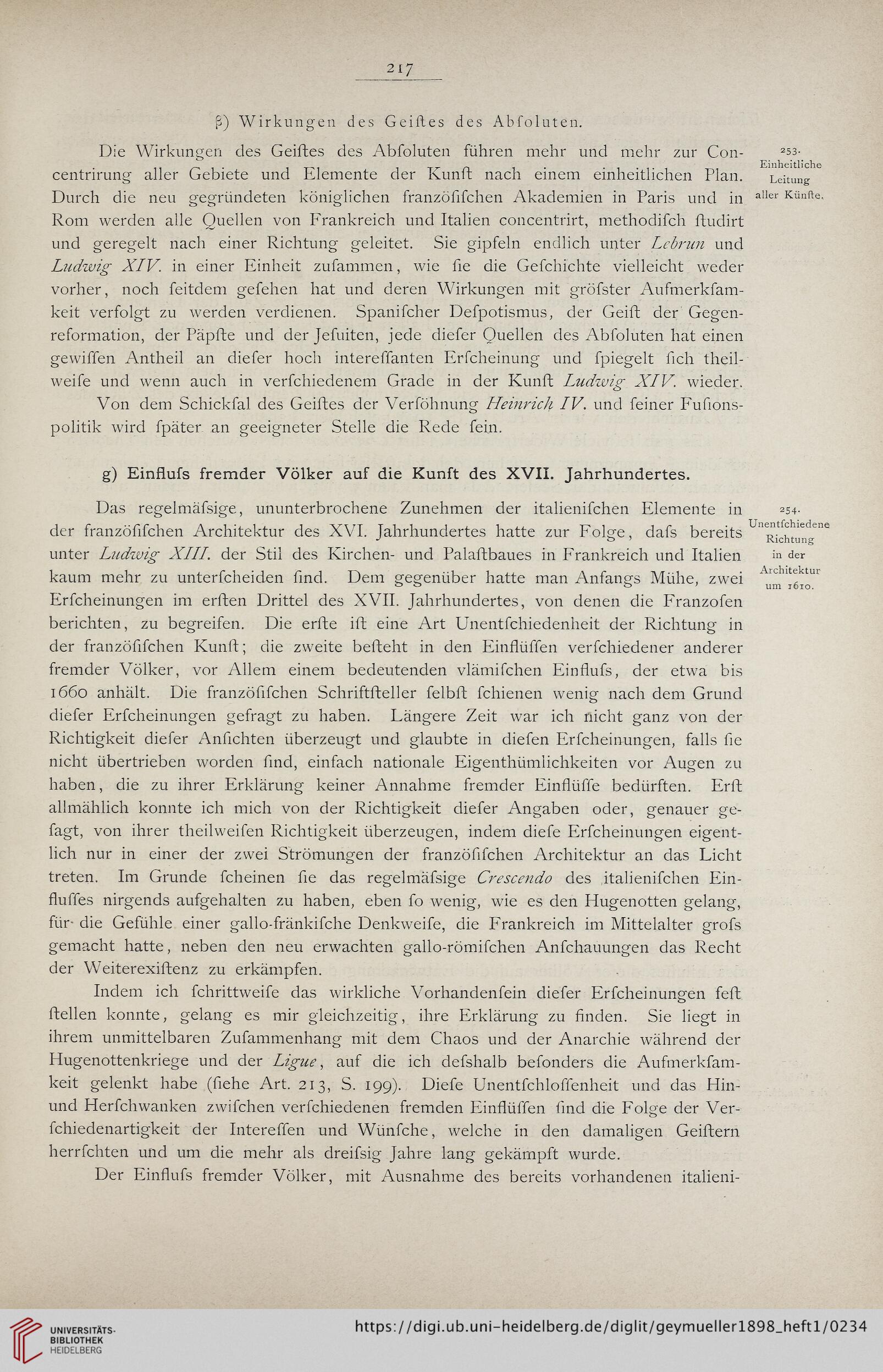217
g) Einflufs fremder Völker auf die Kunft des XVII. Jahrhundertes.
253-
Einheitliche
Leitung
aller Kiinfte.
254.
Unentfchiedene
Richtung
in der
Architektur
um 1610.
Das regelmäfsige, ununterbrochene Zunehmen der italienifchen Elemente in
der franzöfifchen Architektur des XVI. Jahrhundertes hatte zur Folge, dafs bereits
unter Ludwig XIII. der Stil des Kirchen- und Palaftbaues in Frankreich und Italien
kaum mehr zu unterfcheiden find. Dem gegenüber hatte man Anfangs Mühe, zwei
Erfcheinungen im erften Drittel des XVII. Jahrhundertes, von denen die Franzofen
berichten, zu begreifen. Die erfte ift eine Art Unentfchiedenheit der Richtung in
der franzöfifchen Kunft; die zweite befteht in den Einflüffen verfchiedener anderer
fremder Völker, vor Allem einem bedeutenden vlämifchen Einflufs, der etwa bis
1660 anhält. Die franzöfifchen Schriftfteller felbft fchienen wenig nach dem Grund
diefer Erfcheinungen gefragt zu haben. Längere Zeit war ich nicht ganz von der
Richtigkeit diefer Anfichten überzeugt und glaubte in diefen Erfcheinungen, falls fie
nicht übertrieben worden find, einfach nationale Eigenthümlichkeiten vor Augen zu
haben, die zu ihrer Erklärung keiner Annahme fremder Einflüße bedürften. Erft
allmählich konnte ich mich von der Richtigkeit diefer Angaben oder, genauer ge-
tagt, von ihrer theilweifen Richtigkeit überzeugen, indem diefe Erfcheinungen eigent-
lich nur in einer der zwei Strömungen der franzöfifchen Architektur an das Licht
treten. Im Grunde fcheinen fie das regelmäfsige Crescendo des italienifchen Ein-
flußes nirgends aufgehalten zu haben, eben fo wenig, wie es den Hugenotten gelang,
für- die Gefühle einer gallo-fränkifche Denkweife, die Frankreich im Mittelalter grofs
gemacht hatte, neben den neu erwachten gallo-römifchen Anfchauungen das Recht
der Weiterexiftenz zu erkämpfen.
Indem ich fchrittweife das wirkliche Vorhandenfein diefer Erfcheinungen feft
ftellen konnte, gelang es mir gleichzeitig, ihre Erklärung zu finden. Sie liegt in
ihrem unmittelbaren Zufammenhang mit dem Chaos und der Anarchie während der
Hugenottenkriege und der Ligue, auf die ich defshalb befonders die Aufmerkfam-
keit gelenkt habe (fiehe Art. 213, S. 199). Diefe Unentfchloffenheit und das Hin-
und Herfchwanken zwifchen verfchiedenen fremden Einflüffen find die Folge der Ver-
fchiedenartigkeit der Intereffen und Wünfche, welche in den damaligen Geiftern
herrfchten und um die mehr als dreifsig Jahre lang gekämpft wurde.
Der Einflufs fremder Völker, mit Ausnahme des bereits vorhandenen italieni-
ß) Wirkungen des Geiftes des Abfoluten.
Die Wirkungen des Geiftes des Abfoluten führen mehr und mehr zur Con-
centrirung aller Gebiete und Elemente der Kunft nach einem einheitlichen Plan.
Durch die neu gegründeten königlichen franzöfifchen Akademien in Paris und in
Rom werden alle Quellen von Frankreich und Italien concentrirt, methodifch ftudirt
und geregelt nach einer Richtung geleitet. Sie gipfeln endlich unter Lebrun und
Ludwig XIV. in einer Einheit zufammen, wie fie die Gefchichte vielleicht weder
vorher, noch feitdem gefehen hat und deren Wirkungen mit gröbster Aufmerkfam-
keit verfolgt zu werden verdienen. Spanifcher Defpotismus, der Geift der Gegen-
reformation, der Päpfte und der Jefuiten, jede diefer Quellen des Abfoluten hat einen
gewißen Antheil an diefer hoch intereßanten Erfcheinung und fpiegelt fich theil-
weife und wenn auch in verfchiedenem Grade in der Kunft Ludwig XIV. wieder.
Von dem Schickfal des Geiftes der Verföhnung Heinrich IV. und feiner Fufions-
politik wird fpäter an geeigneter Stelle die Rede fein.
g) Einflufs fremder Völker auf die Kunft des XVII. Jahrhundertes.
253-
Einheitliche
Leitung
aller Kiinfte.
254.
Unentfchiedene
Richtung
in der
Architektur
um 1610.
Das regelmäfsige, ununterbrochene Zunehmen der italienifchen Elemente in
der franzöfifchen Architektur des XVI. Jahrhundertes hatte zur Folge, dafs bereits
unter Ludwig XIII. der Stil des Kirchen- und Palaftbaues in Frankreich und Italien
kaum mehr zu unterfcheiden find. Dem gegenüber hatte man Anfangs Mühe, zwei
Erfcheinungen im erften Drittel des XVII. Jahrhundertes, von denen die Franzofen
berichten, zu begreifen. Die erfte ift eine Art Unentfchiedenheit der Richtung in
der franzöfifchen Kunft; die zweite befteht in den Einflüffen verfchiedener anderer
fremder Völker, vor Allem einem bedeutenden vlämifchen Einflufs, der etwa bis
1660 anhält. Die franzöfifchen Schriftfteller felbft fchienen wenig nach dem Grund
diefer Erfcheinungen gefragt zu haben. Längere Zeit war ich nicht ganz von der
Richtigkeit diefer Anfichten überzeugt und glaubte in diefen Erfcheinungen, falls fie
nicht übertrieben worden find, einfach nationale Eigenthümlichkeiten vor Augen zu
haben, die zu ihrer Erklärung keiner Annahme fremder Einflüße bedürften. Erft
allmählich konnte ich mich von der Richtigkeit diefer Angaben oder, genauer ge-
tagt, von ihrer theilweifen Richtigkeit überzeugen, indem diefe Erfcheinungen eigent-
lich nur in einer der zwei Strömungen der franzöfifchen Architektur an das Licht
treten. Im Grunde fcheinen fie das regelmäfsige Crescendo des italienifchen Ein-
flußes nirgends aufgehalten zu haben, eben fo wenig, wie es den Hugenotten gelang,
für- die Gefühle einer gallo-fränkifche Denkweife, die Frankreich im Mittelalter grofs
gemacht hatte, neben den neu erwachten gallo-römifchen Anfchauungen das Recht
der Weiterexiftenz zu erkämpfen.
Indem ich fchrittweife das wirkliche Vorhandenfein diefer Erfcheinungen feft
ftellen konnte, gelang es mir gleichzeitig, ihre Erklärung zu finden. Sie liegt in
ihrem unmittelbaren Zufammenhang mit dem Chaos und der Anarchie während der
Hugenottenkriege und der Ligue, auf die ich defshalb befonders die Aufmerkfam-
keit gelenkt habe (fiehe Art. 213, S. 199). Diefe Unentfchloffenheit und das Hin-
und Herfchwanken zwifchen verfchiedenen fremden Einflüffen find die Folge der Ver-
fchiedenartigkeit der Intereffen und Wünfche, welche in den damaligen Geiftern
herrfchten und um die mehr als dreifsig Jahre lang gekämpft wurde.
Der Einflufs fremder Völker, mit Ausnahme des bereits vorhandenen italieni-
ß) Wirkungen des Geiftes des Abfoluten.
Die Wirkungen des Geiftes des Abfoluten führen mehr und mehr zur Con-
centrirung aller Gebiete und Elemente der Kunft nach einem einheitlichen Plan.
Durch die neu gegründeten königlichen franzöfifchen Akademien in Paris und in
Rom werden alle Quellen von Frankreich und Italien concentrirt, methodifch ftudirt
und geregelt nach einer Richtung geleitet. Sie gipfeln endlich unter Lebrun und
Ludwig XIV. in einer Einheit zufammen, wie fie die Gefchichte vielleicht weder
vorher, noch feitdem gefehen hat und deren Wirkungen mit gröbster Aufmerkfam-
keit verfolgt zu werden verdienen. Spanifcher Defpotismus, der Geift der Gegen-
reformation, der Päpfte und der Jefuiten, jede diefer Quellen des Abfoluten hat einen
gewißen Antheil an diefer hoch intereßanten Erfcheinung und fpiegelt fich theil-
weife und wenn auch in verfchiedenem Grade in der Kunft Ludwig XIV. wieder.
Von dem Schickfal des Geiftes der Verföhnung Heinrich IV. und feiner Fufions-
politik wird fpäter an geeigneter Stelle die Rede fein.