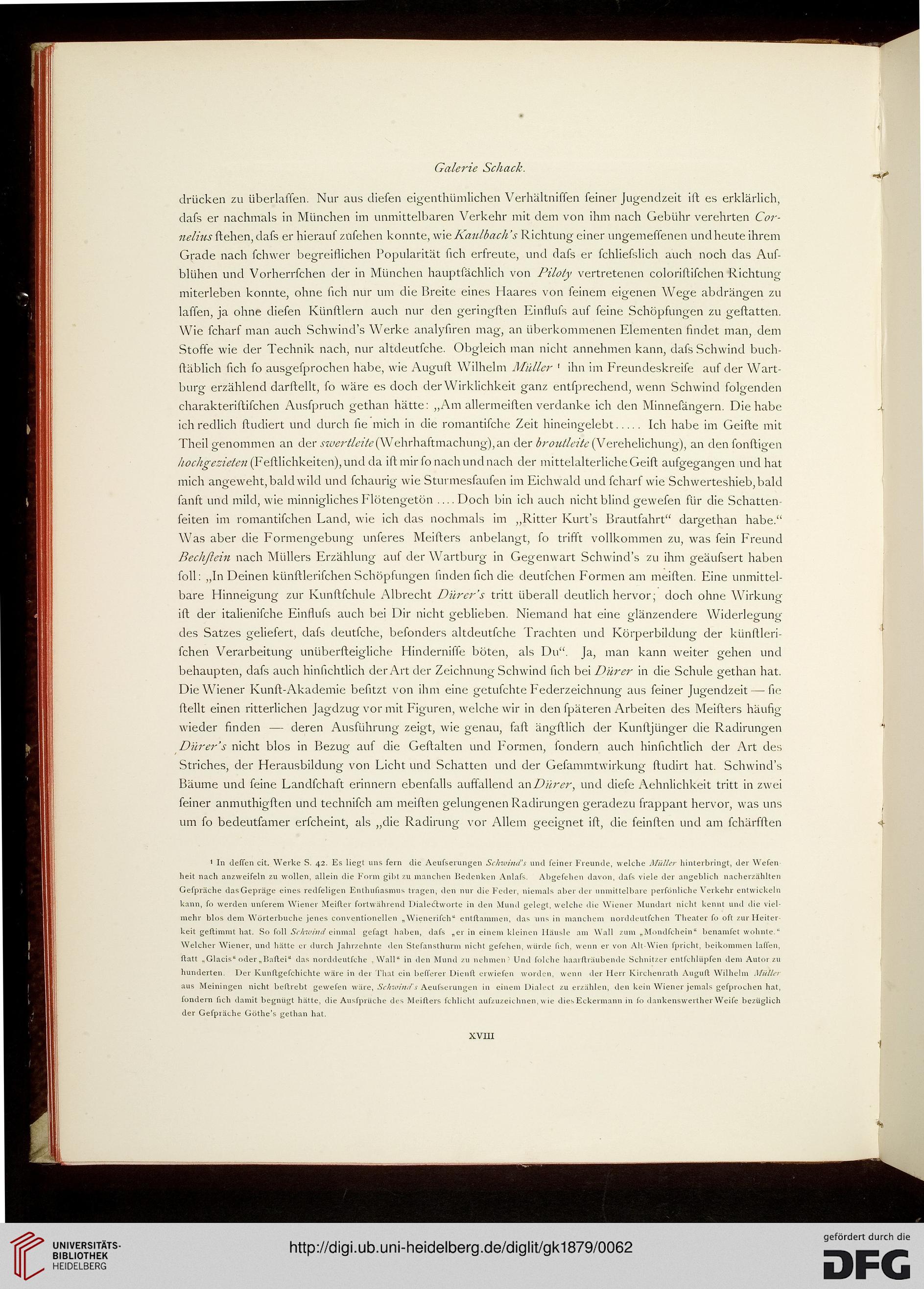Galerie Schack.
drücken zu überlassen. Nur aus diesen eigenthümlichen Verhältnissen seiner Jugendzeit ist es erklärlich,
dass er nachmals in München im unmittelbaren Verkehr mit dem von ihm nach Gebühr verehrten Cor-
nelius stehen, dass er hierauf znsehen konnte, wie Kam'back 's Richtung einer ungemessenen und heute ihrem
Grade nach schwer begreissichen Popularität sseh erfreute, und dass er schliesslich auch noch das Auf-
blühen und Vorherrschen der in München hauptsächlich von Piloty vertretenen coloristischen Richtung
miterleben konnte, ohne sich nur um die Breite eines Haares von seinem eigenen Wege abdrängen zu
lassen, ja ohne diesen Künstlern auch nur den geringsten Einssuss auf seine Schöpfungen zu gestatten.
Wie scharf man auch Schwind's Werke analysiren mag, an überkommenen Elementen findet man, dem
Stoffe wie der Technik nach, nur altdeutsche. Obgleich man nicht annehmen kann, dass Schwind buch-
stäblich sich so ausgesprochen habe, wie August Wilhelm Müller ' ihn im Freundeskreise auf der Wart-
burg erzählend darsteilt, so wäre es doch der Wirklichkeit ganz entsprechend, wenn Schwind folgenden
charakteristischen Ausspruch gethan hätte: „Am allermeisten verdanke ich den Minnesängern. Die habe
ich redlich studiert und durch sie mich in die romantische Zeit hineingelebt..... Ich habe im Geiste mit
Theil genommen an der ,fK^r&z'A?(Wehrhaftmachung), an der broutleite (Verehelichung), an densonstigen
Iwchgezieten (Festlichkeiten), und da ist mir so nach und nach der mittelalterliche Geist aufgegangen und hat
mich angeweht, bald wild und schaurig wie Sturmessausen im Eichwald und scharf wie Schwerteshieb, bald
sanft und mild, wie minnigliches Flötengetön .... Doch bin ich auch nicht blind gewesen für die Schatten-
seiten im romantischen Land, wie ich das nochmals im „Ritter Kurt's Brautfahrt" dargethan habe."
Was aber die Formengebung unseres Meisters anbelangt, so trisft vollkommen zu, was sein Freund
Bechßein nach Müllers Erzählung auf der Wartburg in Gegenwart Schwind's zu ihm geäussert haben
soll: „In Deinen künstlerischen Schöpfungen sinden sich die deutschen Formen am meisten. Eine unmittel-
bare Hinneigung zur Kunstschule Albrecht Dürer's tritt überall deutlich hervor; doch ohne Wirkung
ist der italienische Einssuss auch bei Dir nicht geblieben. Niemand hat eine glänzendere Widerlegung
des Satzes geliefert, dass deutsche, besonders altdeutsche Trachten und Körperbildung der künstleri-
schen Verarbeitung unübersteigliche Hindernisse böten, als Du". Ja, man kann weiter gehen und
behaupten, dass auch hinsichtlich der Art der Zeichnung Schwind sich bei Dürer in die Schule gethan hat.
Die Wiener Kunst-Akademie besitzt von ihm eine getuschte Federzeichnung aus seiner Jugendzeit — sie
stellt einen ritterlichen Jagclzug vor mit Figuren, welche wir in den späteren Arbeiten des Meisters häufig
wieder finden — deren Ausführung zeigt, wie genau, fast ängstlich der Kunstjünger die Radirungen
Dürers nicht blos in Bezug auf die Gestalten und Formen, sondern auch hinsichtlich der Art des
Striches, der Herausbildung von Licht und Schatten und der Gesammtwirkung studirt hat. Schwind's
Bäume und seine Landschaft erinnern ebenfalls auffallend an Dürer, und diese Aehnlichkeit tritt in zwei
seiner anmuthigsten und technisch am meisten gelungenen Radirungen geradezu frappant hervor, was uns
um so bedeutsamer erscheint, als „die Radiruna- vor Allem geeignet ist, die feinsten und am schärfften
■^
"i In dessen cit. Werke S. 42. Es liegt uns fern die Aeusserungen Schwind's und seiner Freunde, welche Müller hinterbringt, der Wesen-
heit nach anzweifeln zu wollen, allein die Form gibt zu manchen Bedenken Anlass. Abgesehen davon, dass viele der angeblich nacherzählten
Gesprache das Gepräge eines redseligen Enthusiasmus tragen, den nur die Feder, niemals aber der unmittelbare persönliche Verkehr entwickeln
kann, so werden nnserem Wiener Meister fortwahrend Dialectworte in den Mund gelegt, welche die Wiener Mundart nicht kennt und die viel-
mehr blos dem Wörterbuche jenes conventionellen „Wienerisch" entslammen, das uns in manchem norddeutschen Theater so oft zur Heiter
keit gestimmt hat. So soll Schwind einmal gesagt haben, dass „er in einem kleinen Häusle am Wall zum „Mondschein" benamset wohnte."
Welcher Wiener, und hätte er durch Jahrzehnte den Stesansthurm nicht gesehen, würde (ich, wenn er von Alt-Wien spricht, beikommen lassen,
Matt „Glacis" oder „Bastei" das norddeutsche ..Wall" in den Mund zu nehmen- Und solche haarsträubende Schnitzer entschlüpsen dem Autor zu
hunderten. Der Kunstgeschichte wäre in der That ein besserer Dienst enviesen worden, wenn der Herr Kirchenrath August Wilhelm Mülle)
aus Meiningen nicht bestrebt gewesen wäre, Schwind's Aeusserungen in einem Dialect zu erzählen, den kein Wiener jemals gesprochen hat,
sondern sich damit begnügt hatte, die Aussprüche des Meisters schlieht auszuzeichnen, wie dies Eckermann in so dankenswerther Weise bezüglich
der Gesprache Göthe's gethan hat.
XVIII
drücken zu überlassen. Nur aus diesen eigenthümlichen Verhältnissen seiner Jugendzeit ist es erklärlich,
dass er nachmals in München im unmittelbaren Verkehr mit dem von ihm nach Gebühr verehrten Cor-
nelius stehen, dass er hierauf znsehen konnte, wie Kam'back 's Richtung einer ungemessenen und heute ihrem
Grade nach schwer begreissichen Popularität sseh erfreute, und dass er schliesslich auch noch das Auf-
blühen und Vorherrschen der in München hauptsächlich von Piloty vertretenen coloristischen Richtung
miterleben konnte, ohne sich nur um die Breite eines Haares von seinem eigenen Wege abdrängen zu
lassen, ja ohne diesen Künstlern auch nur den geringsten Einssuss auf seine Schöpfungen zu gestatten.
Wie scharf man auch Schwind's Werke analysiren mag, an überkommenen Elementen findet man, dem
Stoffe wie der Technik nach, nur altdeutsche. Obgleich man nicht annehmen kann, dass Schwind buch-
stäblich sich so ausgesprochen habe, wie August Wilhelm Müller ' ihn im Freundeskreise auf der Wart-
burg erzählend darsteilt, so wäre es doch der Wirklichkeit ganz entsprechend, wenn Schwind folgenden
charakteristischen Ausspruch gethan hätte: „Am allermeisten verdanke ich den Minnesängern. Die habe
ich redlich studiert und durch sie mich in die romantische Zeit hineingelebt..... Ich habe im Geiste mit
Theil genommen an der ,fK^r&z'A?(Wehrhaftmachung), an der broutleite (Verehelichung), an densonstigen
Iwchgezieten (Festlichkeiten), und da ist mir so nach und nach der mittelalterliche Geist aufgegangen und hat
mich angeweht, bald wild und schaurig wie Sturmessausen im Eichwald und scharf wie Schwerteshieb, bald
sanft und mild, wie minnigliches Flötengetön .... Doch bin ich auch nicht blind gewesen für die Schatten-
seiten im romantischen Land, wie ich das nochmals im „Ritter Kurt's Brautfahrt" dargethan habe."
Was aber die Formengebung unseres Meisters anbelangt, so trisft vollkommen zu, was sein Freund
Bechßein nach Müllers Erzählung auf der Wartburg in Gegenwart Schwind's zu ihm geäussert haben
soll: „In Deinen künstlerischen Schöpfungen sinden sich die deutschen Formen am meisten. Eine unmittel-
bare Hinneigung zur Kunstschule Albrecht Dürer's tritt überall deutlich hervor; doch ohne Wirkung
ist der italienische Einssuss auch bei Dir nicht geblieben. Niemand hat eine glänzendere Widerlegung
des Satzes geliefert, dass deutsche, besonders altdeutsche Trachten und Körperbildung der künstleri-
schen Verarbeitung unübersteigliche Hindernisse böten, als Du". Ja, man kann weiter gehen und
behaupten, dass auch hinsichtlich der Art der Zeichnung Schwind sich bei Dürer in die Schule gethan hat.
Die Wiener Kunst-Akademie besitzt von ihm eine getuschte Federzeichnung aus seiner Jugendzeit — sie
stellt einen ritterlichen Jagclzug vor mit Figuren, welche wir in den späteren Arbeiten des Meisters häufig
wieder finden — deren Ausführung zeigt, wie genau, fast ängstlich der Kunstjünger die Radirungen
Dürers nicht blos in Bezug auf die Gestalten und Formen, sondern auch hinsichtlich der Art des
Striches, der Herausbildung von Licht und Schatten und der Gesammtwirkung studirt hat. Schwind's
Bäume und seine Landschaft erinnern ebenfalls auffallend an Dürer, und diese Aehnlichkeit tritt in zwei
seiner anmuthigsten und technisch am meisten gelungenen Radirungen geradezu frappant hervor, was uns
um so bedeutsamer erscheint, als „die Radiruna- vor Allem geeignet ist, die feinsten und am schärfften
■^
"i In dessen cit. Werke S. 42. Es liegt uns fern die Aeusserungen Schwind's und seiner Freunde, welche Müller hinterbringt, der Wesen-
heit nach anzweifeln zu wollen, allein die Form gibt zu manchen Bedenken Anlass. Abgesehen davon, dass viele der angeblich nacherzählten
Gesprache das Gepräge eines redseligen Enthusiasmus tragen, den nur die Feder, niemals aber der unmittelbare persönliche Verkehr entwickeln
kann, so werden nnserem Wiener Meister fortwahrend Dialectworte in den Mund gelegt, welche die Wiener Mundart nicht kennt und die viel-
mehr blos dem Wörterbuche jenes conventionellen „Wienerisch" entslammen, das uns in manchem norddeutschen Theater so oft zur Heiter
keit gestimmt hat. So soll Schwind einmal gesagt haben, dass „er in einem kleinen Häusle am Wall zum „Mondschein" benamset wohnte."
Welcher Wiener, und hätte er durch Jahrzehnte den Stesansthurm nicht gesehen, würde (ich, wenn er von Alt-Wien spricht, beikommen lassen,
Matt „Glacis" oder „Bastei" das norddeutsche ..Wall" in den Mund zu nehmen- Und solche haarsträubende Schnitzer entschlüpsen dem Autor zu
hunderten. Der Kunstgeschichte wäre in der That ein besserer Dienst enviesen worden, wenn der Herr Kirchenrath August Wilhelm Mülle)
aus Meiningen nicht bestrebt gewesen wäre, Schwind's Aeusserungen in einem Dialect zu erzählen, den kein Wiener jemals gesprochen hat,
sondern sich damit begnügt hatte, die Aussprüche des Meisters schlieht auszuzeichnen, wie dies Eckermann in so dankenswerther Weise bezüglich
der Gesprache Göthe's gethan hat.
XVIII