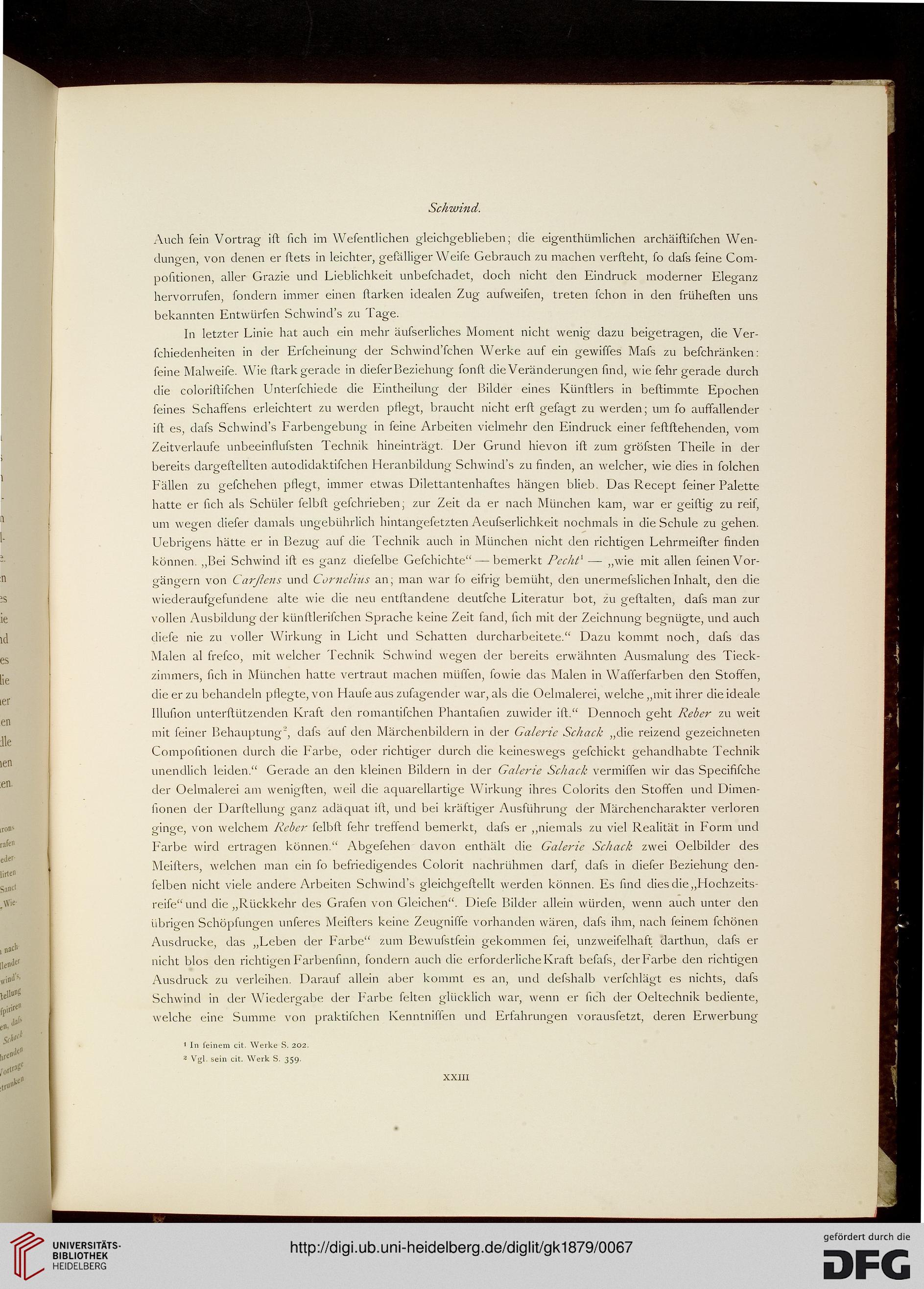Schwind.
Auch sein Vortrag ist (ich im Wesentlichen gleichgeblieben; die eigenthümlichen archäistischen Wen-
dungen, von denen er stets in leichter, gefälliger Weise Gebrauch zu machen versteht, so dass seine Com-
positionen, aller Grazie und Lieblichkeit unbeschadet, doch nicht den Eindruck moderner Eleganz
hervorrufen, sondern immer einen starken idealen Zug aufweisen, treten schon in den frühesten uns
bekannten Entwürfen Schwind's zu Tage.
In letzter Linie hat auch ein mehr äusserliches Moment nicht wenig dazu beigetragen, die Ver-
schiedenheiten in der Erscheinung der Schwind'schen Werke auf ein gewisfes Mass zu beschränken:
seine Malweise. Wie Mark gerade in dieser Beziehung sonst die Veränderungen sind, wie sehr gerade durch
die coloristischen Unterschiede die Eintheilung der Bilder eines Künstlers in bestimmte Epochen
seines Schasfens erleichtert zu werden pssegt, braucht nicht erst gesagt zu werden; um so auffallender
ist es, dass Schwind's Farbengebung in seine Arbeiten vielmehr den Eindruck einer feststehenden, vom
Zeitverlaufe unbeeinssussten Technik hineinträgt. Der Grund hievon ist zum grössten Theile in der
bereits dargestellten autodidaktischen Heranbildung Schwind's zu finden, an welcher, wie dies in solchen
Fällen zu geschehen pssegt, immer etwas Dilettantenhaftes hängen blieb. Das Recept seiner Palette
hatte er sich als Schüler selbst geschrieben; zur Zeit da er nach München kam, war er geistig zu reif,
um wegen dieser damals ungebührlich hintangesetzten Aeusserlichkeit nochmals in die Schule zu gehen.
Uebrigens hätte er in Bezug auf die Technik auch in München nicht den richtigen Lehrmeister finden
können. „Bei Schwind ist es ganz dieselbe Geschichte" — bemerkt Peckt1 — „wie mit allen seinen Vor-
gängern von Carßens und Cornclhis an; man war so eifrig bemüht, den unermesslichen Inhalt, den die
wiederaufgefundene alte wie die neu entstandene deutsche Literatur bot, zu gestalten, dass man zur
vollen Ausbildung der künstlerischen Sprache keine Zeit fand, sich mit der Zeichnung begnügte, und auch
diese nie zu voller Wirkung in Licht und Schatten durcharbeitete." Dazu kommt noch, dass das
Malen al fresco, mit welcher Technik Schwind wegen der bereits erwähnten Ausmalung des Tieck-
zimmers, sich in München hatte vertraut machen musfen, sowie das Malen in Wasserfarben den Stosfen,
die er zu behandeln pssegte, von Hause aus zusagender war, als die Oelmalerei, welche „mit ihrer die ideale
Illusion unterstützenden Kraft den romantischen Phantasien zuwider ist." Dennoch geht Reber zu weit
mit seiner Behauptung2, dass auf den Märchenbildern in der Galeric Schuck „die reizend gezeichneten
Compositionen durch die Farbe, oder richtiger durch die keineswegs geschickt gehandhabte Technik
unendlich leiden." Gerade an den kleinen Bildern in der Galerie Schach vermissen wir das Specifische
der Oelmalerei am wenigsten, weil die aquarellartige Wirkung ihres Colorits den Stosfen und Dimen-
sionen der Darstellung ganz adäquat ist, und bei kräftiger Ausführung der Märchencharakter verloren
ginge, von welchem Reber selbst sehr tresfend bemerkt, dass er „niemals zu viel Realität in Form und
Farbe wird ertragen können." Abgesehen davon enthält die Galeric Schach zwei Oelbilder des
Meisters, welchen man ein so befriedigendes Colorit nachrühmen darf, dass in dieser Beziehung den-
selben nicht viele andere Arbeiten Schwind's gleichgestellt werden können. Es sind dies die „Hochzeits-
reise" und die „Rückkehr des Grafen von Gleichen". Diese Bilder allein würden, wenn auch unter den
übrigen Schöpsungen unseres Meisters keine Zeugnisse vorhanden wären, dass ihm, nach seinem schönen
Ausdrucke, das „Leben der Farbe" zum Bewusstsein gekommen sei, unzweifelhaft darthun, dass er
nicht blos den richtigen Farbensinn, sondern auch die erforderliche Kraft besass, der Farbe den richtigen
Ausdruck zu verleihen. Darauf allein aber kommt es an, und desshalb verschlägt es nichts, dass
Schwind in der Wiedergabe der Farbe seiten glücklich war, wenn er sich der Oeltechnik bediente,
welche eine Summe von praktischen Kenntnisien und Erfahrungen voraussetzt, deren Erwerbung
1 In seinem cit. Werke S. 202.
ä Vgl. sein cit. Werk S, 359.
XXIII
Auch sein Vortrag ist (ich im Wesentlichen gleichgeblieben; die eigenthümlichen archäistischen Wen-
dungen, von denen er stets in leichter, gefälliger Weise Gebrauch zu machen versteht, so dass seine Com-
positionen, aller Grazie und Lieblichkeit unbeschadet, doch nicht den Eindruck moderner Eleganz
hervorrufen, sondern immer einen starken idealen Zug aufweisen, treten schon in den frühesten uns
bekannten Entwürfen Schwind's zu Tage.
In letzter Linie hat auch ein mehr äusserliches Moment nicht wenig dazu beigetragen, die Ver-
schiedenheiten in der Erscheinung der Schwind'schen Werke auf ein gewisfes Mass zu beschränken:
seine Malweise. Wie Mark gerade in dieser Beziehung sonst die Veränderungen sind, wie sehr gerade durch
die coloristischen Unterschiede die Eintheilung der Bilder eines Künstlers in bestimmte Epochen
seines Schasfens erleichtert zu werden pssegt, braucht nicht erst gesagt zu werden; um so auffallender
ist es, dass Schwind's Farbengebung in seine Arbeiten vielmehr den Eindruck einer feststehenden, vom
Zeitverlaufe unbeeinssussten Technik hineinträgt. Der Grund hievon ist zum grössten Theile in der
bereits dargestellten autodidaktischen Heranbildung Schwind's zu finden, an welcher, wie dies in solchen
Fällen zu geschehen pssegt, immer etwas Dilettantenhaftes hängen blieb. Das Recept seiner Palette
hatte er sich als Schüler selbst geschrieben; zur Zeit da er nach München kam, war er geistig zu reif,
um wegen dieser damals ungebührlich hintangesetzten Aeusserlichkeit nochmals in die Schule zu gehen.
Uebrigens hätte er in Bezug auf die Technik auch in München nicht den richtigen Lehrmeister finden
können. „Bei Schwind ist es ganz dieselbe Geschichte" — bemerkt Peckt1 — „wie mit allen seinen Vor-
gängern von Carßens und Cornclhis an; man war so eifrig bemüht, den unermesslichen Inhalt, den die
wiederaufgefundene alte wie die neu entstandene deutsche Literatur bot, zu gestalten, dass man zur
vollen Ausbildung der künstlerischen Sprache keine Zeit fand, sich mit der Zeichnung begnügte, und auch
diese nie zu voller Wirkung in Licht und Schatten durcharbeitete." Dazu kommt noch, dass das
Malen al fresco, mit welcher Technik Schwind wegen der bereits erwähnten Ausmalung des Tieck-
zimmers, sich in München hatte vertraut machen musfen, sowie das Malen in Wasserfarben den Stosfen,
die er zu behandeln pssegte, von Hause aus zusagender war, als die Oelmalerei, welche „mit ihrer die ideale
Illusion unterstützenden Kraft den romantischen Phantasien zuwider ist." Dennoch geht Reber zu weit
mit seiner Behauptung2, dass auf den Märchenbildern in der Galeric Schuck „die reizend gezeichneten
Compositionen durch die Farbe, oder richtiger durch die keineswegs geschickt gehandhabte Technik
unendlich leiden." Gerade an den kleinen Bildern in der Galerie Schach vermissen wir das Specifische
der Oelmalerei am wenigsten, weil die aquarellartige Wirkung ihres Colorits den Stosfen und Dimen-
sionen der Darstellung ganz adäquat ist, und bei kräftiger Ausführung der Märchencharakter verloren
ginge, von welchem Reber selbst sehr tresfend bemerkt, dass er „niemals zu viel Realität in Form und
Farbe wird ertragen können." Abgesehen davon enthält die Galeric Schach zwei Oelbilder des
Meisters, welchen man ein so befriedigendes Colorit nachrühmen darf, dass in dieser Beziehung den-
selben nicht viele andere Arbeiten Schwind's gleichgestellt werden können. Es sind dies die „Hochzeits-
reise" und die „Rückkehr des Grafen von Gleichen". Diese Bilder allein würden, wenn auch unter den
übrigen Schöpsungen unseres Meisters keine Zeugnisse vorhanden wären, dass ihm, nach seinem schönen
Ausdrucke, das „Leben der Farbe" zum Bewusstsein gekommen sei, unzweifelhaft darthun, dass er
nicht blos den richtigen Farbensinn, sondern auch die erforderliche Kraft besass, der Farbe den richtigen
Ausdruck zu verleihen. Darauf allein aber kommt es an, und desshalb verschlägt es nichts, dass
Schwind in der Wiedergabe der Farbe seiten glücklich war, wenn er sich der Oeltechnik bediente,
welche eine Summe von praktischen Kenntnisien und Erfahrungen voraussetzt, deren Erwerbung
1 In seinem cit. Werke S. 202.
ä Vgl. sein cit. Werk S, 359.
XXIII