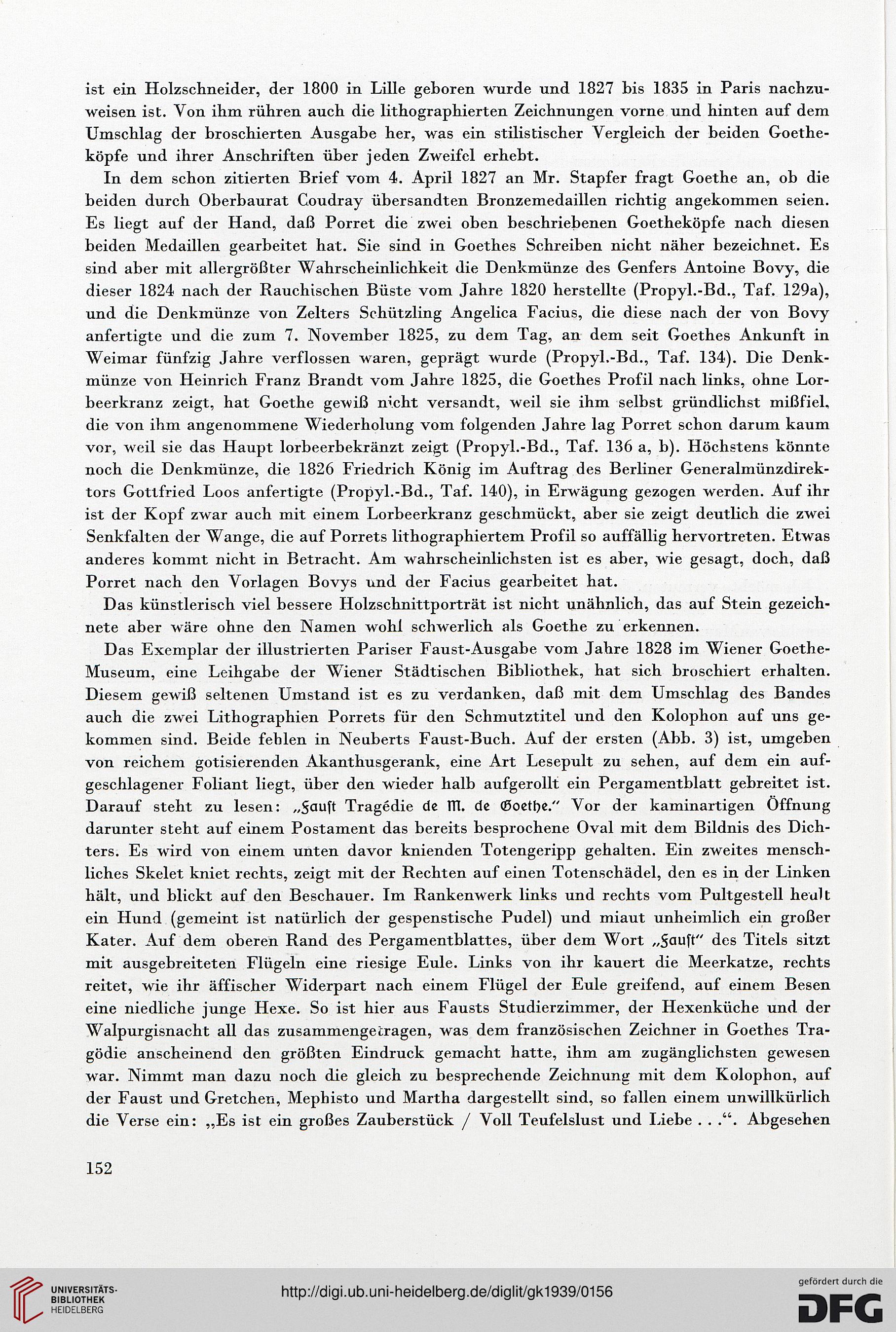ist ein Holzschneider, der 1800 in Lille geboren wurde und 1827 bis 1835 in Paris nachzu-
weisen ist. Von ihm rühren auch die lithographierten Zeichnungen vorne und hinten auf dem
Umschlag der broschierten Ausgabe her, was ein stilistischer Vergleich der beiden Goethe-
köpfe und ihrer Anschriften über jeden Zweifel erhebt.
In dem schon zitierten Brief vom 4. April 1827 an Mr. Stapfer fragt Goethe an, ob die
beiden durch Oberbaurat Coudray übersandten Bronzemedaillen richtig angekommen seien.
Es liegt auf der Hand, daß Porret die zwei oben beschriebenen Goetheköpfe nach diesen
beiden Medaillen gearbeitet hat. Sie sind in Goethes Schreiben nicht näher bezeichnet. Es
sind aber mit allergrößter Wahrscheinlichkeit die Denkmünze des Genfers Antoine Bovy, die
dieser 1824 nach der Rauchischen Büste vom Jahre 1820 herstellte (Propyl.-Bd., Taf. 129a),
und die Denkmünze von Zelters Schützling Angelica Facius, die diese nach der von Bovy
anfertigte und die zum 7. November 1825, zu dem Tag, an dem seit Goethes Ankunft in
Weimar fünfzig Jahre verflossen waren, geprägt wurde (Propyl.-Bd., Taf. 134). Die Denk-
münze von Heinrich Franz Brandt vom Jahre 1825, die Goethes Profil nach links, ohne Lor-
beerkranz zeigt, hat Goethe gewiß nicht versandt, weil sie ihm selbst gründlichst mißfiel,
die von ihm angenommene Wiederholung vom folgenden Jahre lag Porret schon darum kaum
vor, weil sie das Haupt lorbeerbekränzt zeigt (Propyl.-Bd., Taf. 136 a, b). Höchstens könnte
noch die Denkmünze, die 1826 Friedrich König im Auftrag des Berliner Generalmünzdirek-
tors Gottfried Loos anfertigte (Propyl.-Bd., Taf. 140), in Erwägung gezogen werden. Auf ihr
ist der Kopf zwar auch mit einem Lorbeerkranz geschmückt, aber sie zeigt deutlich die zwei
Senkfalten der Wange, die auf Porrets lithographiertem Profil so auffällig hervortreten. Etwas
anderes kommt nicht in Betracht. Am wahrscheinlichsten ist es aber, wie gesagt, doch, daß
Porret nach den Vorlagen Bovys und der Facius gearbeitet hat.
Das künstlerisch viel bessere Holzschnittporträt ist nicht unähnlich, das auf Stein gezeich-
nete aber wäre ohne den Namen wohl schwerlich als Goethe zu erkennen.
Das Exemplar der illustrierten Pariser Faust-Ausgabe vom Jahre 1828 im Wiener Goethe-
Museum, eine Leihgabe der Wiener Städtischen Bibliothek, hat sich broschiert erhalten.
Diesem gewiß seltenen Umstand ist es zu verdanken, daß mit dem Umschlag des Bandes
auch die zwei Lithographien Porrets für den Schmutztitel und den Kolophon auf uns ge-
kommen sind. Beide fehlen in Neuberts Faust-Buch. Auf der ersten (Abb. 3) ist, umgeben
von reichem gotisierenden Akanthusgerank, eine Art Lesepult zu sehen, auf dem ein auf-
geschlagener Foliant liegt, über den wieder halb aufgerollt ein Pergamentblatt gebreitet ist.
Darauf steht zu lesen: „Sauft Tragedie de ITT. de <Boetl?e." Vor der kaminartigen Öffnung
darunter steht auf einem Postament das bereits besprochene Oval mit dem Bildnis des Dich-
ters. Es wird von einem unten davor knienden Totengeripp gehalten. Ein zweites mensch-
liches Skelet kniet rechts, zeigt mit der Rechten auf einen Totenschädel, den es in der Linken
hält, und blickt auf den Beschauer. Im Rankenwerk links und rechts vom Pultgestell heult
ein Hund (gemeint ist natürlich der gespenstische Pudel) und miaut unheimlich ein großer
Kater. Auf dem oberen Rand des Pergamentblattes, über dem Wort „Sauft" des Titels sitzt
mit ausgebreiteten Flügeln eine riesige Eule. Links von ihr kauert die Meerkatze, rechts
reitet, wie ihr äffischer Widerpart nach einem Flügel der Eule greifend, auf einem Besen
eine niedliche junge Hexe. So ist hier aus Fausts Studierzimmer, der Hexenküche und der
Walpurgisnacht all das zusammengetragen, was dem französischen Zeichner in Goethes Tra-
gödie anscheinend den größten Eindruck gemacht hatte, ihm am zugänglichsten gewesen
war. Nimmt man dazu noch die gleich zu besprechende Zeichnung mit dem Kolophon, auf
der Faust und Gretchen, Mephisto und Martha dargestellt sind, so fallen einem unwillkürlich
die Verse ein: ,,Es ist ein großes Zauberstück / Voll Teufelslust und Liebe . . .". Abgesehen
152
weisen ist. Von ihm rühren auch die lithographierten Zeichnungen vorne und hinten auf dem
Umschlag der broschierten Ausgabe her, was ein stilistischer Vergleich der beiden Goethe-
köpfe und ihrer Anschriften über jeden Zweifel erhebt.
In dem schon zitierten Brief vom 4. April 1827 an Mr. Stapfer fragt Goethe an, ob die
beiden durch Oberbaurat Coudray übersandten Bronzemedaillen richtig angekommen seien.
Es liegt auf der Hand, daß Porret die zwei oben beschriebenen Goetheköpfe nach diesen
beiden Medaillen gearbeitet hat. Sie sind in Goethes Schreiben nicht näher bezeichnet. Es
sind aber mit allergrößter Wahrscheinlichkeit die Denkmünze des Genfers Antoine Bovy, die
dieser 1824 nach der Rauchischen Büste vom Jahre 1820 herstellte (Propyl.-Bd., Taf. 129a),
und die Denkmünze von Zelters Schützling Angelica Facius, die diese nach der von Bovy
anfertigte und die zum 7. November 1825, zu dem Tag, an dem seit Goethes Ankunft in
Weimar fünfzig Jahre verflossen waren, geprägt wurde (Propyl.-Bd., Taf. 134). Die Denk-
münze von Heinrich Franz Brandt vom Jahre 1825, die Goethes Profil nach links, ohne Lor-
beerkranz zeigt, hat Goethe gewiß nicht versandt, weil sie ihm selbst gründlichst mißfiel,
die von ihm angenommene Wiederholung vom folgenden Jahre lag Porret schon darum kaum
vor, weil sie das Haupt lorbeerbekränzt zeigt (Propyl.-Bd., Taf. 136 a, b). Höchstens könnte
noch die Denkmünze, die 1826 Friedrich König im Auftrag des Berliner Generalmünzdirek-
tors Gottfried Loos anfertigte (Propyl.-Bd., Taf. 140), in Erwägung gezogen werden. Auf ihr
ist der Kopf zwar auch mit einem Lorbeerkranz geschmückt, aber sie zeigt deutlich die zwei
Senkfalten der Wange, die auf Porrets lithographiertem Profil so auffällig hervortreten. Etwas
anderes kommt nicht in Betracht. Am wahrscheinlichsten ist es aber, wie gesagt, doch, daß
Porret nach den Vorlagen Bovys und der Facius gearbeitet hat.
Das künstlerisch viel bessere Holzschnittporträt ist nicht unähnlich, das auf Stein gezeich-
nete aber wäre ohne den Namen wohl schwerlich als Goethe zu erkennen.
Das Exemplar der illustrierten Pariser Faust-Ausgabe vom Jahre 1828 im Wiener Goethe-
Museum, eine Leihgabe der Wiener Städtischen Bibliothek, hat sich broschiert erhalten.
Diesem gewiß seltenen Umstand ist es zu verdanken, daß mit dem Umschlag des Bandes
auch die zwei Lithographien Porrets für den Schmutztitel und den Kolophon auf uns ge-
kommen sind. Beide fehlen in Neuberts Faust-Buch. Auf der ersten (Abb. 3) ist, umgeben
von reichem gotisierenden Akanthusgerank, eine Art Lesepult zu sehen, auf dem ein auf-
geschlagener Foliant liegt, über den wieder halb aufgerollt ein Pergamentblatt gebreitet ist.
Darauf steht zu lesen: „Sauft Tragedie de ITT. de <Boetl?e." Vor der kaminartigen Öffnung
darunter steht auf einem Postament das bereits besprochene Oval mit dem Bildnis des Dich-
ters. Es wird von einem unten davor knienden Totengeripp gehalten. Ein zweites mensch-
liches Skelet kniet rechts, zeigt mit der Rechten auf einen Totenschädel, den es in der Linken
hält, und blickt auf den Beschauer. Im Rankenwerk links und rechts vom Pultgestell heult
ein Hund (gemeint ist natürlich der gespenstische Pudel) und miaut unheimlich ein großer
Kater. Auf dem oberen Rand des Pergamentblattes, über dem Wort „Sauft" des Titels sitzt
mit ausgebreiteten Flügeln eine riesige Eule. Links von ihr kauert die Meerkatze, rechts
reitet, wie ihr äffischer Widerpart nach einem Flügel der Eule greifend, auf einem Besen
eine niedliche junge Hexe. So ist hier aus Fausts Studierzimmer, der Hexenküche und der
Walpurgisnacht all das zusammengetragen, was dem französischen Zeichner in Goethes Tra-
gödie anscheinend den größten Eindruck gemacht hatte, ihm am zugänglichsten gewesen
war. Nimmt man dazu noch die gleich zu besprechende Zeichnung mit dem Kolophon, auf
der Faust und Gretchen, Mephisto und Martha dargestellt sind, so fallen einem unwillkürlich
die Verse ein: ,,Es ist ein großes Zauberstück / Voll Teufelslust und Liebe . . .". Abgesehen
152