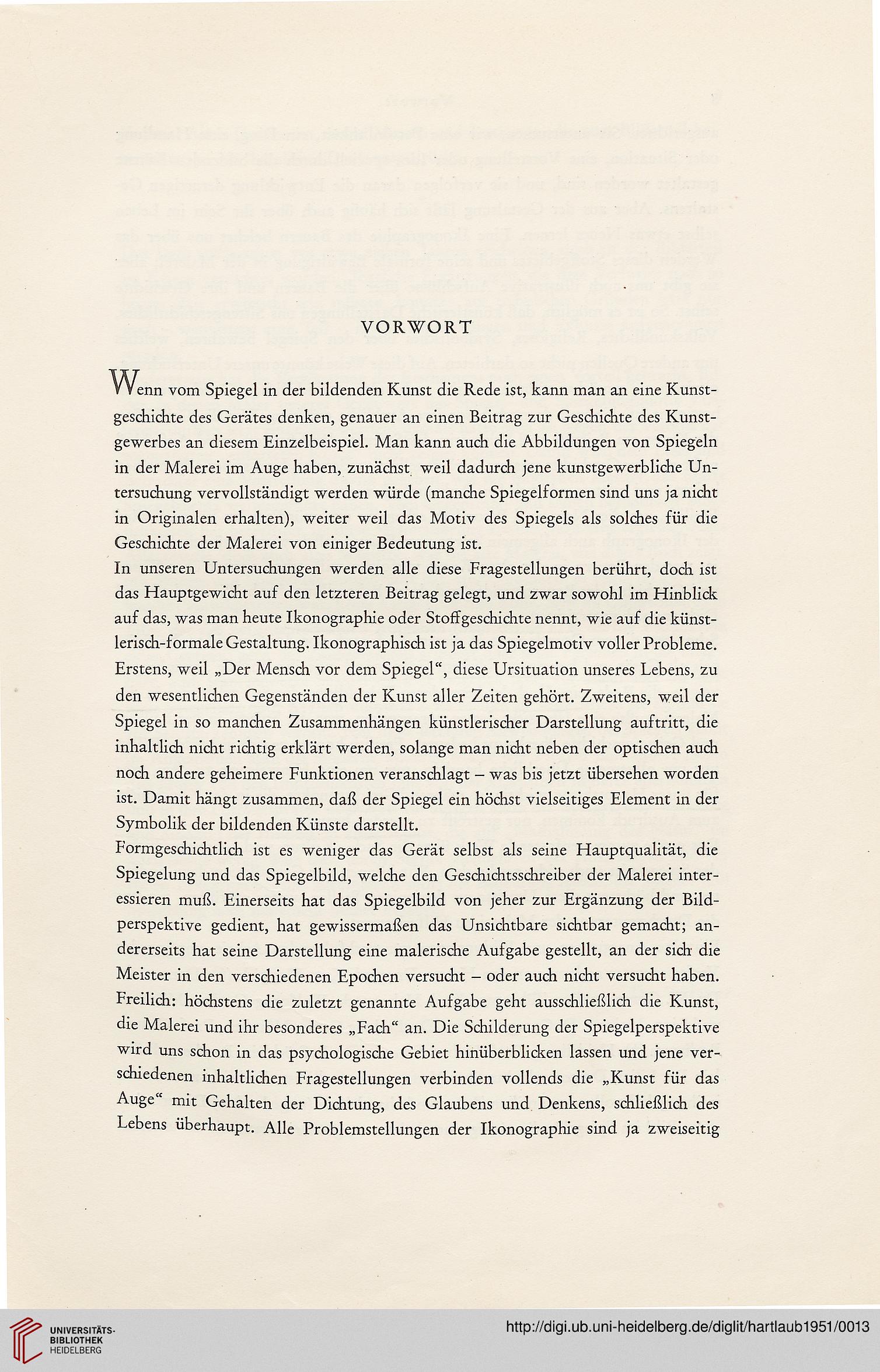VORWORT
Wenn vom Spiegel in der bildenden Kunst die Rede ist, kann man an eine Kunst-
geschichte des Gerätes denken, genauer an einen Beitrag zur Geschichte des Kunst-
gewerbes an diesem Einzelbeispiel. Man kann auch die Abbildungen von Spiegeln
in der Malerei im Auge haben, zunächst weil dadurch jene kunstgewerbliche Un-
tersuchung vervollständigt werden würde (manche Spiegelformen sind uns ja nicht
in Originalen erhalten), weiter weil das Motiv des Spiegels als solches für die
Geschichte der Malerei von einiger Bedeutung ist.
In unseren Untersuchungen werden alle diese Fragestellungen berührt, doch ist
das Hauptgewicht auf den letzteren Beitrag gelegt, und zwar sowohl im Hinblick
auf das, was man heute Ikonographie oder Stoff geschichte nennt, wie auf die künst-
lerisch-formale Gestaltung. Ikonographisch ist ja das Spiegelmotiv voller Probleme.
Erstens, weil „Der Mensch vor dem Spiegel", diese Ursituation unseres Lebens, zu
den wesentlichen Gegenständen der Kunst aller Zeiten gehört. Zweitens, weil der
Spiegel in so manchen Zusammenhängen künstlerischer Darstellung auftritt, die
inhaltlich nicht richtig erklärt werden, solange man nicht neben der optischen auch
noch andere geheimere Funktionen veranschlagt - was bis jetzt übersehen worden
ist. Damit hängt zusammen, daß der Spiegel ein höchst vielseitiges Element in der
Symbolik der bildenden Künste darstellt.
Formgeschichtlich ist es weniger das Gerät selbst als seine Hauptqualität, die
Spiegelung und das Spiegelbild, welche den Geschichtsschreiber der Malerei inter-
essieren muß. Einerseits hat das Spiegelbild von jeher zur Ergänzung der Bild-
perspektive gedient, hat gewissermaßen das Unsichtbare sichtbar gemacht; an-
dererseits hat seine Darstellung eine malerische Aufgabe gestellt, an der sich die
Meister in den verschiedenen Epochen versucht - oder auch nicht versucht haben.
Freilich: höchstens die zuletzt genannte Aufgabe geht ausschließlich die Kunst,
die Malerei und ihr besonderes „Fach" an. Die Schilderung der Spiegelperspektive
wird uns schon in das psychologische Gebiet hinüberblicken lassen und jene ver-
schiedenen inhaltlichen Fragestellungen verbinden vollends die „Kunst für das
Auge" rnit Gehalten der Dichtung, des Glaubens und Denkens, schließlich des
Lebens überhaupt. Alle Problemstellungen der Ikonographie sind ja zweiseitig
Wenn vom Spiegel in der bildenden Kunst die Rede ist, kann man an eine Kunst-
geschichte des Gerätes denken, genauer an einen Beitrag zur Geschichte des Kunst-
gewerbes an diesem Einzelbeispiel. Man kann auch die Abbildungen von Spiegeln
in der Malerei im Auge haben, zunächst weil dadurch jene kunstgewerbliche Un-
tersuchung vervollständigt werden würde (manche Spiegelformen sind uns ja nicht
in Originalen erhalten), weiter weil das Motiv des Spiegels als solches für die
Geschichte der Malerei von einiger Bedeutung ist.
In unseren Untersuchungen werden alle diese Fragestellungen berührt, doch ist
das Hauptgewicht auf den letzteren Beitrag gelegt, und zwar sowohl im Hinblick
auf das, was man heute Ikonographie oder Stoff geschichte nennt, wie auf die künst-
lerisch-formale Gestaltung. Ikonographisch ist ja das Spiegelmotiv voller Probleme.
Erstens, weil „Der Mensch vor dem Spiegel", diese Ursituation unseres Lebens, zu
den wesentlichen Gegenständen der Kunst aller Zeiten gehört. Zweitens, weil der
Spiegel in so manchen Zusammenhängen künstlerischer Darstellung auftritt, die
inhaltlich nicht richtig erklärt werden, solange man nicht neben der optischen auch
noch andere geheimere Funktionen veranschlagt - was bis jetzt übersehen worden
ist. Damit hängt zusammen, daß der Spiegel ein höchst vielseitiges Element in der
Symbolik der bildenden Künste darstellt.
Formgeschichtlich ist es weniger das Gerät selbst als seine Hauptqualität, die
Spiegelung und das Spiegelbild, welche den Geschichtsschreiber der Malerei inter-
essieren muß. Einerseits hat das Spiegelbild von jeher zur Ergänzung der Bild-
perspektive gedient, hat gewissermaßen das Unsichtbare sichtbar gemacht; an-
dererseits hat seine Darstellung eine malerische Aufgabe gestellt, an der sich die
Meister in den verschiedenen Epochen versucht - oder auch nicht versucht haben.
Freilich: höchstens die zuletzt genannte Aufgabe geht ausschließlich die Kunst,
die Malerei und ihr besonderes „Fach" an. Die Schilderung der Spiegelperspektive
wird uns schon in das psychologische Gebiet hinüberblicken lassen und jene ver-
schiedenen inhaltlichen Fragestellungen verbinden vollends die „Kunst für das
Auge" rnit Gehalten der Dichtung, des Glaubens und Denkens, schließlich des
Lebens überhaupt. Alle Problemstellungen der Ikonographie sind ja zweiseitig