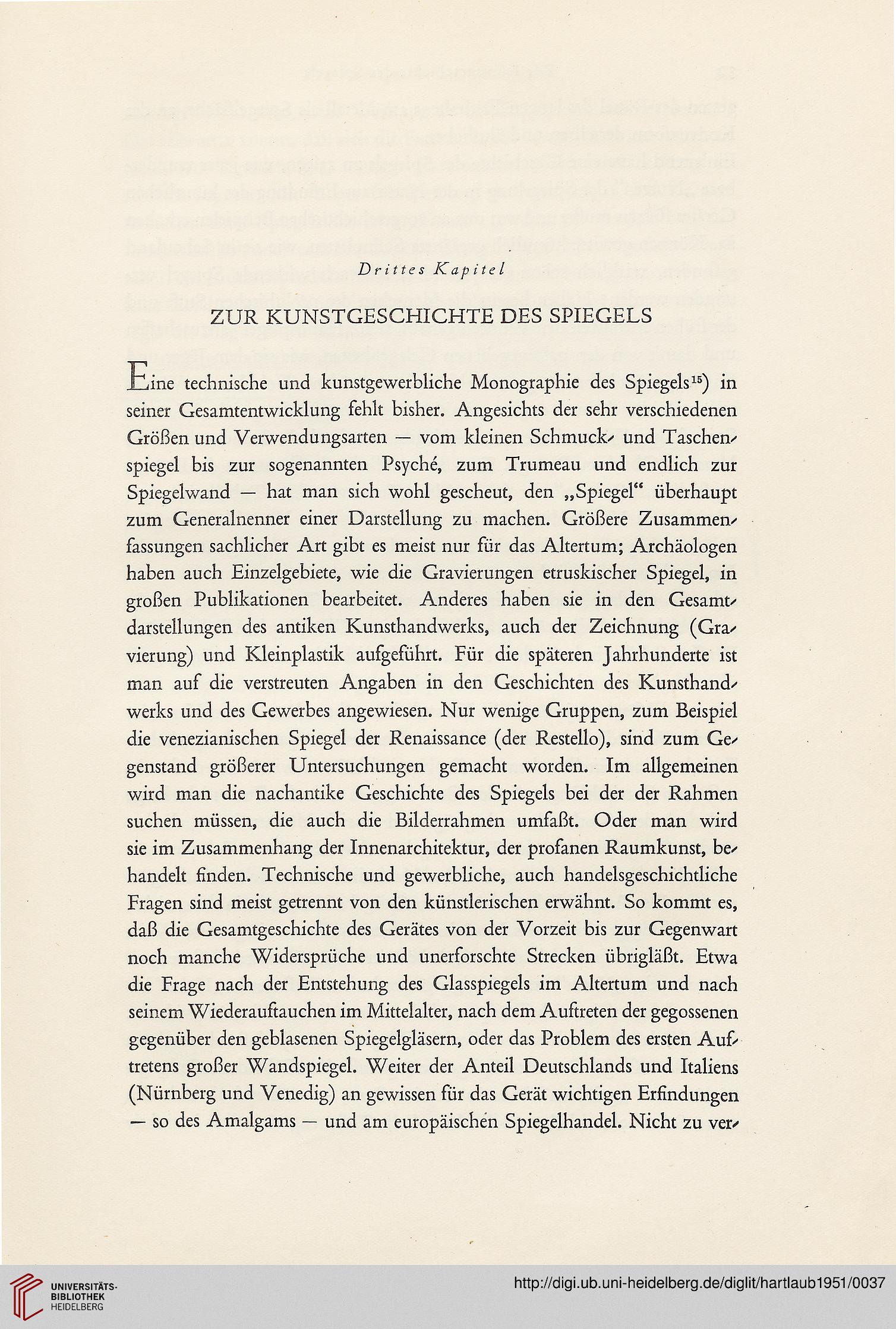Drittes Ka p ite l
ZUR KUNSTGESCHICHTE DES SPIEGELS
Eine technische und kunstgewerbliche Monographie des Spiegels15) in
seiner Gesamtentwicklung fehlt bisher. Angesichts der sehr verschiedenen
Größen und Verwendungsarten — vom kleinen Schmuck' und Taschen'
Spiegel bis zur sogenannten Psyche, zum Trumeau und endlich zur
Spiegelwand — hat man sich wohl gescheut, den „Spiegel" überhaupt
zum Generalnenner einer Darstellung zu machen. Größere Zusammen/
fassungen sachlicher Art gibt es meist nur für das Altertum; Archäologen
haben auch Einzelgebiete, wie die Gravierungen etruskischer Spiegel, in
großen Publikationen bearbeitet. Anderes haben sie in den Gesamt'
darstellungen des antiken Kunsthandwerks, auch der Zeichnung (Gra'
vierung) und Kleinplastik aufgeführt. Für die späteren Jahrhunderte ist
man auf die verstreuten Angaben in den Geschichten des Kunsthand'
werks und des Gewerbes angewiesen. Nur wenige Gruppen, zum Beispiel
die venezianischen Spiegel der Renaissance (der Restello), sind zum Gc
genstand größerer Untersuchungen gemacht worden. Im allgemeinen
wird man die nachantike Geschichte des Spiegels bei der der Rahmen
suchen müssen, die auch die Bilderrahmen umfaßt. Oder man wird
sie im Zusammenhang der Innenarchitektur, der profanen Raumkunst, bc
handelt finden. Technische und gewerbliche, auch handelsgeschichtliche
Fragen sind meist getrennt von den künstlerischen erwähnt. So kommt es,
daß die Gesamtgeschichte des Gerätes von der Vorzeit bis zur Gegenwart
noch manche Widersprüche und unerforschte Strecken übrigläßt. Etwa
die Frage nach der Entstehung des Glasspiegels im Altertum und nach
seinem Wiederauftauchen im Mittelalter, nach dem Auftreten der gegossenen
gegenüber den geblasenen Spiegelgläsern, oder das Problem des ersten Auf-
tretens großer Wandspiegel. Weiter der Anteil Deutschlands und Italiens
(Nürnberg und Venedig) an gewissen für das Gerät wichtigen Erfindungen
— so des Amalgams — und am europäischen Spiegelhandel. Nicht zu ver'
ZUR KUNSTGESCHICHTE DES SPIEGELS
Eine technische und kunstgewerbliche Monographie des Spiegels15) in
seiner Gesamtentwicklung fehlt bisher. Angesichts der sehr verschiedenen
Größen und Verwendungsarten — vom kleinen Schmuck' und Taschen'
Spiegel bis zur sogenannten Psyche, zum Trumeau und endlich zur
Spiegelwand — hat man sich wohl gescheut, den „Spiegel" überhaupt
zum Generalnenner einer Darstellung zu machen. Größere Zusammen/
fassungen sachlicher Art gibt es meist nur für das Altertum; Archäologen
haben auch Einzelgebiete, wie die Gravierungen etruskischer Spiegel, in
großen Publikationen bearbeitet. Anderes haben sie in den Gesamt'
darstellungen des antiken Kunsthandwerks, auch der Zeichnung (Gra'
vierung) und Kleinplastik aufgeführt. Für die späteren Jahrhunderte ist
man auf die verstreuten Angaben in den Geschichten des Kunsthand'
werks und des Gewerbes angewiesen. Nur wenige Gruppen, zum Beispiel
die venezianischen Spiegel der Renaissance (der Restello), sind zum Gc
genstand größerer Untersuchungen gemacht worden. Im allgemeinen
wird man die nachantike Geschichte des Spiegels bei der der Rahmen
suchen müssen, die auch die Bilderrahmen umfaßt. Oder man wird
sie im Zusammenhang der Innenarchitektur, der profanen Raumkunst, bc
handelt finden. Technische und gewerbliche, auch handelsgeschichtliche
Fragen sind meist getrennt von den künstlerischen erwähnt. So kommt es,
daß die Gesamtgeschichte des Gerätes von der Vorzeit bis zur Gegenwart
noch manche Widersprüche und unerforschte Strecken übrigläßt. Etwa
die Frage nach der Entstehung des Glasspiegels im Altertum und nach
seinem Wiederauftauchen im Mittelalter, nach dem Auftreten der gegossenen
gegenüber den geblasenen Spiegelgläsern, oder das Problem des ersten Auf-
tretens großer Wandspiegel. Weiter der Anteil Deutschlands und Italiens
(Nürnberg und Venedig) an gewissen für das Gerät wichtigen Erfindungen
— so des Amalgams — und am europäischen Spiegelhandel. Nicht zu ver'