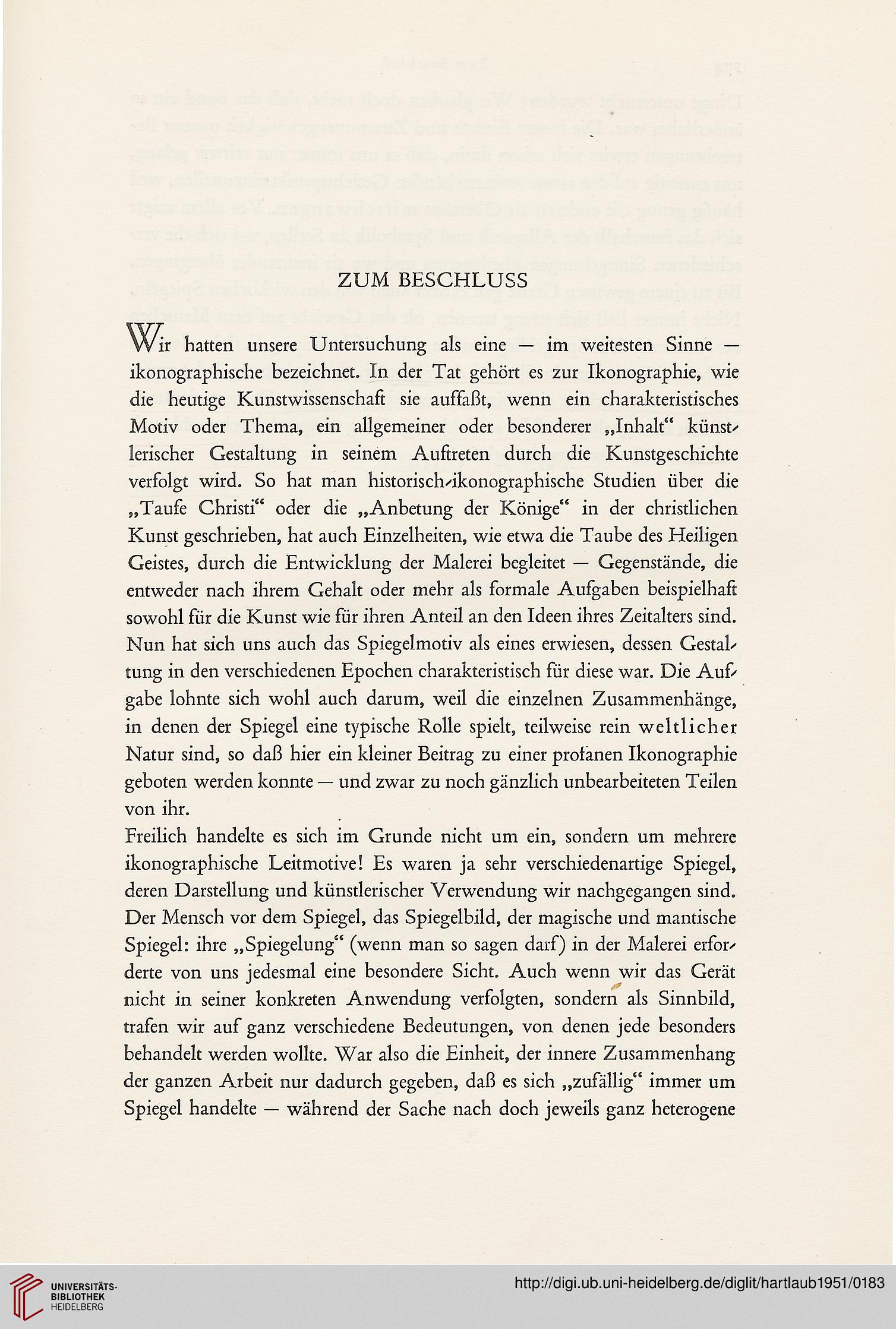ZUM BESCHLUSS
Wir hatten unsere Untersuchung als eine — im weitesten Sinne —
ikonographische bezeichnet. In der Tat gehört es zur Ikonographie, wie
die heutige Kunstwissenschaft sie auffaßt, wenn ein charakteristisches
Motiv oder Thema, ein allgemeiner oder besonderer „Inhalt" künst'
lerischer Gestaltung in seinem Auftreten durch die Kunstgeschichte
verfolgt wird. So hat man historisclvikonographische Studien über die
„Taufe Christi" oder die „Anbetung der Könige" in der christlichen
Kunst geschrieben, hat auch Einzelheiten, wie etwa die Taube des Heiligen
Geistes, durch die Entwicklung der Malerei begleitet — Gegenstände, die
entweder nach ihrem Gehalt oder mehr als formale Aufgaben beispielhaft
sowohl für die Kunst wie für ihren Anteil an den Ideen ihres Zeitalters sind.
Nun hat sich uns auch das Spiegelmotiv als eines erwiesen, dessen Gestal-
tung in den verschiedenen Epochen charakteristisch für diese war. Die Auf'
gäbe lohnte sich wohl auch darum, weil die einzelnen Zusammenhänge,
in denen der Spiegel eine typische Rolle spielt, teilweise rein weltlicher
Natur sind, so daß hier ein kleiner Beitrag zu einer profanen Ikonographie
geboten werden konnte — und zwar zu noch gänzlich unbearbeiteten Teilen
von ihr.
Freilich handelte es sich im Grunde nicht um ein, sondern um mehrere
ikonographische Leitmotive! Es waren ja sehr verschiedenartige Spiegel,
deren Darstellung und künstlerischer Verwendung wir nachgegangen sind.
Der Mensch vor dem Spiegel, das Spiegelbild, der magische und mantische
Spiegel: ihre „Spiegelung" (wenn man so sagen darf) in der Malerei erfor/-
derte von uns jedesmal eine besondere Sicht. Auch wenn wir das Gerät
nicht in seiner konkreten Anwendung verfolgten, sondern als Sinnbild,
trafen wir auf ganz verschiedene Bedeutungen, von denen jede besonders
behandelt werden wollte. War also die Einheit, der innere Zusammenhang
der ganzen Arbeit nur dadurch gegeben, daß es sich „zufällig" immer um
Spiegel handelte — während der Sache nach doch jeweils ganz heterogene
Wir hatten unsere Untersuchung als eine — im weitesten Sinne —
ikonographische bezeichnet. In der Tat gehört es zur Ikonographie, wie
die heutige Kunstwissenschaft sie auffaßt, wenn ein charakteristisches
Motiv oder Thema, ein allgemeiner oder besonderer „Inhalt" künst'
lerischer Gestaltung in seinem Auftreten durch die Kunstgeschichte
verfolgt wird. So hat man historisclvikonographische Studien über die
„Taufe Christi" oder die „Anbetung der Könige" in der christlichen
Kunst geschrieben, hat auch Einzelheiten, wie etwa die Taube des Heiligen
Geistes, durch die Entwicklung der Malerei begleitet — Gegenstände, die
entweder nach ihrem Gehalt oder mehr als formale Aufgaben beispielhaft
sowohl für die Kunst wie für ihren Anteil an den Ideen ihres Zeitalters sind.
Nun hat sich uns auch das Spiegelmotiv als eines erwiesen, dessen Gestal-
tung in den verschiedenen Epochen charakteristisch für diese war. Die Auf'
gäbe lohnte sich wohl auch darum, weil die einzelnen Zusammenhänge,
in denen der Spiegel eine typische Rolle spielt, teilweise rein weltlicher
Natur sind, so daß hier ein kleiner Beitrag zu einer profanen Ikonographie
geboten werden konnte — und zwar zu noch gänzlich unbearbeiteten Teilen
von ihr.
Freilich handelte es sich im Grunde nicht um ein, sondern um mehrere
ikonographische Leitmotive! Es waren ja sehr verschiedenartige Spiegel,
deren Darstellung und künstlerischer Verwendung wir nachgegangen sind.
Der Mensch vor dem Spiegel, das Spiegelbild, der magische und mantische
Spiegel: ihre „Spiegelung" (wenn man so sagen darf) in der Malerei erfor/-
derte von uns jedesmal eine besondere Sicht. Auch wenn wir das Gerät
nicht in seiner konkreten Anwendung verfolgten, sondern als Sinnbild,
trafen wir auf ganz verschiedene Bedeutungen, von denen jede besonders
behandelt werden wollte. War also die Einheit, der innere Zusammenhang
der ganzen Arbeit nur dadurch gegeben, daß es sich „zufällig" immer um
Spiegel handelte — während der Sache nach doch jeweils ganz heterogene